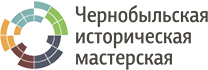Ljudmila

Ljudmila
Birth date:
Place of Birth:
Place of residence:
Ljudmyla Basijewa (im Folgenden L.B.): Heute ist der 30. Mai 2013.
Natalija Kozlowa (im Folgenden N.K.): Wir sind in „Sojuz Tschernobyl“. Wie heißen Sie?
L.B.: Ich heiße Basijewa Ljudmyla Nikolajywna. Ich bin aus der Stadt Tschernobyl am 5. Mai 1986 evakuiert worden.
N.K.: Meine erste Frage an Sie ist ziemlich umfangreich: Erzählen Sie die Geschichte ihres Lebens, was Sie für wichtig halten.
L.B.: Ja, also. Meine Mutter kommt aus Tschernobyl, sie wurde dort geboren. Mein Vater ist in Tambower Oblast geboren, er ist Russe, meine Mutter ist Ukrainerin. Was interessant ist, dass als er 20 Jahre alt war, studierte er in Charkiw, in der Panzerschule, und damals wurde er aus Charkiw in den Krieg geschickt. Also, er ging den Krieg und blieb bis zum Ende des Krieges da, dann kam er als Offizier der Sowjetarmee nach Deutschland.
N.K.: Aha.
L.B.: Wir lebten vier Jahre lang in der Stadt Neustrelitz. Also, ich ging dort zur Schule. Dann, nachdem unser Vater dort seinen Wehrdienst abgeleistet hatte, fuhren wir nach Tschernobyl. Warum? Weil mein Vater im Dorf lebte, und im Dorf hatte man damals natürlich keine guten Aussichten. Er war ja ein intelligenter und gebildeter Mensch, also zogen wir nach Tschernobyl um. Da mein Vater im Krieg gewesen war, hatte er später Führungspositionen, er war Direktor vom Kulturhaus, Leiter des Kreiskomitees der Partei, dann Personalabteilungsleiter des Verbraucherverbands unseres Bezirks, und wir lebten dort. Meine Mutter war Bankangestellte, sie war Kassenwartin, also zahlte sie Geld aus. Es gab keine richtige Bank in Prypjat, weil es dort nur eine Strojbank gab, und alle Kunden bekamen natürlich Geld bei uns. Meine Mutter war eine sehr verantwortliche Arbeiterin, sie war sehr beliebt, und alle in der Stadt kannten uns. Nachdem ich dort die Schule beendet hatte, ging ich auf die Polytechnische Fachschule, ich beendete sie und kam in meine Heimatstadt zurück. Da unser Städtchen nicht groß ist, war es für mich schwer eine Stelle dort zu finden. Ich wollte doch nicht in einem Betrieb arbeiten, das ist nicht für so eine intelligente und schöne Frau wie ich (lacht).
N.K.: Na, natürlich.
L.B.: Es ist Spaß natürlich. Mir wurde angeboten, in einer Buchhandlung als Verkäuferin zu arbeiten. Denn der Zugang in Buchhandlungen war sehr beschränkt. Es wurde oft gestohlen und die Buchhändler sollten zuverlässig sein. Ich wurde also eingeladen und habe dort drei Jahre gearbeitet. Dann hat man mir angeboten, in der Inventurabteilung des Kreiskomitees der Partei zu arbeiten.
N.K.: Aha.
L.B.: Ich habe dort also auch eine Zeitlang gearbeitet. Und dann arbeitete ich als Sicherheitsingenieurin in unserem Krankenhaus. Und mein Vater arbeitete damals auch noch, obwohl er schon in der Rente war, er arbeitete als Lagerhalter im Betrieb „Bytradiotechnika“. Na, dort wird das ganze Zeug repariert: Radios, Tonbandgeräte, Fernseher und so weiter. Aber er war nicht dafür ausgebildet, und dazu noch Rentner, und da ich die Polytechnische Fachschule beendet habe, hat man mir angeboten dort zu arbeiten. Mein Vater ging auf die Rente, und ich wurde Hauptlagerhalterin und arbeitete dort bis zur Tschernobyl-Katastrophe.
N.K.: Aha.
L.B.: Bis zur Tschernobyl-Katastrophe. Und natürlich gingen meine Kinder zur Schule. Ich habe zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. Mein Sohn, war in der achten Klasse, und meine Tochter in der vierten, als der Unfall im Atomkraftwerk von Tschernobyl passiert ist. Und dann, als das passiert ist… Wir lebten in der Nähe von einem Milizrevier. Am 26. April stand ich früh auf, die Sonne schien, … Alles war bunt, alles blühte, die Stadt war sauber und schön. Als ich am Milizrevier vorbeikam, sah ich dort sehr viele Leute. Und alle waren Militärleute, manche waren in Weiß gekleidet, die waren aus verschiedenen Truppen. Ich dachte, das war irgendwelches Training, nichts mehr. Ich kam zu Arbeit und erfuhr, dass es auf dem Atomkraftwerk eine Explosion gegeben hatte. Manche Mitarbeiter waren nicht mehr bei der Arbeit. Man besprach, ob es einen Brand gegeben hatte und ob er gelöscht worden war. Wir wohnten zehn Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt, das ist natürlich länger auf der Autobahn, doch die Strahlung verbreitet sich nicht nach Autobahnen!
N.K.: Na, sicher!
L.B.: Und durch die Luft sind es zehn Kilometer. Ich habe ein bisschen den Faden verloren… Also, kurz gesagt, diese Havarie ist passiert. Was ich aber noch sagen wollte: Obwohl wir in der Nähe vom Atomkraftwerk lebten, niemand hat uns niemand Einweisungen gegeben. Die Mitarbeiter des Zivilschutzes machten nichts. Und als die Havarie passierte… Es sollte einen Goldbestand, wie man so sagt, und notwendige Medikamente haben, aber damals stellte es sich heraus, das dфы Verwendbarkeitsdatum aller Medikamente schon abgelaufen war. Wir wussten nichts, was wir tun sollten, nichts…Wir wussten nicht, dass man das Haus nicht verlassen die Fenster nicht öffnen durfte. Und meine Kinder gingen in die Schule, außerdem legte mein Sohn irgendeinen Test im Sportunterricht ab. Es gab keine Panik. Ich arbeitete auch, ich hatte auch… Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll oder nicht?
N.K.: Wie Sie nötig finden.
L.B.: Macht nichts. Also, man versammelte uns, die Führungspositionen hatten, am 27. April im Kulturhaus, und ich war auch dabei. Man hat uns mitgeteilt, dass es auf dem Kraftwerk eine Explosion gegeben hatte und ein Mensch gestorben war, ein Feuerwehrmann, nur keine Panik und so weiter. Na, und natürlich fragten die Frauen, ob man Urlaub mit zwei Kindern für drei Tage nehmen durfte, um… „Niemand fährt irgendwo. Es findet am ersten Mai eine Demonstration statt, und keine Panik, alles ist in Ordnung.“ So waren unsere Anweisungen. Na, natürlich wurden wir dann am fünften Mai evakuiert. Man sagte uns Dokumente, Geld, etwas Kleidung zu nehmen und so weiter. Wir wurden mit Bussen transportiert, aber wir fuhren nicht nach Borodjanka, weil es bei Kiew… Kennen Sie Shuljany?
N.K.: Ja, ja.
L.B.: Shuljany Lufthafen, es gibt da eine Stadt, nein, ein Städtchen – Wyschnjowoje. Dort wohnen unsere Freunde und wir fuhren zu ihnen. Irgendwie, durch ein Wunder konnten sie uns erreichen und wir fuhren zu ihnen. Sie hatten ihr eigenes Haus und da gab es Platz für uns. Als wir durch den Hof betraten, begrüßten sie uns, empfingen uns fröhlich, aber ließen uns nicht hinein. Sie ließen uns zuerst baden, die Haare waschen, gaben uns ihre Kleidung. Wir waren sehr viele. Ich, also meine Familie – vier Menschen, Mutter und Vater, und die Familie der Schwester – auch vier Menschen. Zehn Menschen sind nicht wenig, oder? Sie gaben uns Kleidung, gaben uns was zum Essen und zum Trinken und natürlich gaben sie uns die Unterkunft. Und wir wohnten dort drei Tage lang. Und wir haben beschlossen – mein Mann kommt aus dem Kaukasus – und wir beschlossen dorthin zu fahren. Wir waren zehn Menschen, und wir wussten nicht, wie lange noch wir hier wohnen konnten, das war klar, dass wir nicht sehr lange dort wohnen konnten.
N.K.: Na klar.
L.B.: Ich stand Schlange, weil es in Kiew schon Panik gab. Etwa zehn Stunden mehr…
N.K.: Um Fahrkarten zu kaufen?
L.B.: Ja. Ich hatte einen Stapel von Pässen in den Händen, warum? Denn die Freunde, bei denen wir wohnten, hatten auch beschlossen, auf Urlaub zu fahren.
N.K.: Aha.
L.B.: Ja, sie zwei und ihre Kinder – auch vier Menschen. Und das alles, wir alle.
N.K.: Zusammen?
L.B.: Ja. Es gab keine Fahrkarten. Ich sagte: Wir sind doch gleich aus Tschernobyl gekommen. Wir fuhren im Sitzwagen, weil wir kauften, was übrig blieb. 28 Stunden in einem Sitzwagen, von Kiew bis Mineralni Wody. Dort wurden wir mit einem Lastwagen abgeholt und fuhren nach Naltschik. Und ich arbeitete dort, natürlich. Ich sage ihnen noch eine Sache, ich habe dort darüber natürlich schon geschrieben. Ich war Oberkassenwartin, ich trug materielle Verantwortung und machte mir Sorgen um das alles. Und plötzlich habe ich ein Telegramm, dass ich in Tschernobyl fahren und das alles abtransportieren sollte. Natürlich war ich sehr aufgeregt. Denn wir wussten nichts von der Radiation, wie die Situation war. Ich sollte alles da lassen, meine Familie, und fahren. Ich war ja materiell verantwortlich. Was, wenn etwas los war? – dachte ich. Also, ich kam nach Kiew zu Oblradiotechnika, in unsere regionale Organisation. Und sie sagten mir, dass ich auf jeden Fall nach Tschernobyl fahren musste. Denn ich arbeitete im SKB, Sonderkonstruktionsbüro vom „Telemechanika“ in Naltschik. Und ich dachte, ich arbeitete schon dort und war verantwortlich, ich sollte auf der Arbeit sein, also sollte ich fahren. Ich war absolut ratlos.
N.K.: Na klar.
L.B.: Also, ratlos. Sie kamen zu mir und sagten: „Ljuda, weißt du, es gibt eine Dienstreise nach Kiew“. Ich sagte: Entschuldigen Sie, aber ich verstehe nichts, ich habe im Beruf fast nicht gearbeitet. „Macht nichts, mach dir keine Sorgen“. Der Leiter gab mir ein Blatt Papier, wo sechs Positionen von Chips geschrieben standen, die ich am Lager von Kiewer Betrieb „Kristall“ kriegen sollte.
N.K.: Aha.
L.B.: Ich fuhr nach Tschernobyl und zeigte ihnen dieses Dokument vor. Und auch ein interessantes Ding – wie im Film: Sie gaben mir eine Telefonnummer und sagten mir, dass wenn nichts klappen würde, ich mich an diesen Menschen wenden sollte. Seinen Namen habe ich natürlich vergessen. Ich fuhr hin und her, hin und her, weil ich nicht … Sie sagten mir: „Bleib in Tschernobyl, hier kannst du alles, eine Wohnung, ein Haus haben. Und ich hatte Angst, warum war es mir so ängstlich zumute, warum? Das war September 1986. Es gab nichts zu essen, alle Geschäfte waren leer. Es gab sehr viele Männer, nicht etwa, dass sie mir etwas hätten antun können, mir gruselte es einfach. In weißen Schuhüberziehern, in weißer Kleidung, mit weißen Atemschutzmasken, alles in Weiß, wie in einem Science-Fiction-Film… Viele Menschen bummeln in solcher Kleidung durch die Stadt. Ich hatte einfach Angst. Und ich pendelte so jeden Tag: Ich stand um fünf Uhr auf – Shuljany, ich fuhr aus Wischnjowoje mit der Schnellbahn nach Kiew, durch das ganze Kiew fuhr mit der U-Bahn bis zur Autostation „Polesje“. Dort kaufte ich eine Fahrkarte auf meine eigenen Kosten, fuhr nach Iwankow, dort hatte unsere Organisation auch eine Filiale. Dort gab man mir einen Wagen, ich stieg in diesen Wagen ein und fuhr nach Tschernobyl. In Tschernobyl arbeitete ich, ich hatte immer ein belegtes Brötchen mit, alles war doch geschlossen. Und dann genauso zurück…
N.K.: Und wie lange war es so?
L.B.: Bis Ende September.
N.K.: Hoho!
L.B.: Natürlich. Und da ging es ein Gerücht um, dass es keine Rückkehr geben wird, dass Leute schon Wohnungen am neuen Ort bekommen haben. Und ich war hier, meine Familie war dort. Stellen Sie sich vor: Es gab keinen Taschenrechner, nur das Rechenbrett. Man musste doch das alles verrechnen. Und dort gab es Bildwiedergaberöhren, Fernseher – das sind große Dinge – Transformator, Lampen, und so weiter. Und es gab auch KSs, verschiedene Transistoren – ich habe schon vergessen, wie das ganze Zeug heißt. Und man musste das alles abrechnen, und dort gab es sogar solche Details, die man mit einer Pinzette nimmt und sie rechnet. Und ich hatte die Aufzählung von allen diesen Details gemacht, ich hatte alles abgerechnet, in diese… Verpackung gelegt.
N.K.: In irgendwelchen Behälter.
L.B.: In Behälter, in Verpackung, ja. Man schickte mir einen Lastwagen, solch einen großen Wagen, man lud das alles. Auch ein Lastträger kam mit mir, ein Maschinenmeister, wie war sein Name? Ich habe vergessen. Und wir beluden die Lkws damit. Wir kamen auf die Sichtungsstelle und man hielt mich an: „Was tragen Sie?“ Ich sagte, was ich trug. Und ich war noch eine junge Frau, 38 Jahre alt, und ich war so klein, wie jetzt. „Sie sollen ein Inventar über sämtliche Waren, die Sie tragen, aufnehmen“. Mein Gott! Ich werde das zwei Tage lange beschreiben. Ich hatte so viel geschrieben, so viel gerechnet, und da musste ich das alles wieder aufnehmen. Also, so ist es, ich erzähle, was damals war.
N.K.: Aha.
L.B.: Manches schrieb ich auf, manches nicht. Und ich sollte das alles abgeben, ich sollte nach Kiew fahren, das ans Lager abgeben. Und wenn ich in der Nacht gekommen wäre, hätte ich dort im Wagen übernachten müssen, weil ich dass alles bewachen sollte, ich trug doch materielle Verantwortung. Ich kam zum Lager, doch man nahm das von mir nicht an. Ich sagte: „Was ist los?“ –„Die Details sind gebraucht. „Wieso gebraucht?“ Damals gab es noch Fernseher mit einer Linse von der Marke „Reford“, glaube ich, die Fernseher entwickelten sich Schritt für Schritt. Und wenn ein Fernseher kaputt war, brauchte man solch ein Detail. Wir bestellten das in Kiew und es wurde gebracht. Man brachte nie nur ein Detail, man brachte zwei oder drei. Man gebrauchte eins und dann blieben noch zwei übrig – und so häufte es sich an. Sie sagten: „Wir brauchen sie nicht.“ Und sie schickten mich ans andere Ende der Stadt, dort gab es ein Lager für gebrauchtes Zeug. Das war im Keller. Und dort nahm man das an. Ich kam zu Bytradiotechnika. Der Hauptbuchhalter sagte meinem (unklar), der unmittelbar in Tschernobyl war: „Wissen Sie, schicken sie das Mädchen nach Hause. Ihre Familie ist dort, und bringen Sie alles in Ordnung.“
N.K.: Aha.
N.K.: Aha.
L.B.: Sie zahlten mir 70 Rubel und ich fuhr. Aber jetzt kehre ich ein bisschen zurück. Als ich arbeitete, kriegte ich eine Aufgabe von meinem Chef. Ich kam dorthin und wandte mich an sie, und sie antworteten: „Es gibt nichts, keine Chips (Mikroschaltelemente), sie sind sehr selten“. Und ich rief diesen Menschen an, aber der Betrieb war riesengroß, es gab eine große Menge von diesen – Wie heißt das? Also, es war besetzt. Ich ging rum, hin und her. Und ich hörte jemand mich rufen: „Ljudmila!“. Ich dachte, was sollte das sein? Auf der anderen Seite vom Kontrollpunkt sah ich meine Schulkameradin. „Was machst du denn da?“ Sehen sie, wie im Film.
N.K.: Das kommt vor.
L.B.: Ich sagte: so und so. „Warte mal“. Sie brachte noch meine andere Schulkameradin mit. Na, sie arbeiteten dort in Kiew, deswegen hatten sie schon Wohnungen, und dort wohnten die Familien usw. Na, ich erzählte ihnen die ganze Geschichte, wie ich auf Dienstreise kam. Ich sagte, dass ich telefonieren musste, doch es war dort besetzt, deshalb war ich da. Und diese Schulkameradin – Lida Leonowa – sie sagte: „Das ist mein Chef“. Stellen Sie vor! Sie rief ihn hierhin, er nahm dieses Papier, und kurzum brachte ich drei aus sechs Positionen hierher. Also, ich erfüllte die Aufgabe und führte das Lager aus, alles. Und dann wies man uns ein, und danach schon… Ich will sagen, dass mein Mann nicht wegfahren wollte, weil das seine Heimat und alles für ihn war. Und man gab uns immer noch keine Wohnung. Ich kam in die Sprechstunde zum ersten Sekretär des regionalen Komitees der Partei von Kabardino-Balkarien.
N.K.: Aha.
L.B.: Ich war in seiner Sprechstunde, er sprach mit mir, er sagte: „Wir haben keine Wohnungen. Diesmal können wir nicht einmal Wohnungen unseren Veteranen des Kriegs geben. Ohne Einweisung wird niemand Ihnen eine Wohnung geben.“ Na, man gab der Mutter eine Wohnung – sie fuhr weg, man gab dem Vater… ich meine, man gab der Schwester – sie fuhr weg, aber er wollte nirgendwo fahren. Na, kurzum sah er, wie die Situation war, und wir hatten keine andere Wahl, nur drei Städte standen uns zur Verfügung: Charkow, Ivano-Frankowsk und Lwow. Na, ich wählte Charkow, ja. Und wir kamen in Charkow im Dezember, am 28. Dezember 1986 an. Dann fand mein Mann einen Job, ich fand auch einen, die Kinder gingen zur Schule usw. Und noch eins: Meine Tochter wurde zur Schule nicht aufgenommen.
N.K.: Wieso?
L.B.: Na, mein Sohn war älter. „Sie haben keine Personalakte.“ Ich sagte: „Sehen Sie, wir haben alles dort gelassen.“ „Solange Sie das nicht vorlegen, nehmen wir das Kind in die Schule nicht auf.“ Ich sagte: „Na, was ist das für ein Unsinn, wo soll ich denn das kriegen? Alles ist doch…“ Also, ich sagte das. „Na gut, schreiben sie den Antrag.“ Na, ich schrieb den Antrag, dass ich gegen den zehnten oder den 15. September – ich erinnere mich schon nicht daran – diese Personalakte haben werde. So war die Sache erledigt. Es wäre alles.
N.K.: Na, und ging er zur Schule?
L.B.: Ja, sie gingen zur Schule, alles war in Ordnung. Na, sehen Sie, was kann ich hier noch sagen? Ich will sagen, dass meine Mutter und mein Vater in einem Privathaus wohnten. Wir hatten einen schönen Garten, die Mutter beschäftigte sich mit Blumen, das machte ihr Spaß, das war ihr Hobby. Und all das Zeug musste man im April verlassen, wenn alles blüht: holländische Tulpen, Büsche, blühende Büsche, es gab so viele Rosen, so viele Arten von Flieder, so eine Menge von alldem! Als der Schnee taute und…
N.K.: Alles blühte auf.
L.B.: Alles war aufgeblüht und so musste es bis zum Kälteeinbruch sein. Und alle diese Schönheit musste man verlassen. Wie meine Mutter keinen Herzanschlag kriegte, weiß ich nicht. Noch eins: Nachdem man uns umgesiedelt hatte, kam das ans Licht… Sicherlich verzichteten viele Menschen darauf, von dort wegzufahren – sie versteckten sich in Kellern, auf dem Dachboden. Sie wurden herausgeangelt, herausgesucht, mit Gewalt in Verkehrsmittel gesetzt und umgesiedelt.
N.K.: Und warum haben sie sich versteckt?
L.B.: Denn wie konnte man das…?
N.K.: Wie konnte man das alles verlassen, ja?
L.B.: Ja. Sie säten alles, pflanzten alles, und nun musste das alles verloren gehen. Es schmerzte sehr. Manche Menschen hatten eben alles eingerichtet, das Haus gebaut, die Einzugsfeier gefeiert – und da musste man das alles verlassen. Ja, ich höre Ihnen zu. […]
N.K.: Ich wollte nur nach den Veranstaltungen an Gedenktagen von Tschernobyl-Katastrophe fragen. Wie meinen Sie, ist das genug oder würden Sie etwas ändern? Was sollte man Ihrer Meinung nach dafür machen, um es nicht zu vergessen?
L.B.: Ich will sagen, es ist gut, dass Sie diese Frage angesprochen haben. Ich will sagen: Man siedelte uns um, wir ließen das Vieh da: Jemand hatte ein Ferkel, jemand hatte eine Kuh, jemand hatte alles. Ich bin dem Staat sehr dankbar. Für das Umzugsgeld, die sie uns gegeben haben, für die Wohnung, die sie uns zur Verfügung gestellt haben (in Tränen ausbrechend, weint) … Na, was will ich sagen, ich bitte um Entschuldigung… (Weint) Es tut mir persönlich jetzt Leid, wie ich persönlich von mir selbst spreche, denn jeder Mensch – der eine ist emotionell, der andere ist nicht emotionell – man hat eine Wohnung gegeben und Gott sei Dank. Und ich, ich leide – wofür? (weint weiter) Also, die Liquidatoren kamen, (hat aufgehört zu weinen) die aus innerem Antrieb daran teilnahmen, obwohl manche auch von Militäreinheiten dorthin geschickt wurden. Aber dann, nach 1986 waren das Menschen, die dorthin fuhren, um viel Geld zu verdienen. Denn man hat sie gut bezahlt. Sicherlich riskierten sie ihr Leben dort, aber sie kriegten Geld dafür. Wir lebten aber dort, es gab Strahlung und Emissionen, wir wussten nicht davon. Wir wurden bestrahlt. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist jetzt, momentan, ich will über die Gegenwart erzählen: Die Liquidatoren wurden verehrt, sie bekommen große Renten, sie bekommen… Man hat manchen sowohl Autos als auch Wohnungen gegeben. Aber ich will etwas anderes sagen, auf etwas anderes achten: Sie sind nach Hause zurückgekommen…( in Tränen ausgebrochen) In ihre Wohnung, zu ihrer Arbeit, ihre Freunde, Bekannten und Verwandten sind nah, alles… (spricht mit einer von Tränen erstickten Stimme) Und wir? Wir sind wie Waisen. Na, man hat uns eine Wohnung gegeben, alles. Aber wir sind Waisen, niemand erinnert sich an uns, alle haben uns vergessen. Sie haben uns vergessen, und unsere Kinder vergessen, und alles vergessen…
N.K.: Ich verstehe…
L.B.: Mein Kind ist ein Behinderter des dritten Grades… Die Verbindung mit Tschernobyl. Wir haben einen Antrag bei Gericht gestellt. Das Gericht rechtete uns zu. Dieser Pensionsfond legte eine Berufung ein. (hat aufgehört zu weinen). Das Berufungsgericht gab das Urteil, etwas zu bezahlen. Dann brachten wir diese in dasselbe Gericht, Kreisgericht, wieder. Das Kind kriegt tausend Hrywnja Rente. Was soll das heißen? Ist das erlaubt?
N.K.: Ich verstehe, das muss man im Gedächtnis haben…
L.B.: Das alles muss man aufklären. Wir, unsere Kinder, sie, ich weiß nicht, meine Tochter war eben in solchem Alter, als diese Prozesse, Änderungen…
N.K.: Ich verstehe.
L.B.: Sie verstehen selbst, unser Körper auch. Also, wovon ich spreche, ich kehre noch dazu zurück. Sie sind nach Hause zurückgekehrt. Ja, sie haben Probleme mit ihrer Gesundheit, aber wir auch. Aber wir haben auch Menschen verloren, ich meine, wir haben Verwandte, Bekannte, Freunde verloren. Zum Beispiel gab man meiner Schwester eine Wohnung in Mukatschewo, meinen Eltern eine Wohnung in Odessa, uns eine Wohnung in Charkow. Hatten sie das Recht, uns zu zerstreuen? Wir haben niemanden hier. Wo sind unsere Freunde, wo sind unsere Verwandten? Manche sind in Kiew, manche sind hier, manche sind dort. Wir sind Waisen. Ja, ich höre Ihnen zu.
N.K.: Ich verstehe, Sie haben recht…
L.B.: Ja, und wie soll man das verstehen? Jetzt werden nur Liquidatoren verehrt, Liquidatoren, Liquidatoren. Und wir? Man hat uns…
N.K.: Na, das stimmt.
L.B.: … Vergünstigungen weggenommen, man hat uns alles weggenommen. Man hat uns verlassen und weggeschmissen.
N.K.: Und bezüglich der Ukraine im Ganzen, wie hat Ihrer Meinung nach, die Havarie die Gesellschaft und ihre Weltanschauung beeinflusst? Ich meine, hat sie beeinflusst oder nein, was meinen Sie?
L.B.: Ich will Ihnen sagen, es gibt sehr wenige Informationen. Und sogar jetzt, sogar Erwachsene, geschweige denn Kinder, wissen das nicht. Umsiedler, Umsiedler, Umsiedler! Es gibt drei Gruppen: Es gibt Liquidatoren, es gibt Umgesiedelte, und es gibt Umsiedler, die nach zwei, drei, fünf Jahren selbst entschieden habe, umzuziehen, diesen Ort zu verlassen und dorthin umzuziehen. Und sie sagen: „Tschernobylzy! Tschernobylzy! Tschernobylzy!“ Wer sind „Tschernobylzy“? – Das sind Liquidatoren. Und wir sind „Tschernoljane“, und es ist richtig „Tschernoljane“ zu sagen. Und was ich noch sagen will, in der letzten Zeit schrie man: „Kein Tschernobyl“ auf allen diesen Meetings. Warum „Kein Tschernobyl!“? Woran ist die Stadt schuld? Sie leben in Charkow und wie finden Sie die Losung „Kein Charkow!“ Wie sind Ihre… Gellt das Ihnen nicht in den Ohren?
N.K.: Es ist natürlich beleidigend.
L.B.: Beleidigend. Wie können erwachsene, sgebildete Leute so was sagen? Das ist unsere Stadt, hier, ich habe was mitgebracht (Zeigt das im Voraus vorbereitete dem Thema Tschernobyl gewidmete Buch und ein Album mit in Tschernobyl gemachten Fotos) Ich will, ich weiß nicht, vielleicht schalten Sie das aus? Ich will Ihnen das Mitgebrachte… Ich habe selbst für mich gemacht – warten Sie mal – ich habe das für mich selbst gemacht, wenn ich alle zwei oder drei Jahre nach Tschernobyl fahre. Ich habe die Stadt fotografiert.
N.K.: Sind Sie dort schon gewesen, ich meine, vor Kurzem?
L.B.: Natürlich! Ich fahre alle zwei oder drei Jahre dorthin. Ich bin dort schon seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gewesen. Ich habe für mich selbst die Stadt fotografiert, ich habe ein Gedenkalbum gemacht, ich weiß nicht. Und man hat bei uns… vor zwei Jahren unsere Kirche renoviert. Alles ist doch ausgeraubt, fortgeschleppt, es gibt nichts im Haus. Wer, wer ist das? Wir nahmen nichts mit, man erlaubte uns nicht. Und warum diese Liquidatoren, die zu uns kamen, um die Folgen der Havarie zu beseitigen, warum betraten sie fremde Häuser? Das sind nicht eure Sachen, das gehört euch nicht, ihr wisst doch, dass das verstrahlt ist. Sie haben alles fortgeschleppt, es gibt nichts mehr da. Ich trat in mein Haus ein, es gab keine Möbel, überhaupt nichts. Alle Sachen, die dort geblieben sind – der Läufer zur Außentreppe, ich zeige das Ihnen gleich (zeigt das Foto Ihres Hauses). Und die Kirche, die renoviert wurde, wir haben eine sehr alte Kirche. Unsere Stadt wurde 1193 gegründet. Dieses Jahr wird sie schon 820 Jahre alt. Und es gibt Menschen, die sich damit beschäftigt und „Tschernobyl“ veröffentlicht haben – die Stadt, ich meine, das Buch über unsere Stadt. Hier standen historische Dinge, es gibt sehr viele Fotos hier, ja. Ich habe Buch gekauft. In der Kirche verkauft man sehr viele Bücher, in unserer Tschernobyler Kirche. Und dieses Buch ist sehr wertvoll für mich. Ich sage, hier beschreibt man solche…
[…] N.K.: Deswegen wollte ich nachschauen, wer der Autor ist. Ach! Mykola Tschernigovez, Natalija Tschernigovez, Tschernobyl. Aha, gut.
L.B.: Hier sind sie… Meine Seele leidet und jetzt kommen Menschen, die den Sarkophag bauen. Und sie leben in unserer Stadt, besetzen unsere Häuser. Na, warum kann man in solch einer Kurort kein Haus haben, es renovieren und hier leben? Ja. Dort lebt der Vetter meiner Mutter, mein Onkel seit 1993. Schalten Sie jetzt das bitte aus, ich zeige Ihnen die Fotos.
Audio Nr. 3
N.K.: Also, heute ist der 14. Juni 2013. Heute treffen wir uns im Schewtschenko-Garten am Springbrunnen mit Ljudmila Nikolajewna Basijewa. […] Das ist schon das zweite Treffen und mich interessiert, wie Sie das, was in diesen Jahren und danach passiert ist, wahrnehmen. Und die erste Frage, die mich interessiert: Erinnern Sie sich an diesen Moment, als Sie begannen, die Havarie als eine Tragödie wahrzunehmen? Also, als Sie verstanden, dass es eine Tragödie war.
L.B.: Ich will persönlich sagen, dass ich den Ernst dieses Ereignisses in vollem Sinne nicht fühlte. Ich dachte: eine Havarie, ein Brand, der Brand wird gelöscht und alles. Dasz eugt davon, dass wir zwar neben dem Atomkraftwerk lebten, waren aber sehr schlecht informiert. Sie bauten ein Atomkraftwerk – na was? Und ich habe überhaupt nicht gedacht, dass es so ein Ausmaß haben konnte. Und dann, als man die Wolke… als man diese radioaktive Wolke bemerkte, irgendwo im Ausland, in Schweden oder so was…
N.K.: Aha.
L.B.: Ich erinnere mich schon nicht mehr daran. Und man begann, uns auf die Evakuierung vorzubereiten, dann begannen wir schon zu überlegen. Aber man sagte uns – für drei Tage. Aber wir nahmen darauf keine Rücksicht. Das zeugt von unserer Unwissenheit, darüber, dass wir nicht genug Informationen darüber hatten, dass im Atomkraftwerk eine Explosion möglich ist. Obwohl wir zuerst in der Schule, dann in der Fachschule Zivilschutz als Fach lernten. Ich will persönlich sagen: nur als ein Fach. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass eine Tragödie wirklich passieren konnte, dass…
N.K.: Und in welchem Augenblick kam der Gedanke, dass das etwas wirklich Schreckliches war?
L.B.: Es war schrecklich, als nach drei Tagen es überhaupt nicht in Frage kam, uns zurückkommen zu lassen. Wir sahen fern, hören uns die Nachrichten an. Alle saßen zusammen vor diesem Fernseher, verfolgten das aufmerksam und hörten aufmerksam zu, wann der Moderator sagt, dass man nach Tschernobyl zurückkommen konnte. Und dann entstand diese Frage: Wo müssen wir wohnen? Wo müssen wir wohnen? Man kann nicht bei fremden Menschen wohnen. Ich habe früher gesagt, dass wir…
N.K.: Na ja.
L.B.: Wir entschieden nach Naltschik zu fahren, weil wir dort Verwandte hatten. Ich denke, es war da besser zu leben… Wir riefen sie aus Kiew an.
N.K.: Also in diesem Augenblick, als Sie verstanden – wenn ich Sie richtig verstanden habe – dass Sie nicht mehr zurückkommen, entstand die Angst?
L.B.: Angst, Angst und alles. Umso mehr Kinder, zwei Kinder. Meine Tochter war elf und mein Sohn war 15, und sie brauchten Schule. Und wir hatten nichts, keine Kleidung, keine Schuhe, weder Löffel noch Gabel, überhaupt kein Eigentum. Wir hatten keinen Lappen, um den Tisch abzuwischen.
N.K.: Na ja.
L.B.: Es gab keinen Lappen um den Tisch abzuwischen, weil wir nichts hatten, wovon man dieses Stück abreißen konnte, um… Vielleicht soll ich das nicht sagen, aber sogar in dieser Hinsicht hatten wir nichts.
N.K.: Ich verstehe. Na und natürlich die ersten Gedanken waren, was sollte man tun?
L.B.: Ja, was sollte man tun? Aber dann, als wir gekommen waren, begannen wir uns allmählich einzuleben, aber die Leitung … Die Leitung unseres Landes erließ irgendwelche Verordnungen, dass man eine Stelle finden soll, dass man uns in den Dienst mit solchem Gehalt nehmen soll, dass nicht niedriger als wir früher verdienten, sein soll. Die Kinder gingen in die Schule. Allerdings erinnere ich mich nicht daran, ob ich das schon erzählt habe, dass als ich mich um eine Stelle bewarb und mich dafür medizinisch untersuchen ließ, wollten manche Ärzte mich nicht untersuchen, weil sie dachten, dass ich kontaminiert war. Sie sagten: „Sie sind doch kontaminiert! Sie sind gefährlich!“ So war es.
N.K.: Hatten sie Angst, ja?
L.B.: Natürlich. Sogar die Ärzte, falls sie sich so benahmen. Ich sagte: „Und wenn ich mit dem öffentlichen Verkehr fahre, durch die Straßen gehe, so muss man mich in eine Kammer sperren?“
N.K.: Also, Sie spürten diese Angst in der Gesellschaft?
L.B.: Die Angst und die Ignoranz bezüglich dieser Frage.
N.K.: Und das konnte man sogar im…
L.B.: Ja, genau.
N.K.: … im Alltag sehen.
L.B.: In solchen alltäglichen Situationen.
N.K.: Also, man wusste nicht, wie man sich benehmen sollte, ja?
L.B.: Und deswegen, als wir nach Charkiw kamen, entschieden wir, unsere Herkunft zu verbergen. Meine Tochter sagte sogar: Mama, Gott erbarm… Sie wollte keine Verbindungen machen, aber sie lag zwei oder sogar drei Mal pro Monat in Krankenhaus. Der Junge war gesünder, denn er war älter. Als wir in Shuljany ankamen, nicht in Borodjaniwka, sondern zu unseren Freunden, fiel meine Tochter in Ohnmacht, und unsere Hälse taten uns allen weh, wir hatten Halskratzen. So waren die Symptome.
N.K.: Was hat Ihrer Meinung nach den Unfall im AKW verursacht? Warum ist das passiert? Warum ist das in anderen Stationen nicht passiert, aber hier war es so?
L.B.: Alles passiert irgendwo irgendwann zum ersten Mal. Es tut mir Leid, das die Regierung erlaubte, ein Atomkraftwerk in einem so schönen Ort zu bauen. Wenn es solche Möglichkeit gäbe, wäre es schön, dass ich und Walerij Fjodorowitsch dorthin fahren und dass Sie das alles selbst mit Ihren Augen sehen. Das ist sehr interessant, wie schön unsere Stadt ist, wie schön unser Ort ist. Dass man ein Atomkraftwerk in solchem Paradies gebaut hat! Man kam zu uns auf Urlaub, das war ein Urlaubsziel.
N.K.: Na ja.
L.B.: Und die Ursachen der Havarie – ich bin keine Expertin, aber ich will sie nennen. Damals existierte die Beschleunigung. Und ich will sagen, die Eile braucht man – es gibt ein Sprichwort, alle kennen das, trotzdem sage ich das – „Die Eile braucht man nur beim Flohfangen…“, und in solchen Sachen muss es keine Eil geben… Umso mehr konnte man das schon damals fühlen, und auch die Presse, auch eine Redaktion war bei uns in Prypjat. Sowohl bei uns in Tschernobyl, als auch in Prypjat gab es eine Redaktion. Dort war eine Redakteurin, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht daran, also, und man wollte sie zur Verantwortung dafür ziehen, dass sie schrieb, dass diese Blöcke und die Ausrüstung von schlechter Qualität waren, diesbezüglich… Und der Fehler war auch, dass man nicht mit solchen Sachen experimentieren durfte. Mit Menschen darf man nicht keine Versuche machen, mit Tieren auch, natürlich, aber die Menschen tun das, damit es gut den Menschen geht. Man darf nicht mit solchen ernsten Sachen experimentieren. Weil man mit Atom nicht spielt, Freund kann in jedem Augenblick Feind werden, wie es passiert ist.
N.K.: Na ja. Jetzt. Und wie… Sagen Sie bitte, wie war die Stimmung, als das Atomkraftwerk gebaut wurde?
L.B.: Wir waren sehr froh. Das fing 1970 an. 1970, als, ich weiß nicht, ich glaube, im Sommer. Ich weiß nicht genau. Aber 1970 fing der Bauprozess an. Worauf freuten wir uns? Weil viele Arbeitsplätze entstanden. Unsere Stadt ist nicht groß und es gab natürlich Betriebe, aber auf jeden Fall stand es nicht so gut mit Arbeit. Und die Leute waren froh, und dazu waren sie froh, dass man dort gut bezahlte. Das war gut für den Wohlstand der Familie. Umso mehr fuhren Busse nach Prypjat alle 30 Minuten – ich habe jetzt sogar den Fahrplan. Alle 30 Minuten fuhren Busse dorthin. Alle 30 Minuten!
N.K.: Absichtlich, ja?
L.B.: Alle 30 Minuten – die Verbindung war so gut. Und die Verpflegung war auch gut. Wir fuhren dorthin sogar, um Lebensmittel zu kaufen, wir fuhren dorthin, weil die Versorgung sehr gut war. Dort war sogar ein Geschäft „Berjoska“, dieses Geschäft, wissen sie, wo Artikel gegen internationale Währung an Ausländer verkauft wurden.
N.K.: Ja.
L.B.: Ja. Zuallererst brachte man dort Möbel, hauptsächlich das, weil man damit die Wohnung einrichten musste. Das war wie drei in eins: Lohn, Arbeit, und die Wohnung. Die Arbeiter bekamen sie sofort… Na, eigentlich nicht sofort, aber es wurden viel Wohnhäuser gebaut. Deshalb wurde eine neue Stadt gebaut, und man hat sie Prypjat genannt. Warum? Weil sie am Fluss Prypjat stand. Und das Atomkraftwerk wurde fünf Kilometer entfernt von der Stadt gebaut. Durfte man also so eine Bombe so nah zu einem Siedlungspunkt bauen?
N.K.: Na ja. Und welche Stimmung überwog? Als das Atomkraftwerk gebaut wurde, sagte der Stadt, ich meine, die Leitung der Partei, was das war?
L.B.: Wie informiert wir waren?
N.K.: Ja.
L.B.: Es gab keine Informationen.
N.K.: Keine?
L.B.: Keine Information überhaupt.
N.K.: Zum Beispiel, wie Ermunterungen… Na, Sie verstehen, was ich meine.
L.B.: Ja…
N.K.: Ich meine, die Bevölkerung hatte Vorteile, wie man sagte… Na, haben Sie das verstanden?
L.B.: Was? Wobei?
N.K.: Ich meine, bei der Arbeit, das war klar, alle wussten, dass sie eine Wohnung kriegen werden und so weiter.
L.B.: Jaja. Denn es wurden wenige Wohnhäuser bei uns gebaut und die Wartelisten waren sehr lang. Ich war selbst auf der Warteliste für eine Dreizimmerwohnung und habe das doch nicht gekriegt.
N.K.: Na, zum Beispiel, was sagte man? Wurde das Atomkraftwerk in in Hinsicht des Fortschritts präsentiert oder so?
L.B.: Ich würde nicht sagen, dass das so deutlich präsentiert war, aber sehen Sie, ich bin solch ein Mensch – ich arbeitete in einer Buchhandlung. Unsere Behandlung wurde nicht von jemandem, sondern von gebildeten Leuten besucht. Man kam zu uns, manche kamen aus dem Dorf wegen Lehrbücher, Schreibwaren, Hefte und so weiter. Aber wegen Literatur kamen meistens intelligentere Leute. Damals kannten wir das Wort „Elite“ nicht, aber so könnte man diese Menschen jetzt nennen. Und dazu war das… Jetzt liest man keine Bücher, aber damals tauschten die Menschen miteinander Bücher aus, besprachen sie. Und ich war sozusagen unter ihnen.
N.K.: Sie waren belesen.
L.B.: Genau! Ich war belesen, ja. Und dann lud man mich ein, im Stadtkomitee der Partei zu arbeiten. Aber dort war ich natürlich weder Sekretärin noch Instrukteurin. Ich war… ich arbeitete im Bereich der Parteibestandsführung. Und natürlich hatte ich Zugang zu allen Personalakten, alle Arbeiter waren gebildet. Aber ich habe keine Bedeutung dieser Sache beigemessen und nie meine Stelle betont: „Oh, ich arbeite dort!“. Meine Eltern sind auch so. Mein Vater arbeitete als Direktor der Dienststelle des regionalen Verbraucherverbandes, meine Mutter arbeitete als Kassenwartin bei der Bank. Alles dieses Geld wurde – nun kann man sagen, wie groß die Summen waren – millionenweise dorthin nach Prypjat geliefert. Ja, ich höre Ihnen zu.
N.K.: Und was diese Beseitigung der Folgen angeht, diese durchgeführte Arbeit, was meinen Sie, wie qualitativ wurde das gemacht?
L.B.: Na… Die Frage ist wirklich sehr interessant und muss an einen Spezialisten gestellt werden. Aber meinerseits will ich sagen – ich werde nicht über die Atomenergie sprechen, sondern nur über meine Heimatstadt. Man hat gemacht, was man nicht machen sollte. Man hat die Häuser abgerissen, was man natürlich nicht machen sollte. Dazu will ich noch mal sagen, dass diese fremden Menschen an die Stadt überhaupt nichtgedacht haben. Sie beraubten sie, zerstörten sie, ruinierten sie und so weiter. Und jetzt… Zum 25. Gedenktag der Havarie im Tschernobyl Atomkraftwerk wurde die ganze Seite der Zentralstraße in unserer Stadt abgerissen, man hat Kreuze aufgestellt. Na, die Kreuze sind nur bloße Worte. Na, da sind Aufschriften: Hier ist ein Kreuz, hier ist ein Stab und querdurch steht, welche Siedlungen evakuiert wurden und so weiter, und welche von denen es nicht mehr gibt.
N.K.: Sie haben auch über den Gedenkalbum erzählt.
L.B.: Ja, warten Sie doch, ich will noch was sagen. Dort waren Häuser. Als ich 2011 dorthin fuhr – nicht zum 26. April, ich habe bei meinen Bekannten gewohnt. Und man hat schon viele verschiede Denkmäler errichtet: „Der Dritte Engel“ – wie aus der Bibel, der aus Eisen gemacht ist. Es gibt viele Einbrüche – die Erde ist hinuntergegangen.
N.K.: Verstehe.
L.B.: Überall. Das hat man nicht machen sollen. Umso mehr in der Stadt, auf der Zentralstraße. Man hat die Zentralstraße wenigstens als historische Stadt bleiben lassen sollen. Wie ein historisches Erbe. Es tut mir sehr leid, es tut meiner Seele weh. Wenn ich mir das ansehe, so will ich weinen.
[…] N.K.: Zurück zum Thema. Es gibt viele Ideen und Programme zum internationalen Tourismus nach Tschernobyl. Was halten Sie davon und wie betrachten Sie das?
L.B.. Na, ich möchte Ihnen sagen, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Natürlich brauchen die Leute das, diejenigen, die nichts wissen, sie wissen nicht einmal, dass eine Explosion in Tschernobyl passiert ist, sie haben überhaupt keine Ahnung davon. Und die Menschen, die dorthin kommen, ich denke, dass die Leute wissen müssen, dass es eine solche Stadt gibt und dass dieser Unfall dort passiert ist – man muss die Menschheit (gebraucht ein ukrainisches Wort) warnen. Na, auf Russisch, wissen Sie…
N.K.: Die Menschheit (ein russisches Wort).
L.B.: N.K.: Die Menschheit (ein russisches Wort). Manchmal passt ein ukrainisches Wort besser, als ein russisches… Das fällt es ein und man will es gebrauchen.
N.K.: Na ja.
L.B.: Und das charakterisiert besser als das russische. All das, das uns passiert ist.
N.K.: Ich erinnere mich daran, Sie haben das Gedenkalbum gezeigt.
L.B.: Ja, ich habe es auch jetzt mit. Ich habe noch nicht alles fotografiert, das ist für mich selbst.
N.K.: Ich wollte Ihnen eine Frage nach dem Gedenkalbum stellen. Wessen Idee war das?
L.B.: Meine eigene.
N.K.: Ihre, ja? Das heißt…
L.B.: Natürlich, als…
N.K.: …ist das weder Ihre Tochter noch Ihre Familie?
L.B.: Nein, nein. Als ich dorthin fuhr, na, meine Tochter war dort nur zweimal. Und ich dachte: Alles wird zerstört, alles wird abgerissen – jemand muss das festhalten. Ich habe einfach eine Kamera mitgenommen und fotografiert – und ich hatte sie immer mit. Sie sagte: „Na, Mutti, nimm Kamera von unseren Bekannten und fotografiere.“ Sie war ja klein, damit das im Gedächtnis bleibt. War ich dort zum ersten Mal, fotografierte ich das eine, war ich zum zweiten Mal, fotografierte ich das andere. Ich will auch sagen, dass ich noch nicht alles fotografiert habe, und auf den Fotos kann man sehen, wie die Stadt sich ändert. Einmal stand dort dieses schreckliche Warenhaus, die Fenster waren zwar mit Brettern verschlagen, und so weiter. Und als ich dorthin 2011 ankam, war das Gebäude abgerissen, der Platz stand leer, als ob dort nie etwas gegeben hätte. Leider habe ich das natürlich nicht fotografiert. Und alle diese Häuser sind abgerissen worden. Und welche Bäume hat man dort gefällt. Aber man hat die neuen gepflanzt und ausgeweißt, alles ist sauber, die Straßen sind asphaltiert worden. Wo es keinen Asphalt gegeben hatte, hat man alles asphaltiert. Natürlich sind viele Häuser auf der Lenin-Straße abgerissen worden. Man wollte irgendwelche Schrebergartenhäuser bauen, jemand hatte solch eine Absicht. So ist es.
N.K.: Und haben Sie irgendwelche Beziehungen, ich weiß nicht, irgendwelche freundlichen Beziehungen, haben Sie noch irgendwelche Beziehungen zu den Menschen, mit denen Sie in Tschernobyl gelebt haben?
L.B.: Na, sicherlich! Umso mehr bin ich solch ein Mensch, der sich über jeden Menschen freut. Wenn man einen trifft, umarmt… (fängt an zu weinen) küsst, bloß…
N.K.: Sich an einen erinnert?
L.B.: Ja, ja, alles ist etwa so. Trotz des Amtes. Ich habe das schon gesagt, und ich sage das noch einmal, und ich werde das vielmals sagen, dass wenn man ankommt, geht man meistens zuerst zum Friedhof. Der Friedhof ist der Ort des Kummers. Und dann freuen wir uns, umarmen uns, küssen uns, sagen zueinander: „Oh, endlich haben wir uns getroffen! Oh, ihr seid noch am Leben! Ihr seid noch am Leben!“ Ärzte, Direktoren, Ingenieure…
N.K.: Also, Sie treffen sich unmittelbar in Tschernobyl?
L.B.: Ja, wir treffen uns. Wir haben Bekannte überall. Hier gibt es wenige, umso mehr haben wir die Wohnung hier sehr spät bekommen. Diejenigen, die sie früher gekriegt haben, viele von unseren Landsleuten wohnen jetzt zusammen. Und bei uns, wir sind erst im Dezember 1986 hierher gekommen. Und im Haus, wo wir gewohnt haben, war überhaupt niemand. So ist es. Ich weiß nicht einmal, wer von unseren Bekannten hier lebt.
N.K.: Also, Ihre Begegnungen finden meistens in Tschernobyl statt, oder?
L.B.: Ja, meistens.
N.K.: Unmittelbar dort?
L.B.: Unmittelbar dort. Und ich will sagen, dass als das passierte, wir alle… Na, es gab die Havarie, wir alle – na, ich sage jetzt ein nicht sehr schönes Wort – trieben wir uns auf Chreschtschatyk (Hauptstraße in Kiew) herum. Man geht Kreschtschatik entlang, begegnet seinen Bekannten auf jedem Schritt, weil niemand arbeitet, es gibt keine echte Wohnung, und alle gingen und bummelten. Und man freute sich – Wie geht’s? Was habt ihr vor? Wo seid ihr? Und so weiter.
N.K.: Und wie ist es jetzt? Wie verlaufen die Treffen? Erinnern Sie meistens an die Ereignisse, nicht wahr?
L.B.: Ja, Erinnerungen und alles. Aber ich will sagen, dass man die Adressen, die Telefonnummern austauscht und einander gratuliert. Wenn wir nach Tschernobyl kommen, kommen wir zum Beispiel um neun, um halb zehn, um zehn Uhr morgens. Und um fünf Uhr müssen alle die Stadt verlassen. Und wenn wir einander sehen – wir haben einander schon lange nicht mehr gesehen – man kommt bloß, sagt hallo – und dann steht schon eine Schlange. Jeder wartet darauf, mit allen wenigstens ein Weilchen zu sprechen und ein paar Wörter zu sagen.
N.K.: Zu sagen.
L.B.: Zu sagen. Man kann keinen einzigen Schritt machen, weil alle bekannt sind. Man hat einander ja lange weder gesehen noch getroffen. Und auf jedem Schritt, auf jedem Schritt.
N.K.: Und alle erinnern sich an einander immer noch?
L.B.: Ja. Und man sagt: „Oh! Man kann dich nicht erkennen!“ Alle kann man erkennen, wenn man will. Na, sicherlich hat man sich verändert, ich habe Ihnen die Fotos gezeigt – kann man doch erkennen? Man kann doch erkennen. Man hat sich nicht so sehr verändert. Wenn man sehr krank ist und sich sehr verändert hat, ist das eine andere Sache. Man sitzt auf dem Friedhof, man bring etwas zu essen und zu trinken mit, man hat etwas zubereitet und Osterkuchen gebacken, Eier bemalt, und man legt das alles auf die Gräber. Und man sitzt an diesen Tischen, auf den Bänken. Und jeder ruft einen zu sich – „Komm mal her!“, man kommt, „Oh! Ljudmila, hallo!“. Ich kann das nicht beschreiben.
N.K.: Na, gut, dass Sie das nicht vergessen…
L.B.: Das ist auf dem Friedhof, stellen Sie sich vor. Wie kann man das vergessen? Das ist doch alles. Wir sind hierhergekommen, ich sage das noch einmal: Was hat man uns weggenommen? Man hat uns Kommunikation, Verwandte, Bekannte, Freunde – alles weggenommen. Hier ist alles fremd. Sogar die Kinder sagen: „Hier gibt es niemanden zu begrüßen.“ Man wohn in demselben Treppenhaus und kennt einander nicht einmal. Und woran haben wir uns gewöhnt? Na, natürlich lebten dort verschiedene Menschen.
N.K.: Und die Menschen, die dort jetzt leben?
L.B.: Ja?
N.L.: Haben Sie sie gesehen?
L.B.: Ja und ich war zu Besuch…
N.K.: … und sie haben die Fotos gezeigt?
L.B.: Jaja.
N.K.: Was denken Sie, wie ist ihr Alltag organisiert? Wie nehmen sie ihr Leben wahr?
L.B.: Sie leben so, wie sie gelebt haben.
N.K.: Ja?
L.B.: Ja. Sie pflanzen ihre Gemüsegärten, bauen dort Erdbeeren, Kartoffeln an, Blumen und alles, wie es sich gehört. Manche arbeiten dort. Jemand als Reinigungskraft. Kowalenko hat auf der Post gearbeitet, er arbeitet nicht mehr seit zwei Jahren. Manche arbeiten überhaupt nicht, aber das sind meistens Rentner. Es gibt diese berufstätige Generation gibt es da nicht, ich meine, nach dem Alter. Denn es gibt keine Arbeit dort. Es ist schwierig jetzt, dort eine Stelle zu finden, weil jeder sich, verzeihen Sie bitte meine Ausdrucksweise, drängelt. Alle drängeln sich, um eine Stelle zu bekommen, man bezahlt doch gut. Also, man kann sagen, auf solche Weise. Ja, ich höre Ihnen weiter zu.
N.K.: Danke schön!
L.B.: Bitte schön. Was noch?
N.K.: Na, im Prinzip hat man schon alles erzählt.
L.B.: Na gut. Gucken Sie dorthin noch mal.
N.K.: Ah, ich habe wirklich etwas vergessen. Wie reagieren Ihre Verwandte darauf, dass Sie… Sie haben gesagt, dass Sie ab und zu nach Tschernobyl fahren, wie? Weil verschiedene Menschen anders darauf reagieren. Viele haben Angst, dass es gefährlich ist, dort zu sein, viele sagen, dass es nichts zu befürchten gibt, man kann schon kommen. Was meinen Sie darüber? Haben Sie Angst oder nicht?
L.B.: Nein. Ich habe weder solche Fragen noch Gedanken! Mein Gott! Wenn es jetzt dort ein bisschen sauberer wäre, es gibt noch…
N.K.: Strahlung.
L.B.: Es gibt noch Strahlung. Manchmal spürt man das, wenn wir dorthin fahren… Wenn ich „wir“ sage, meine ich meine Landleute, Tschernobyljane. Niemand denkt daran. Dorthin zu fahren, einander zu sehen, sich an etwas zu erinnern… Wenn man dort ist… Mein persönlicher Eindruck ist: Wenn ich in Tschernobyl bin, dort bummle, bekannte Gesichter sehe, scheint es mir, dass das alles nicht passiert ist, kein Charkow, kein… Als ob ich in ein virtuelles Leben eintauche. Ich tauche in das Leben, in meine Stadt ein, überall sind meine Bekannten, meine Freunde, verwandte Gesichter. Manche kann ich zwar nicht erkennen, wenn sie auf mich zukommen. Ich schäme mich nicht zu sagen: „Ich bitte Sie um Entschuldigung, ich habe Sie nicht erkannt, wer sind Sie?“ So was.
N.K.: Na ja.
L.B.: Ich stelle Fragen. Dann schaltet sich mein „Computer“ ein, die Erinnerungen kommen zurück.
N.K.: Ja, wer das sein kann.
L.B.: Ja, ja, ja; alles, alles, alles.
N.K.: Haben Ihre Verwandten keine Angst, Sie dorthin fahren zu lassen?
L.B.: Nein. Zuerst war meine Tochter dagegen und sehr lange bin dorthin nicht gefahren. Sie sagte: „Mutti, was machst du!“ Sie macht sich Sorgen um meine Gesundheit, um alles. Und dann wurde sie älter und sagte… Einmal ist sie mit mir zwei oder dreimal gefahren.
N.K.: Besprechen Sie das in Ihrer Familie?
L.B.: Natürlich. Na, in der Familie. Na, wer ist in der Familie? Ich, mein Sohn, meine Tochter. Nicht mehr… Wenn ich zu meiner Mutter nach Odessa komme, sitzen wir, das Frühstück beginnt um zehn, um halb elf steht meine Mutter auf, und wir sitzen, sitzen, wir können bis vier Uhr mittags sitzen und wir sprechen, besprechen alles und können uns nicht ausquatschen.
N.K.: Und hat Ihre Mutter keine Angst, Sie fahren zu lassen?
L.B.: Nein. Die Mutter ist auch einmal gefahren.
N.K.: Ja?
L.B.: Ja. Und der Vater fuhr dorthin, als er noch am Leben war. Er ist ein paar Mal gefahren. Aber sie ist schon im Alter, sie verlässt das Haus nicht mehr. Und wir, mein Gott, wie viele Erinnerungen haben wir! Und wie viele Glückwunschkarten schreibt sie! Sie kriegt ihre Rente und kauft sie für 80 Hrywnja!
N.K.: Ich habe verstanden, sie sponsert die Produktion von Glückwunschkarten.
L.B.: Ja, sie sponsert, sie schreibt sie an alle. Man sagt, es ist leichter zu telefonieren. Aber sie kann nicht. Sie sagt: „Ich kann nicht sagen, was ich schreiben will.“
N.K.: Na ja, es ist leichter zu schreiben.
L.B.: Ja, es ist leichter zu schreiben. Sie hat so viele Glückwünsche, so viel von allem. Ich mag auch, wenn ich einem gratuliere, ich gratuliere immer, ich lerne etwas auswendig. Ich lerne etwas auswendig, dann gratuliere ich.
N.K.: Und woran erinnern Sie sich am häufigsten? An die Havarie oder?
L.B.: Nein, einfach ans Leben. Einfach ans Leben – wie wir lebten und wie gut es uns ging, wie lustig, welche Pilze und Beeren wir sammelten, wie wir mit Übernachtung fischen gingen und Fischsuppe kochten, welche Partys wir hatten, diese Luft, dieses Geruch, dieses Geruch der Fischsuppe am Feuer. Manchmal konnten wir nichts außer einem kleinen Fisch fangen. Dann bereiteten wir Kartoffeln mit Speck zu. Wir brieten Speck, kochten es mit Kartoffeln, mit Gurken und Tomaten, lecker…
N.K.: Schön.
L.B.: Ich habe mich an einen der Glückwünsche meiner Mutter erinnert… Ich will auch Ihnen wünschen. Möge die Sonne Ihnen immer scheinen, und möge Ihr Leben bis hundert Jahre dauern, mögen weder Krankheit noch Alter an Ihre Türe hauen!
N.K.: Danke schön! Na, es wäre vielleicht alles.