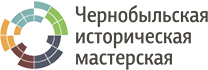Sergej
Sergej
- liquidator
Birth date:
Place of Birth:
Place of residence:
Professional activity:
Time spent in the Chernobyl Zone:
Activities at the Chernobyl Zone:
Natalija Koslowa (nachstehend N.K.): Also, heute ist es der 6. Oktober 2014, wir sind im Raum des Verbands Tschernobyl und ich, Natalija Koslowa, führe ein Interview mit…
Sergej Zhygulskich (nachstehend S.Zh.): Sergej Michailowitsch Zhygulskich.
N.K.: Sehr angenehm. Und meine erste Frage an Sie ist ziemlich umfangreich, das ist eigentlich eine Bitte, dass Sie über Ihr Leben erzählen. Alles, was Sie wichtig finden, von Anfang an.
S.Zh.: Ich wurde in Luhansk geboren. Dort bin ich aufgewachsen, habe den Schulabschluss gemacht, nach der Schule in einem Pionierlager als Harmonikaspieler gearbeitet und in einer Fabrik als Schlosser. Danach folgte mein Militärdienst, zwei Jahre lang war ich bei der Armee. Dann beschloss ich, Offizier zu werden, habe mich an der Militärpolitischen Hochschule Lwiw eingeschrieben und absolvierte sie 1981. Danach habe ich Kriegsdienst in Transbaikalien, in der Ukraine, im Kaukasus und wieder in der Ukraine geleistet. Und im Jahr 1988 hat man mich aus dem Dnipropetrowsker Gebiet dienstlich für vier, naja, für zwei Monate nach Tschernobyl gesendet, als, als… zu jener Zeit war ich schon Kapitän, Instruktor einer politischen Abteilung bei der Operativgruppe der Zivilverteidigung der UdSSR. Ich sollte zwei Monate in Tschernobyl bleiben, aber niemand kam, um an meine Stelle zu treten, und ich bin für die zweite Schicht geblieben. Na also.
In erster Linie bestand meine Aufgabe darin, die Mannschaft und alle, die sich innerhalb und außerhalb der Zone befanden, mit technischen Propagandamitteln zu versorgen. Naja, auch alle mit Fernsehen und Rundfunk zu versorgen, so dass es Fernseher in allen Kasernen gab, für die Postzustellung zu sorgen. Das heißt, mit allen Medien, die die Menschen dort erreichen sollten. Das sind Hauptaufgaben, die ich als Instruktor für Kulturarbeit erfüllen sollte. Das war meine Fachrichtung. Solche Funktionen erfüllen normalerweise Oberleutnants, ich aber war damals Kapitän.
Nach Tschernobyl habe ich wieder in Dnipropetrowsk Wehrdienst geleistet, dann bin ich nach Luhansk, meine Heimatstadt, umgezogen. Es hat sich so gefügt, dass ich in meiner Heimatstadt schon als Oberoffizier in einer motorisierter Schützerdivision der Fla-Raketenkräfte Wehrdienst geleistet habe.
N.K.: Aha...
S.Zh.: Naja, und im Jahre 197… (ein Telefon klingelt). 197… In welchem Jahr war es denn? 1997 wurde ich aus dem Militärdienst entlassen. Zu dieser Zeit waren die Streitkräfte schon fast zerstört. Naja, und außerdem habe ich die Staatliche Universität Odessa absolviert, Fakultät für Psychologie. Im Fernstudium, für bessere Aufstiegschancen. Jetzt bin ich Oberst außer Dienst, und es hat sich so ergeben, dass ich seit Tschernobyl angefangen habe, Gedichte und Lieder zu schreiben.
N.K.: Aha.
S.Zh.: Ich bin zu einem, sozusagen, Barden geworden. Also, und all das ist darauf hinausgelaufen, dass ich jetzt schon die vierten Gedichtsammlung für die Veröffentlichung vorbereite, so etwa 360 bis 400 Seiten. Ein Teil meines Schaffens ist Tschernobyl gewidmet. Ich weiß nicht, was daraus wird, jetzt aber habe ich schon das zehnte Lied geschrieben. Wir wollen eine CD aufnehmen und haben schon circa 20 Lieder zum Thema Tschernobyl arrangiert. In Luhansk habe ich oft im Fernsehen oder im Radio eine Rede gehalten. Einmal habe ich Liquidatoren aus Luhansk getroffen, und sie haben mich sofort gebeten, dass ich mich am öffentlichen Leben aktiv beteilige. Dass war schon in meinem Zivilleben, in den 2000er Jahren oder so. Und so bin ich Vertreter des Vorsitzenden des Verbands Tschernobyl im Luhansker Gebiet geworden. In diesem Amt arbeite ich schon drei Jahre, und vorher habe ich im städtischen Verband Tschernobyl seit 2006 gearbeitet. So bin ich zur die Tschernobyl-Bewegung gekommen. Was wir dort machen, ist ja klar. Was kann ich noch über mich erzählen? Ich träume davon, Mitglied des Schriftstellerverbandes der Ukraine zu werden, nicht nur Lieder über Tschernobyl, sondern auch meine Lyrik, zivile Poesie zu veröffentlichen. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem kreativen Schaffen. Im Verband Tschernobyl haben wir ein zweibändiges Buch über Liquidatoren aus Luhansk veröffentlicht. Es heißt “Tschernobyl. Das Buch einer Heldentat”. Das sind ungefähr 500 Seiten in solchem Format.
N.K.: А4?
S.ZH.: Ja, А4, und letztes Jahr haben wir ein regionales Buch mit 360 Seiten in diesem Format veröffentlicht, ja, über die Heldentat der Liquidatoren aus dem Luhansker Gebiet. Das ist womit ich mich beschäftige, im Großen und Ganzen. Sagen wir, es ist im Leben so gekommen, dass ich die Tschernobyl-Bewegung durch Bücher und als Dichter, Barde bekannt mache. Ich versuche immer, die Leser und die Zuhörer darauf zu bringen, dass wir dort nicht umsonst waren.
N.K.: Das ist wunderschön. Und… Habe ich Sie unterbrochen?
S.Zh.: Von mir aus.
N.K.: Ich wollte Sie fragen, Sie haben ja gesagt, dass Ihre Aufgaben darin bestanden, die Mannschaft mit den Medien zu versorgen, oder? Kann man das so sagen?
S.Zh.: Ja, genau.
N.K.: Und wie verlief das alles eigentlich, ich meine, die Versorgung?
S.Zh.: Naja, die Streitkräfte waren damals, sagen wir, ein wohlfunktionierender Mechanismus, in dem alles von Anfang an vorbestimmt wurde. Das heißt, in jedem Bezirk gab es eine Abteilung für technische Propagandamittel, die mit allem Nötigen versorgt wurde, was es in jedem Truppenteil geben sollte, von einem Bataillon, über eine Kolonie bis zum Regiment. Das waren Radiogeräte, Gitarren, Harmonikas, Lack- und Farbstoffe, Zeitungen funktionierten, in jedem Bezirk gab es eine Zeitung. Und dazu gab es ein obligatorisches Kino in jedem Regiment, in jedem Truppenteil, sogar in den Bataillonen gab es Klubs. Klubs also.
N.K.: Und in Tschernobyl war es auch so, oder?
S.Zh.: Ja, in Tschernobyl wurden auch Klubs gebaut. Und in der Division, sagen wir, nein, nicht in der Division, da gab es Brigaden. Also in jeder Brigade gab es einen Klub. Zuerst gab es dort Sommerplätze. Wir brachten dorthin stationäre Filmgeräte und via Kyjiw, wo es einen eigenen Filmfundus gab, aus dem wir Filme nach Tschernobyl brachten. Denn man kann ja jemanden nicht in solch schwierigen Verhältnisse bringen und ihn dann zwingen auf alles zu verzichten. Es dient für einen Menschen als Ausgleich. Die Soldaten kamen und schauten sich Filme an. Während es in den Streitkräften nur zweimal pro Woche erlaubt wurde, Filme zu zeigen — am Samstag und Sonntag — so durften wir es hier jeden Tag machen. Ich war kein Klubleiter mehr, aber in Tschernobyl hatten wir, naja, Dienstpersonal, das waren Kantinen, wo die Offiziere aßen, dann Fahrer. Der Stab sollte versorgt werden und einige Soldaten, die einen Teil der Streitkräfte bedienen mussten, sie arbeiteten in Tschernobyl in unserem Stab, aber waren nicht fest angestellt. Wir brachten sie aus den Brigaden nach Tschernobyl, versorgten sie mit einer Unterkunft, Filmen, ich war auch dort tätig. Die Räume sollten als Klubs eingerichtet werden, und in diesen Klubs haben wir jeden Tag Filme gespielt. Wir haben Plakate gemalt, alles, um… Sagen wir, alle technischen Propagandamittel, Informationen, das habe ich auf meine Schulter genommen. Außerdem musste ich, natürlich, viele andere Aufgaben erfüllen...
N.K.: Welche, zum Beispiel?
S.Zh.: Ach, mein Gott. Na, einmal kam es so, dass man herausgefand, dass ich mich mit dem Fotografieren beschäftigte, nicht übel fotografierte… In meinem Beruf musste ich ja fotografieren können. Naja. Ich war vielleicht einer der wenigen Menschen, denen es erlaubt wurde, einen Fotoapparat zu haben.
N.K.: Aha.
S.Zh.: Naja. Deshalb sagten alle, die mich sahen: “Mach bitte ein Foto von mir”. Man konnte ja nicht alles fotografieren. Ich habe aber Bilder gemacht, obwohl es verboten war, ja, und alles unter der Hand vergeschenkt. Es wurde bemerkt und dann hat mich der Gruppenbefehlshaber, der Generalleutnant, zu sich beordert und gesagt, eine große Kommission komme, und dass ich ein Fotoalbum machen solle, das darstellen könnte, womit wir uns da beschäftigten. Ja, ich fuhr zu den Grabanlagen, fotografierte das alles, fuhr zur Station. Man hat mir sogar einen Hubschrauber zugeteilt…
N.K.: Wow!
S.Zh.: ...so dass ich das aus der Luft fotografieren könnte. Naja. Außerdem wurde damals statt Prypjat Slawutytsch errichtet. Dort gab es freiwillige Arbeitseinsätze, ich fuhr dahin und fotografierte Slawutytsch von oben. Ich meine, ich machte Bilder, ja, es schickt sich nicht, davon zu erzählen, aber es gab dort viel Plünderung damals und ich versuchte, sie abzulichten. Also beides, Positives und Negatives. Ja. Und von Prypjat habe ich sehr viel gefilmt. Weil es eine Geisterstadt ist, man geht durch die Stadt und hört das Rascheln eigener Schritte. Alles ist leer, alles steht still, ein leichter Wind weht, und alles quietscht. Mein Gott, hier haben Menschen gelebt, und das leise Entsetzen ergreift einen. Drei Tage lang machte ich ein Album, die Bilder reichten für zwölf Alben. Eines habe ich für mich selbst gemacht, mitgebracht, gezeigt. Der Oberste sagte: „Wunderschön. Wir schenken es der Kommission aus Moskau. Ja, mach noch eins.” Ich sagte: “Entschuldigung, aber dafür muss ich noch drei Tage wach zu bleiben, um das alles ausdrucken, weil…” Naja, ich habe für mich selbst unter der Hand das dreizehnte, als Erinnerung, gemacht. Ja, und als mir befohlen wurde, noch eins zu machen, dachte ich, wieso soll ich noch drei Tage wach bleiben, habe ihnen meins gegeben und und habe einen Hass gegen die Fotografie entwickelt. Also, so hat es sich gefügt… Außerdem, naja, ich weiß nicht, womit...
N.K.: Und sagen Sie bitte… aha.
S.Zh.: Wir sind gefahren, unsere Operativgruppe, die größte administrative Formation in der ganzen Zone. Dort gab es einen weißrussischen Sektor mit einer Operativgruppe, einen ukrainischen mit einer Operativgruppe und uns, die Operativgruppe der Zivilverteidigung der UdSSR. Das heißt, die leitende Gruppe. Wir hatten zwei Kapitäne in der Gruppe, die anderen waren alles von Majoren bis Generalleutnants. Das heißt, die Menschen die sich, sagen wir, mit der Organisation der Arbeit an der Station, in den Dörfern, mit den Dachreparaturen beschäftigten. Ich war beim Vergraben der Dörfer. Ich kann mich bis heute an diese Bilder erinnern. Es war einfach schrecklich mitanzusehen. Ich habe gesehen, naja, bin mit Strahlenschutzmesstechnikern gefahren, mit Patrouillengängen, und habe geprüft, ob “der rote Wald” richtig vergraben wird. Wie die ganzen Dörfer begraben werden, aber an alles kann man sich jetzt nicht erinnern. Es gab wirklich viele Informationen. Naja. Einerseits, fragt man mich: “Bedauerst du, in Tschernobyl gewesen zu sein?” Dabei habe ich mich gerade in Tschernobyl als Persönlichkeit entdeckt, ich habe angefangen, Gedichte und Lieder zu schreiben. Also…
N.K.: Aber es hat doch Ihr Leben irgendwie beeinflusst?
S.Zh.: Ja, nach vier Monaten bin ich nach Hause zurückgekommen und diejenigen, die mich kannten, auch die Nächsten, auch meine Frau sagte: “Du bist ein neuer Mensch geworden”. Das heißt, wenn ich früher etwas einfach akzeptieren konnte, ohne zu reagieren, bin ich nach Tschernobyl gekommen, und falls etwas falsch gelaufen ist, habe ich sofort reagiert. Ich, also, ich sagte: „Das ist ja falsch”.
N.K.: Sie sind sensibler geworden, oder?
S.Zh.: Ich bin verantwortungsbewusster geworden, als ob ich innerhalb von diesen vier Monaten ein riesiges Leben von etwa zehn Jahren gelebt hätte. Ich meine, das ist so ein Kapital, so eine Lebenserfahrung, dass ich sofort weiser geworden bin, sofort. Ich war dreißig, älter als zweiunddreißig, als ich dorthin geraten bin, oder? Und ich begann, das Leben anders zu betrachten. Ich wurde einerseits harter, andererseits herzenswärmer zu Menschen. Weil es in Tschernobyl wie im Krieg ist. Man kann sehr schnell erkennen, ob der Mensch gut oder schlecht ist: zwei bis drei Tage, höchstens eine Woche. Wer ein übler Kerl ist, sagen wir, dann kann man es sofort spüren, und dann, nach einer gewissen Zeit, versteht man: Mit diesem kann ich Pferde stehlen, mit jenem lieber nicht.
N.K.: Wie hat es sich erkennen lassen? Haben sie sich anders benommen?
S.Zh.: Man braucht nichts, weil alle verstehen, dass es Orte gibt, wo man so eine Strahlendosis bekommt, dass es einem noch in der Zukunft zurückfällt. Und man sollte das niemandem erzählen, alle haben das verstanden. Manchmal mussten die Leute in Uniform den Anderen Aufgaben befehlen, die mit einem Verlust drohen, mit dem Verlust der Gesundheit in dise Fall. Die Strahlung hat ja keine Farbe, keinen Geruch, nur einen Beigeschmack. Es gibt Rezeptoren auf der Zunge, und wer empfindlich ist, kann einen bleiernen Beigeschmack spüren. Ansonsten kann man nichts sehen, nichts hören. Deshalb scheint es nicht so schrecklich zu sein, aber andererseits bin ich durch verlassene Dörfer gefahren… die Fenster sind kreuzweise eingeschlagen. Wenn man das alles mit seinen eigenen Augen sieht, stutzt man. Das Unbewusstsein sagt uns, hier haben Menschen gelebt, sie kehren nimmer zurück, sie haben ihre kleine Heimat verloren. Nicht einmal zum Friedhof kommen sie, oder zur Trauerfeier… am 9. Mai durften sie das, ja. Manchmal konnten sie ihre Gräber nicht finden. Sie durften, sagen wir, 30 Minuten diese Gräber besuchen, zumindest zur Trauerfeier. Und stellen Sie sich vor: Ein Sohn kommt zu seiner Mama, zu seinem Papa, und kann das Grab aus einem einzigen Grund nicht finden. Ich kenne diesen Grund, und er kennt ihn nicht, dieser Mensch, denn der Friedhof wurde ja nicht abgerissen. Das ganze Dorf konnte abgerissen werden, aber nicht der Friedhof. Naja, und auf dem Friedhof war der Boden kontaminiert und wurde dann erneuert. Also haben wir unwillkürlich das Gelände verändert, die Bäume ausgepflanzt. Und der Mensch kommt, er scheint den Ort zu kennen, kann aber dort sowieso das Grab, also seine Mama und seinen Papa, nicht finden.
N.K.: Weil es schon keins mehr gibt?
S.Zh.: Das Grab ist wo es war, aber der Boden… Wissen Sie, dort gab es Bäume, eine Bank und noch so was. Der Boden wurde auf diesem Platz erneuert. Das Grab selbst ist an seiner Stelle. Ja, da hatten wir es, deshalb mussten wir manchmal zeigen, wo es ungefähr sein sollte. Suchen wir, das Grab ist hier. Das heißt, solche Dinge gab es, die man nicht beschreiben kann. Das Gefühl lässt sich kaum ausdrücken, wenn man sieht, wie die Erde stirbt, und versteht: Der Mensch ist daran schuldig, leider.
N.K.: Von wann bis wann sind Sie dort gewesen?
S.Zh.: Vom 9. April bis zum 30. August 1988. Das heißt, 4 Monate minus 9 Tage. Wäre ich10 Tage früher dorthin geraten, nicht am 1., sondern, sagen wir, am 31. März, 30. März, hätte ich einen etwas anderen Status. Das heißt, ich wäre Liquidator der zweiten Kategorie, und dann… Es gibt einen Unterschied. Aber ich muss Ihnen sagen, im Jahre 1988, obwohl der Sarkophag schon errichtet worden war, gab es derartige Orte, die… Ein Freund von mir, über den ich einen Artikel geschrieben habe, war schon 1989 dort gewesen. Ihn habe ich in einem Krankenhaus kennengelernt, in einem Lazarett, wir sind Freunde geworden, und jetzt lebt er nicht mehr. Und als er mir gesagt hat… Ich frage: “Was warst du da?” Er sagt: “Ich war Bohrer.” Ich sage: „Was soll das heißen, was hast du denn da gebohrt? Wasser gefördert?” – “Nein. Ich habe kreuz und quer in den Sarkophag gebohrt, um das, was da drinnen geblieben ist, herauszuziehen und diese strahlende Masse, die für den Menschen sehr gefährlich ist, in einen speziellen Behälter zu laden, so dass die Wissenschaftler beobachten könnten, was im Sarkophag geschieht.
N.K.: Aha.
S.Zh.: So. Ich sage: „Na, und dann?” Ja, und jetzt ist dieser Mann schon seit zwei Jahren nicht mehr am Leben. Obwohl er 1989 dort war, und 1990 hat man die Truppen abgezogen und nur die Zivilbevölkerung war mit der Schadensbehebung beschäftigt. Das heißt, ich hatte ein Recht darauf, nach der Zeit der Ableistung, nach diesen zwei Monaten, ersetzt zu werden. Und nicht mehr als fünf Röntgen. Ich lebte direkt in Tschernobyl, fast im Stadtzentrum, 18 Kilometer vom Werk entfernt. Wir fuhren dorthin, bis zum Werk, bis Prypjat. Man konnte fünf Röntgen abgekriegt, ohne irgendwohin zu fahren. Und die Militärs haben mir gesagt: „Du hast nichts abbekommen, leiste weiter deinen Dienst.“ Und ich fuhr nach Prypjat. Es hat sich so gefügt, dass ich alleine war, ohne Dosimetristen, und habe auf einmal zwei Röntgen abgekriegt. Ja, zwei Röntgen und fünf Röntgen für die ganze Frist habe ich abgekriegt. Dann habe ich prinzipiell das Dosismessgerät ausgeworfen und hörte auf, das Strahlungsniveau abzulesen, denn die Situation war nicht immer so, dass man den Befehlen folgen konnte.
N.K.: Aha.
S.Zh.: Naja, so ist das Leben.
N.K.: Klar. Und wie konnten Sie verstehen, wohin man gehen darf und wohin nicht? Haben die Menschen das prinzipiell gewusst?
S.Zh.: In der Regel, bevor man einen irgendwohin entsendete, wurden spezielle Dosimetristenformationen aufgestellt, Dosimetristen-Erkunder. Sie gingen in die Gegend bzw. die Stellen, wo etwas gemacht werden sollte, Wände, Böden – alles haben sie auf das Strahlungsniveau geprüft, dann folgte eine Zeitberechnung, d. h. wie lange man sich an dieser Stelle aufhalten könne. Ja, sie haben eine Karte zusammengestellt und gesagt: Hier so lange, dort so lange. Deshalb arbeiteten wir mal zehn Minuten, mal fünf.
N.K.: Also das hing von der Gegend ab, wie lange man arbeiten durfte, oder?
S.Zh.: Das hing davon ab, wieviel Strahlung diese konkrete Stelle abgekriegt hatte. Denn die Strahlung, erstens, ich habe mit den Wissenschaftlern gesprochen, sie kann sich sogar bewegen. Der Wind weht, hier gab es Sand, mit dem Staub wird dieses Niveau dorthin, wo es niedriger ist, übertragen. Also...
N.K.: Also ist es unklar, was man tun sollte?
S.Zh.: Genau. Deshalb – ohne vorhergehende Erkundung, ohne Dosimeterkontrolle durfte man eigentlich nicht herumstreifen. Und dazu konnte man auch nicht so leicht in die Zone gelangen. Jeder hatte seinen Ausweis mit dem Stempel und Kennzeichnungen, wenn man zum Beispiel nur zum Werk musste. Ich hatte einige Kennzeichnungen und den Ausweis für alle Objekte, ich durfte überall fahren. Und, eigentlich, um den Reaktor herum hat man auch gearbeitet, auch neben dem vierten, dem zerstörten Reaktor, und dort gab es Arbeitsstellen auf dem Dach des Sarkophags. Den Sarkophag haben Ingenieure 1988 vor meinen eigenen Augen gebaut. Das heißt, wir haben mitgewirkt, mit der Zivilbevölkerung mitgearbeitet. Naja, nicht mit der Bevölkerung selbst, sondern mit den Leuten, die nach dem Rotationsprinzip gearbeitet haben: 15 Tage in der Zone, 15 Tage außerhalb. Dann nach 15 Tagen tauschten sie sie noch mal aus und so haben einige ein, zwei Jahre in Tschernobyl gearbeitet. Sie haben einen Vertrag unterzeichnet. Und die Militärs, natürlich, haben keinen Vertrag unterzeichnet. Es gab den Befehl, in die Zone zu kommen, und man ist dem Befehl gefolgt.
N.K.: Aha. Und als Sie dorthin entsendet wurden, wie lief das? Hat man Ihnen gesagt, wohin, was, wie?
S.Zh.: Naja...
N.K.: Wie lief das ab?
S.Zh.: Das ist bei jedem unterschiedlich. In diesem Fall war ich war einzigartig, ich leistete Dienst in einer Division im Dnipropetrowsker Gebiet, in der städtischen Siedlung Gwardejsk. Ich wohnte in einer Mietwohnung. Der Besitzer leistete damals seinen Dienst auf Kuba, und dem Gesetz nach mietete ich ein Zimmer, das zweite war geschlossen. Also hatte ich keine eigene Unterkunft. Und dann schickt er mir einen Brief, ich müsse innerhalb von 15 Tagen aus der Wohnung ausziehen. Ja, so einen Brief habe ich erhalten. Damals war ich schon Familienvater von zwei Kindern. Ich bin zum Leiter der politischen Abteilung der Division gegangen und habe gesagt: „Ich habe das Umziehen satt. Erledigen Sie bitte dieses Problem.” Er sagt: „Gut. Herr Kapitän, haben Sie einen Block und einen Schreiber?” Aber natürlich hat jeder Offizier einen Block und einen Schreiber. „Schreiben sie auf: Befehl soundso, heute nach Tschernobyl abzureisen”. Ich sage: “Aber…” Er: „Heute nach Tschernobyl abzureisen.”
N.K.: Und die Familie ist in dieser Wohnung geblieben? Und der Besitzer ist aus Kuba zurückgekehrt...
S.Zh.: Ja, was konnte man tun? (lächelt) Er sagt: „Reisen sie ab!” Ich rufe dann meine Frau an und sage: „Was denn?” Sie sagt: „Na ja, jetzt kommt er, suchen wir noch nach etwas.” Ich sage: “Na gut.” Und dann bin ich zum Kommandeur der Operativgruppe gegangen und habe gesagt: Folgende Situation: Ich bin hier, meine Familie dort, und wenn ich auch dort wäre, könnte ich etwas tun. Meine Frau mit den zwei Kindern ist dort geblieben, die Kinder sind gerade erst in die Schule gegangen.” Naja, er nennt den Rufnamen der Division. Ruft an, fragt: „Dein Offizier?” „Ja.” “Ich lasse ihn jetzt für zwei Tage zurückkommen, aber nur für drei Tage. Er kommt und du gibst ihm eine Wohnung. Klar?” „Klar.” Man hat mir Reisepapiere gegeben, „Fahre mal.“ Ich komme in meine Mietwohnung, niemand ist da. Habe den Nachbarn gefragt, sie sagen: „Sie sind schon gestern umgezogen.” „Wohin?“ „Beim nächsten Hauseingang. Sie haben dort eine 2-Zimmer-Wohnung bekommen”.
N.K.: Also schon eine eigene.
S.Zh.: Ja, eine eigene Unterkunft. Also bin ich ruhig zurückgekommen.
N.K.: Haben Sie sich keine Sorgen gemacht?
S.Zh.: Aber doch. Wie es im Leben immer so ist.
N.K.: Und auf welche Weise sind Sie aus Tschernobyl zurückgekehrt? War das organisiert oder einfach selbstständig?
S.Zh.: Bei Militärs ist es eigentlich immer organisiert. Ich meine, es gibt Reisepapiere, Reisegeld, all das. Und das Personal, sehr viele wurden via Belaja Zerkow aufgefordert, dort stand, denk ich, nicht eine einzige Division im Quartier. Dort wurden sie in die Uniform gekleidet und dann organisiert mit den Bussen und Zügen nach Kiew gebracht, mit den Autos zur 25. Brigade, in der alle schon nach Fachrichtungen eingeteilt wurden, das ist aber schon eine andere Frage. Danach wurden für sie Reisepässe erstellt, sie kehrten nach Kiew zurück, nach Belaja Zerkow, wo sie ihre Zivilkleidung erhielten, diese verließen sie da, wieder Reisepässe und dann heimwärts. Wir nannten die Leute, die von daheim aufgefordert waren, „Partisanen”, aber das galt als eine Einberufung für die Nachschulung. Sie hatten ein durchschnittliches Einkommen plus nachträgliches Einkommen im Betrieb. Auch in Tschernobyl haben sie eine gewisse Summe erhalten. Also nichts wurde in der Armee umsonst gemacht.
N.K.: Aha.
S.Zh.: In der Armee läuft alles auf Befehl, ich meine, so war es. Es ist heute so, dass wir keine Armee haben und damals… Jedenfalls bin ich Leutnant geworden und wurde einfach respektiert, weil ich eine Uniform trug. Damals besaßen die Militärs Autorität in der Gesellschaft, weil diese Fachrichtung gefragt war. Die Mädchen kamen zu unserer Militärschule zum Tanzen, um einen Offizier kennenzulernen und ihn zu heiraten, weil sie wussten, dieser Mann hat immer Aufstiegschancen. So war es.
N.K.: Interessant. Und sagen Sie bitte, was denken Sie, warum hat es sich dann so gefügt, dass die Katastrophe möglich wurde? Viele denken, es gab eine große Eile, weil man einen Fünfjahresplan in einem Jahr erfüllen mussten, oder wegen der Nachlässigkeit. Was glauben Sie?
S.Zh.: Ich schreibe viel und habe sehr viele Interviews gemacht, nicht nur mit gewöhnlichen Soldaten, sondern auch mit Obersten, Generälen und Leuten, die verschiedene Aufgaben in der Tschernobyl-Zone erfüllten. Und ich hatte die Gelegenheit, mit einem Mann zu sprechen, der dazu noch einer Operativgruppe zur Zivilverteidigung der Republik gehörte. So hieß es früher, die Republik, und in Kiew gab es die Operativgruppe zur Zivilverteidigung. Nikolaj Nikolajewitsch Wlasow, im Jahr 1985 war er Oberstleutnant und ist zum Atomkraftwerk Tschernobyl zur Kontrollinspektion gefahren. Diese Kontrolle wurde nur in Moskau genehmigt. Das heißt, das war ein geheimes Objekt, das dazu noch für die Verteidigungsindustrie funktionierte. Das ist kein Geheimnis, dort wurde Plutonium produziert. Das heißt, das Atomkraftwerk ist so eingerichtet, dass es Plutonium produziert. Das ist ein Verteidigungsobjekt, völlig geheim, so einfach konnte man nicht dorthin geraten. Ja, das ist das Erste. Das Meldesystem wurde gut vorbereitet. Er sagt, 1985 hat alles funktioniert. Für jeden gab es ein Atemschutzgerät, für jeden Bewohner, für jeden Mitarbeiter des Werkes. Auch die Unterstände für die Bevölkerung waren vorbereitet und so weiter und so fort. Aber es gibt viele Theorien. Ich denke, eine davon ist in erster Linie unsere Kopflosigkeit. Alle wussten das, und im Ministerium für Atomenergie auch, dass der Tschernobyler Reaktor sowjetischer Bauart technische Lücken hatte. Und noch dazu wurde er aus dem Unterstellungsverhältnis vom Ministerium gelöst und einem anderen untergestellt. Jetzt kann ich mich daran nicht erinnern, welchem.
N.K.: Das ist nicht so wichtig.
S.Zh.: Aber untergtellt, ja. Und so wurde es klar, warum es geschehen war. Wegen der Nachlässigkeit und der Kopflosigkeit, das durfte man nicht tun, aber trotzdem. Es wurde bemerkt, dass wenn man den Reaktor abstellt, holt man sogenannte Kernelemente heraus, die eine Menge Reaktionsenergie entwickeln. Diese Kernelemente werden also herausgeholt und von der Reaktion abgestellt, welche Reaktion, thermonuklear oder nuklear, wissen wir nicht. Also, es wurde bemerkt, dass sich die Turbine, die man mit dem Dampf anfuhr, um die Energie für Betriebe herzustellen, auch nach der Abstellung, wenn wir schon keine Kernstoffe benutzen, durch dem Trägheitsgesetz umdrehte.
N.K.: Durch das Trägheitsgesetz.
S.Zh.: Ja, durch das Trägheitsgesetz, und die Energie wird vom Zähler abgezählt. Und man hat gezählt, wieviel Energie so abgezählt und nicht benutzt wurde, der Brennstoff ist teuer und die ökonomische Wirkung war groß. Und so ein Experiment mit Lücken wurde am Tschernobyler Atomkraftwerk durchgeführt. Es hätte auch am Smolensker Atomkraftwerk durchgeführt werden können, nicht am Tschernobyler. Aber der Direktor dort war ein charaktervoller Mann, er sagte: „Ich führe es nicht durch. Entlasst mich, wenn ihr wollt, aber das werde ich nicht tun.” Und bei uns hat man das Experiment durchgeführt. Ja, mit den Lücken und noch dazu… Aber was soll das jetzt? Die Lücke ist, wenn die Abschirmung abgestellt wird...
N.K.: Naja.
S.Zh.: Im Raum unter dem Reaktor befindet sich eine Diesel-Notstromanlage, die, sobald etwas falsch läuft, sich sofort einschaltet und das Werk automatisch mit Energie versorgt. Diese Diesel-Notstromanlage gab es dort auch, und im Fall der Havarie, wenn der Havarieschutz nicht abgestellt wird, funktioniert es sowieso. Aber als diese Kernelemente herausgezogen wurden, entstand eine Überhitzung im Kühlsystem. Und um das Experiment durchzuführen, hat man die Notstromanlage abgestellt.
N.K.: Ach, ja. Diese Geschichte.
S.Zh.: Um die Anlage einzuschalten, braucht man 20 Sekunden. Die Erhitzung des Reaktors und die Wärmeexplosion geschahen innerhalb von acht Sekunden. Und...
N.K.: Also es war ein Versehen.
S.Zh.: Ich glaube, das sind Lücken. Man wusste doch, dass der Reaktor nicht fertig war und man durfte solche Experimente nicht durchführen. Aber aus irgendeinem Grund war das Werk nicht mehr dem Ministerium unterstellt. Das alles zusammen mit der Nachlässigkeit hat zur Katastrophe geführt. Das denke ich, denn man darf solche Experimente nicht durchführen. Das ist einfach dumm.
N.K.: Ja. Und was meinen Sie, haben die Leute eine Lehre daraus gezogen oder?
S.Zh.: (seufzt) Och…
N.K.: Eine schwierige Frage, nicht wahr?
S.Zh.: Ich fürchte nicht. Man kann natürlich die Ereignisse im Donbass mit der Havarie in Tschernobyl nicht vergleichen, aber hätten die Leute eine Lehre daraus gezogen… Alle kennen das Sprichwort: Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Wenn du eine feindliche Armee nicht nähren willst, nähre deine eigene.
N.K.: Ja.
S.Zh.: Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten wir eine der mächtigsten Armeen mit Atomwaffen und 1,5 Millionen Menschen.
N.K.: Na klar.
S.Zh.: Und unser Land ist so stark abgerüstet worden, so dass wenn auch nur meine einzige Division in Luhansk geblieben wäre, würde das jetzt nicht passieren. Wer hat abgerüstet? Hat man eine Lehre daraus gezogen?
N.K.: Ja, ich verstehe. Nichts hat man daraus gelernt..
S.Zh.: Ich denke, dass diese Lehre… Es ist bitter, denn ich war Liquidator. Unter uns gab es so viele Freiwillige, die Meldungen schrieben, von den Betrieben kamen. Das war die damalige Erziehung. Wir waren Patrioten unseres Landes. Ein Unglück ist passiert – wer kann helfen, wenn nicht ich? Ich habe nichts verlauten lassen, dass ich nicht fahre. Ich bin dem Befehl gefolgt und gefahren. Und wenn etwas Ähnliches jetzt passieren würde?
N.K.: Gott bewahre!
S.Zh.: Gott bewahre, aber falls das passiert, wo finden wir solche Patrioten unserer Heimat, die helfen könnten? Natürlich hat man etwas daraus gelernt, was das Energiesystem angeht, solche Reaktoren werden außer Betrieb gesetzt oder modernisiert. Aber die Bevölkerung wurde nicht benachrichtigt, die Menschen sind durch Prypjat gebummelt. Wir alle wissen das, wir haben es gesehen. Man konnte doch sofort verkünden: Der Reaktor wurde zerstört, einfach zerstört. Mehr als 2.000 Röntgen werden zusammen mit den Brennelementen in die Luft freigesetzt. In Prypjat, nur zwei Kilometer vom Werk entfernt, haben Leute gelebt. In Prypjat selbst gibt es verschiedene Strahlungsniveaus.
N.K.: Das große Problem lag also darin, dass die Menschen nichts wussten, oder? Das heißt, man hätte einiges vermeiden können...
S.Zh.: Ja, und was am interessantesten ist: Das Meldesystem funktionierte, alles funktionierte, aber die Menschen wurden nicht benachrichtigt.
N.K.: Es gab keinen politischen Willen oder wie soll man das nennen?
S.Zh.: Gar keinen politischen Willen. Die Ausländer, die im Werk arbeiteten, haben es sofort verlassen. Und wir haben noch lange gedacht, dass es hoffentlich vorübereht. Auf der Ebene des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei konnte man keine richtige Entscheidung treffen, die Bevölkerung zu evakuieren.
N.K.: Also Kopflosigkeit gab es auch auf einer so hohen Ebene?
S.Zh.: Das ist schon Politik.
N.K.: Ja.
S.Zh.: Also, es gab keine politische Entscheidung. Alle wussten, was getan werden soll, aber ohne Befehl konnte niemand agieren, um nicht entlassen zu werden.
N.K.: Solche Angst eben.
S.Zh.: Das System an sich ist eine harte Verwaltung ohne Instruktionen, was man tun soll, falls so ein Fall eintritt. Es sollte eine Instruktion geben, dass die Bevölkerung evakuiert werden soll, aber es gab keine. Die Menschen sind einfach in ihren Häusern geblieben. Natürlich sind Spezialisten vom Werk gekommen und haben gesagt: „Geht nicht raus.” Aber nicht alle wurden benachrichtigt, die Kinder bummelten durch die Straßen. Das ist schrecklich.
N.K.: Erinnern Sie sich an den Zeitpunkt, als sie an dieses Geschehen als eine Katastrophe zu denken begonnen?
S.Zh.: 1986 war ich noch in der Mongolei und bin erst 1987 zurückgekehrt. Nach dem 3. oder 4. Mai wurden wir per Satellitensystem, das war unser Fernsehen, benachrichtigt, dass eine derartige Havarie geschehen sei. Keine Katastrophe, sondern Havarie im Tschernobyl-Atomkraftwerk, wo die Schadensbehebung abegonnen worden sei. In der Tat war es am 26. April passiert.
N.K.: Ja.
S.Zh.: Und ich habe das erst im Mai erfahren.
N.K.: Ach so?
S.Zh.: Ja. Bei uns in Kyjiw hat ein Umzug zum 1. Mai und ein Friedensfahrradrennen stattgefunden.
N.K.: So viele Jahre sind jetzt vergangen, und ich weiß, dass es eine Tendenz unter den Jugendlichen gibt, nach Tschernobyl als Touristen zu fahren. Was meinen Sie dazu? Dürfen sie in die Zone gelassen werden? Was glauben Sie? Ist das noch gefährlich?
S.Zh.: Naja, die Halbwertszeit von Strontium ist 30 Jahren, von Plutonium mehr als 200 Jahre. Das heißt, wir haben einen Apfel und erst nach 30 Jahren bekommen wir eine Hälfte des Apfels. Natürlich haben wir verschiedene Grabanlagen in Tschernobyl beerdigt. Erstens, ist der Brennstoff noch da, unter dem Sarkophag. Zweitens, bauen wir eine neue Hülle, denn dieser Sarkophag zerfällt. Sogar wenn wir eine Gelände-Entgiftung durchführen würden und das Strahlungsniveau gesunken wäre, wären sowieso Risse im Sarkophag geblieben. Welche Prozesse darunter laufen, wissen wir bis heute nicht. Ich halte es für unnötig, jemanden dorthin zu bringen, weil das nur eine kommerzielle Aktion ist. Vielleicht sollten wir den Menschen zeigen, wozu es führen kann. Aber Ausflüge dorthin zu machen ist dasselbe, wie auf den Knochen zu tanzen. Im Luhansker Gebiet gab es 19.000 Menschen, die auf irgendwelche Weise mit Tschernobyl verbunden waren. Das ist das 3. oder 4. Gebiet nach der Zahl der Liquidatoren. Jetzt sind nur circa 12.000 angemeldete Tschernobyler geblieben. Wo sind die anderen? Das heißt, die eine Hälfte gibt es nicht mehr.
N.K.: Na ja.
S.Zh.: Man muss auch berücksichtigen, was das Durchschnittsalter war… Ich war 32, es gab jüngere Leute von 30 Jahren, also...
N.K.: Ja klar.
S.Zh.: Im Luhansker Gebiet haben wir eine Statistik der verstorbenen Liquidatoren zusammengestellt. Sie kann man im Gedächtnis-Buch in der Wladimir-Kathedrale finden. Das wurde zu dem Zweck erstellt, dass man an bestimmten Tagen für die Gefallenen, für unsere Seelen in der Kirche betete. Ich habe eine Auswahl der Verstorbenen zusammengestellt und ihr Durchschnittsalter berechnet. Zweitausend Menschen aus dieser Auswahl waren jünger als 50 Jahre, das Durchschnittsalter lag unter 50 Jahren...
N.K.: Aha. Also Menschen, die damals sehr jung waren?
S.Zh.: Verstehen Sie? Das Durchschnittsalter. Vom Jahre 2013 aus betrachtet ist es schon ein bisschen über 50. Wenn man dieses Durchschnittsalter berechnet, liegen die Schlussfolgerungen gar nicht fern. Man sagt, Tschernobyl ist nichts, Tschernobyl ist Quatsch. Stimmt aber nicht. Tschernobyl ist eine verlorene Bevölkerung. Was geschieht dann mit den Kindern der Liquidatoren, die bis 18 Jahren den Status hatten und ihn jetzt verloren haben? Nach Hiroshima und Nagasaki haben wir schon mehrere Generationen der Kinder, nicht wahr? Die Probleme können sich auch nach einer Generation bemerkbar machen.
N.K.: Jna, klar. Sagen Sie bitte, wie finden Sie die Gedenkveranstaltungen? Halten Sie es für nötig, den jüngeren Generationen zu erzählen, wie es war?
S.Zh.: Nach zehn Jahren bin ich darauf gekommen, dass ich Informationen für mein Buch sammeln sollte und nicht nur Bilder, sondern… Ich versuchte es auf folgende Weise zu machen: Eine Hälfte des Buches sollte Informationen über Tschernobyl beinhalten – was das ist, wie es passiert ist. Es sollte darin Interviews mit den Menschen, die da waren geben, so dass es, sogar für einen jungen Menschen interessant wäre zu lesen. Auf diese Schwierigkeit bin ich gestoßen. Ich brauchte Informationen. In der Bibliothek habe ich alles gefunden, was Tschernobyl betraf – Zeitschriften, Zeitungen– aber damals war Tschernobyl ein Tabu. Nach 10 Jahren wurde nichts Entschleierndes veröffentlicht. Das galt als geheime Information. Man schrieb, man sei dort gewesen und so weiter. Aber...
N.K.: Ein gewisses Totschweigen war es?
S.Zh.: Aber natürlich, das war ein hundertprozentiges Totschweigen. Ich habe die Menschen ausgefragt, die einen Revers ausgestellt hatten. Leute einiger Berufe stellen einen Revers, also eine Bescheinigung zur Geheimhaltung für 20, 30 Jahre aus. Und solche Menschen verzichteten darauf, mir Informationen zu geben.
N.K.: Aha.
S.Zh.: Er sagt: “Verstehst du, dass…” Ich sage: “Das ist fast vorbei… Du bist schon über 60, verzeih mir, aber du hast keine Gesundheit, wer braucht dann deine Informationen? Erzähl mir, bitte.”
N.K.: Naja, es gibt solche Menschen.
S.Zh.: „Ich bin ja Offizier, ich habe einen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnet, einen Schwur abgelegt.” Erst nach zehn Jahren haben wir angefangen, Denkmäler zu eröffnen und die Informationen zu erschließen, zu zeigen, was passiert ist. Manchmal bin ich in Schulen, um von Tschernobyl zu erzählen, mache das mit Gedichten, spiele Filme ab, und die Kinder sitzen zuerst schweigend da. Aber wenn ich in ihnen Interesse geweckt habe, beginnen sie, mir Fragen zu stellen: Was war das? Von den ersten sechs Helden wissen sie fast nichts, sie wissen nicht, dass zwei davon Helden der Sowjetunion waren, die anderen auch, aber posthum. Wo ist dieses Tschernobyl, was ist das? Erst nach zehn Jahren haben wir die Informationen zu erschließen begonnen. Jetzt soll man unbedingt solche Veranstaltungen organisieren, ich sage das nicht aus dem Grund, weil ich ein Tschernobyler bin. Die Menschen sollen verstehen, dass das keine Witze sind. Wir hätten die Tschernobyler Sperrzone bis zum Ural kriegen können.
N.K.: Ja.
S.Zh.: Aus Kyjiw sind Leute gelaufen, die wussten, es hätte noch eine Explosion passieren können. Und das konnte wirklich geschehen, aber unsere Landsleute haben sich wie Helden benommen. Vor den Feuerwehrmännern sollen wir uns dankend verneigen, nicht nur vor den ersten, sondern auch vor denen, die das Wasser aus dem Raum unter dem Reaktor abgezapft haben.
N.K.: Natürlich gab es viele Leute.
S.Zh.: Vor den Bergarbeitern sollten wir uns dankend verneigen. Jetzt sagen sie, man sollte keinen Tunnel zum Reaktor bohren, aber damals haben sie es getan. Davon leben schon 80 Prozent nicht mehr. Das Strahlungsniveau war dort schrecklich, wahnsinnig. Viele Menschen wurden dorthin entsendet, nicht wie in Japan. Dort waren sie Kamikaze, die Freiwilligen. Der Staat bot uns als erfahrene Liquidatoren für einen Arbeitstag 5.000 Dollar an.
N.K.: Wirklich? Die Japaner haben das angeboten?
S.Zh.: Sie hatten Interesse daran, und boten den Hauptexperten mit Erfahrung 5.000 Dollar für einen Arbeitstag.
N.K.: Ist jemand gefahren?
S.Zh.: Das weiß ich nicht, aber es gab diese Informationen.
N.K.: Ich habe die letzte Frage an Sie. Werden neue Generationen geboren, die Schlussfolgerungen aus dieser Geschichte ziehen sollten. Vielleicht möchten Sie ihnen etwas sagen, woran man sich immer erinnern und was man nie vergessen soll? Was aus diesen Ereignissen ist wichtig zu wissen?
S.Zh.: Als Ljubow Iwanowna [Negatina] aus Deutschland zu unserem Heimatkundemuseum mit einer Ausstellung gekommen ist, war ich ein Guide. Sie sind gefahren, und ich bin geblieben. Für zwei Wochen haben wir den Schülern und Studierenden diese Ausstellung gezeigt. Vor allem habe ich erzählt, wie es vom technischen Standpunkt aus geschehen ist. Ich habe eine Schlussfolgerung gezogen, die die Kinder sollten gut lernen. Denn das Wasser ist, was sie trinken werden. Und falls sie keine Spezialisten werden, kriegen wir in der ganzen Welt Probleme mit dem Wasser. Vielleicht werden wir um das reine Wasser Kriege führen. Und was vorher geschehen ist, darf man auf keinen Fall vergessen. Früher gab es eine Zivilverteidigung, Bunker Eine Katastrophe ist im Osten geschehen und die Unterstände funktionieren nicht. Das heißt, wir wollen nicht denken. Das ist, was auch Staatsmänner lernen sollten, und falls sie nicht das erfüllen, was sie sollen, müssen sie hingerichtet werden.
N.K.: Intelligenz und Verantwortlichkeit müssen sein?
S.Zh.: Intelligenz, Verantwortlichkeit. Den Kindern soll das unbedingt vermittelt werden. Unbedingt. Man darf es nie vergessen. Ohne Erziehung haben wir keine normalen Menschen. Zweifellos soll es so sein.
N.K.: Danke.
S.Zh.: Zweifellos.