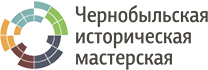Pawel
Pawel
- liquidator
Birth date:
Place of Birth:
Place of residence:
Professional activity:
Time spent in the Chernobyl Zone:
Activities at the Chernobyl Zone:
Natalija Koslowa (nachstehend kurz N.K. genannt): Also, heute haben wir den 31. März 2014. Wir sind im Raum des „Verbandes Tschernobyl“ und ich, Natalija Koslowa, interviewe gerade Herrn – stellen Sie sich bitte vor -
Pawel Pokrassjon (nachstehend kurz P.P. genannt): Stellvertretender Präsident des regionalen eingetragenen Vereins „Verband Tschernobyl“ Pawel Michajlowitsch Pokrassjon.
N.K.: Sehr angenehm. Sehr angenehm nochmals. Also, meine erste Frage an Sie, die ist ziemlich umfassend, und es ist eigentlich eine Frage und eine Bitte zugleich. Ich bitte Sie, die Geschichte Ihres Lebens zu erzählen, mindestens das, was Sie selbst für relevant halten. Ganz vom Anfang an. Wie es Ihnen bequem ist.
P.P.: Schule, Wehrdienst, Studium, Arbeit bei der Notfallstation. In der Nacht, da sich jener Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl ereignete, hatte ich eben Nachtschicht. Natürlich wurde uns gleich darüber gemeldet. Im frühen Morgen wurde allen männlichen Mitarbeitern (die Mitarbeiterinnen kamen damals noch nicht in Frage) befohlen, im Hausbereitschaftsdienst zu blieben. Es gab nämlich manchmal Situationen, da ich meine Schicht vollendete und zwei Tage frei haben durfte, musste aber auf meiner Arbeitsstelle die Telefonnummer, nach der ich während dieser Tage erreichbar sein werde, für die Fälle, „wenn’s brennt“, hinterlassen. Und jenes Mal brannte es beinahe. Als wir die Schicht vollendeten und nach draußen kamen, fingen wir an, uns zu überlegen, was wir weiter tun sollten. Werden wir einberufen, so gehen wir gewiss nach drüben. Wir beschlossen, die Sache zu besprechen. Ließen uns im Schatten nieder und fingen an zu besprechen, wie wir weiter handeln, ob wir Einberufungsbescheide aus dem Militärkommissariat erwarten oder lieber selber nach drüben fahren. Inzwischen ging Iwan Iwanowitsch Passjetschnik, Leiter der 3. Abteilung des Militärkommissariates vom Stadtbezirk Moskowskyj, vorbei. Damals war er Major. Auf den Schultern trug er seinen Sohn, den ich gut kannte, weil ich ihn behandelte. Ich sprach ihn an. „Wanja, was ist dort passiert? Was ist los?“ fragte ich. „Ich weiß nicht besonders viel. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist dass die Lage dort sehr ernst ist“. Dann sage ich: „Gäbe es dann vielleicht eine Möglichkeit, es zu vermeiden, nach drüben zu fahren? Ich habe irgendwie keine Lust zu gehen, es zieht mich nach drüben nicht“. „Weißt du, solange ich hier bin, wirst du dorthin natürlich nicht geschickt. Doch wenn ich morgen einen Befehl erhalte und weg muss, wird dich niemand retten. Bildet lieber jetzt eine Brigade und fahrt dorthin auf eigene Initiative. Im bestimmten Sinne wird’s euch sogar günstiger sein“. Damit meinte er, dass wir dabei das Durchschnittsgehalt ausgezahlt bekommen. Werden wir durch das Militärkommissariat einberufen, bekommen wir den bloßen Gehaltssatz.
N.K.: Als was arbeiteten Sie bei der Notfallstation?
P.P.: Als Arzt.
N.K.: Ach so, klar.
P.P.: Wir kamen also zurück und sagten, wir seien bereit nach drüben zu fahren. Ein paar Tage vertröstete man uns auf später: „Mal sehen, wie es weiter geht“. Und seit dem 4. Mai waren wir schon vollständig ausgerüstet.
N.K.: Aha.
P.P.: Aus Charkiw wurden 32 Brigaden geschickt; uns schlossen noch eine Brigade aus Pisotschyn[1] und eine aus Gottwald (wie damals Smijow[2] hieß) an, und wir fuhren also ab. Wir waren völlig, aber total völlig ausgerüstet. Ehe wir ankamen, wurden wir eingesetzt. Während wir uns einrichteten, besuchte uns jemand. Mindestens war er für uns damals ein gewisser Jemand. Es erwies sich später, dass er Chefarzt des Krankenhauses von Iwankowo war. Aus den mir unbekannten Gründen wählte er mich aus und holte mich nach Iwankowo. Gegen eins nachts war ich dort. Zu dem Zeitpunkt war ich schon in Prypjat und im Kraftwerk eingesetzt worden, so hatte ich schon den Schutzanzug an, als ich dorthin kam. Am Morgen fing ich an zu arbeiten. Die Arbeit dort unterschied sich kaum von der Arbeit bei der Notfallstation hier, bloß waren die Arbeitsbedingungen extremer. So. Zum Beispiel hast du heute Schicht, morgen bist du aber bei der Evakuierung eingesetzt.
N.K.: Aha.
P.P.: An der Evakuierung der Einwohner von Prypjat nahm ich nicht teil, alle waren schon ausgesiedelt, als wir kamen. Dasselbe betrifft Tschernobyl auch an. Wir waren für die Evakuierung der Dorfbewohner zuständig.
N.K.: Ach so. Sie befassten sich also mit der Evakuierung?
P.P.: Stimmt. Es war im Mai. Im Mai also war ich bei der Evakuierung eingesetzt. Ich erhielt eine Vorschrift, Kinder im Vorschulalter zu evakuieren. Die war aber kaum erfüllbar, denn es gab Familien mit mehreren Kindern, aus denen die einen im Vorschulalter waren und die anderen schon zur Schule gingen.
N.K.: Na ja.
P.P.: Und was fängt man mit denen allen an? Wie wäre es dann mit der Mutter? Der Vater kam normalerweise nicht in Frage, doch die Mütter sollten doch mit den Kindern weg. Wie hätte es anders sein können? Dazu gab es noch schwangere Frauen, ältere Menschen. Ich ließ insgesamt 300 Personen evakuieren. Wir brachten die alle nach Iwankowo, wo Buskolonnen gebildet wurden. Aus Iwankowo gingen die Evakuierten nach Worsel[3], Butscha[4] und Irpin[5], wo sich die Evakuierungsstellen befanden. Insgesamt waren es, glaube ich, 1350 Kinder, 811 Mütter, 58 oder 59 Schwangere, genauer gesagt, Hochschwangere. Es war übrigens sehr heiß, als wir sie abtransportierten. Als Gehilfen bekam ich zwei Medizinstudenten aus Kyjiw. „Oh Gott, was wenn jetzt einer einfällt, hier zu entbinden? “ dachte ich. „Was werde ich hier, im Bus und auf freiem Felde, tun?“ Alle schwangeren Frauen haben doch diesen Herdentrieb… Aber es verlief alles reibungslos, keine von den Schwangeren, die im Bus waren, entband… Es kam trotzdem zu einem Zwischenfall. Es kamen 9 Busse… Doch wer wusste, das Worsel und Butscha durch eine Straße geteilt sind?
N.K.: Ach.
P.P.: Es gab also dazwischen eine Straße. Auf der einen Seite lag Worsel, auf der anderen – Butscha. Wer wusste es? Wir waren doch in dieser Gegend fremd und hatten wo so was keine Ahnung. Es wurde uns gesagt, wo wir hinfahren sollten. Im Stadtexekutivkomitee oder im Stadtbezirksexekutivkomitee (ich erinnere mich nicht genau wo) gab es den Rayonplan… genauer gesagt den Oblastplan. Und es wurde mir gezeigt, wohin wir fahren müssen. Aber als wir zu diesem Ort gelangten, war dort schon alles besetzt. Wir fragten: „Was sollen wir tun? Wo sollen wir weiter hin?“ Von mobiler Verbindung war damals natürlich keine Rede. Mit Hängen und Würgen fanden wir ein Telefon. Am Telefon wurde uns gesagt: „Seid ihr Kleinkinder? Könnt ihr selber damit nicht klarmachen? Sucht sich eine ähnliche Stelle aus!“ Wir fingen an zu suchen und fanden etwas. Wir fanden ein Ferienlager für junge Fußballspieler. Es gab dort kleine Häuschen, für je ein Team mit seinem Trainer ein Häuschen, dazu gehörten noch Nebenräume. Uns empfing der Wächter, der sehr stark nach Alkohol stank (allem Ansehen nach rettete er sich auf solche Weise vor Radioaktivität). Ringsum roch alles nach Farbe, denn es liefen die Vorbereitungen auf die Schulferien auf Hochtouren. Und da kamen wir… Unter uns gab es frischgebackene Mütter mit etwa 30 Babys.
N.K.: Ach so!
P.P.: Ihnen wurde vor der Evakuierung gesagt: „Jede von euch soll eine Flasche Milch, einen Luller und noch alles, was dazu gehört, mitnehmen. Nehmt nicht viel mit, denn es ist zu heiß. Unterwegs werdet ihr den Rest bekommen.“ Doch als wir dorthin kamen, gab es dort fast nichts. Na ja, um bestimmte Vorräte hatte man sich im Voraus gekümmert, denn man wusste, dass dorthin sowieso Menschen geholt werden. Und es spielte sich so ab, dass ausgerechnet wir kamen. Die Mütter fingen also an, gegen mich zu murren. Für die gab es das Essen nämlich.
N.K.: Aha.
P.P.: Es gab dort trockene Wurst, chinesische gehackte Würstchen, gekochte Eier. Für die Kleinkinder war aber nichts vorgesehen. Dann beschlossen der Fahrer und ich, in ein naheliegendes Dorf zu fahren (das Ferienlager lag nämlich außerhalb des Dorfes). Wir fuhren einem Eckhaus, das am Rande des Dorfes lag, heran (oder war es vielleicht das zweite Haus links?) und sahen drei Mütterchen sitzen. Dann schloss ihnen noch eine an. Die vier aßen Sonnenblumenkerne und spukten die Schalenreste aus. Da wir die Schutzanzüge anhatten, fragten uns die Mütterchen: „Kommt ihr grade aus dieser Hölle, Jungs?“ „Genau. Könnten wir von Ihnen ein wenig Milch kaufen?“ Selbstverständlich auf eigene Kosten, gegen eigene „Groschi“[6], wir mussten doch das Essen für die Babys holen, die schon vor Hunger weinten. „Wer wird dafür zahlen?“ Diese Frage veranschaulicht, wie „freundlich“ wir aufgenommen wurden. Es stand in allen Medien, dass alle bereit waren, die Menschen von drüben aufzunehmen, den Armen ein herzliches Willkommen zu entbieten. Und da hört man die Frage „Wer wird dafür zahlen?“… Na gut. Wir nahmen 3 Dreiliterflashen, bezahlten die und holten die hin. Der Wächter fand einen neuen Zinkeimer. Die Mütter wuschen ihn, streckten die Milch mit etwas Wasser und stellten den Eimer auf den Elektroherd, um die Milch zu kochen. Wir fuhren somit ab. Wie ihre Leben weitergingen, weiß ich nicht. Na ja… Etwas später… Es waren, glaube ich, einige Jahre oder sogar gute 10 oder 12 Jahre vergangen, als ich meine Enkeltochter in die erste Klasse der Grundschule brachte.
N.K.: Aha.
P.P.: Bei der Einschulungsfeier, die es in unseren Schulen normalerweise am ersten September gibt[7], kam mir eine junge Frau angelaufen. „Hallo!“ – „Hallo!“ – „Erinnern Sie sich an mich?“ – „Nein.“ – „Und ich erinnere mich an Sie.“ – „Woher kommen Sie denn?“ – „Sie evakuierten mich, als ich ein kleines Mädchen war“. Das kleine Mädchen sei aufgewachsen, habe einen Mann geheiratet und ein Kind bekommen. Nun stellte es sich heraus, dass ihre Tochter und meine Enkeltochter in dieselbe Klasse gingen. Diana, Diana… Denissenko, Dina Denissenko. Von ihr erfuhr ich, dass ich bei der Evakuierung sozusagen was Schönes angestellt hatte. Ich evakuierte ihre Familie mit den Großeltern. Bei der Evakuierung wurde die Familie aufgeteilt. So wurden die Kinder nach Tscherkassy, genauer gesagt, in die Oblast Tscherkassy geschickt, während die Großeltern nach Baltikum[8] gingen. Es blieben keine Angaben, keine Informationen, keine Verbindung. Ein halbes Jahr lang suchten sie ihre Großeltern… Das wurde mir von dieser jungen Dame erzählt. Ohne es zu ahnen, erwies ich ihrer Familie damals einen Bärendienst (P.P. lacht).
N.K.: Dafür sahen ihre Oma und Opa Baltikum.
P.P.: Na ja. Gehen wir weiter. Nachdem wir jene Arbeit ausgeführt hatten, fingen die Bereitschaftsdienste bei der Notfallstation an, die von der Regierungskommission kontrolliert wurden. Innerhalb elf Tage hatte ich dreimal Bereitschaftsdienst.
N.K.: Sie waren dort also elf Tage, stimmt das?
P.P.: Ja, das stimmt, ich blieb dort elf Tage. Um genau zu sein, zählen der Anreise- und der Abreisetage nicht, also ohne die waren es 11 Tage. Ich verbrachte an der Station nicht jeden Tag, sondern ich kam dorthin, wenn ich Bereitschaftsdienst hatte. Um Erkrankungen handelte es sich normalerweise nicht. Es gab Verletzungen, Brandwunden, manche Patienten litten an ein merkwürdiges Schwindelgefühl. Aber erst später begriffen wir, dass das eben eine Folge der Strahlungswirkung war. Schwindelgefühl, Übelkeit, also ziemlich unangenehme Symptome. Na ja, mit solchen Sachen setzten wir uns damals auseinander. Und es kam alles ungewöhnlich vor. Mir fällt ein Zwischenfall ein. Es war, glaube ich, am 6. oder 7. Mai. Wir wurden zu einem großen Chef geholt.
N.K.: Aha.
P.P.: Der sammelte die Leiter aller Brigaden. In einem großen Saal saß ein rotbärtiger Mann und stöberte in seinen Papieren. Wir nahmen Platz. Plötzlich blickte er auf und fragte: „Wolltet ihr etwa Bleistifte anspitzen?“ Aus dem Slang übersetzt bedeutete die Redewendung „Bleistifte anspitzen“ in den Hohen Norden geschickt werden, um dort an Holzeinschlagorten zu arbeiten. Ich frage ihn: „Wieso denn? Was haben wir getan?“ - „Diagnose „Strahlenkrankheit“ ist in die Patientenakten keineswegs einzutragen!“ Die Sache ist die, dass eine Diagnose in der offiziellen Medizin sehr schwierig zu widerrufen ist, wenn sie von einem Arzt gestellt wurde, der für die Untersuchung und die Behandlung des Patienten zuständig ist.
N.K.: Ach so.
P.P.: Tja, also ziemlich schwierig. „Ihr habt trotzdem die Diagnose „Strahlenkrankheit“ eingetragen. Das dürft ihr nicht tun!“ Und ich: „Warte mal! Ich bin doch Diplommediziner. Ich sehe etwa ein, woher mein Patient kommt. Dazu habe ich die Ergebnisse des schnellen Bluttests vor den Augen, und da steht eine Drei. Und nun kommst du und sagst „Das dürft ihr nicht tun““ Welche Diagnose soll ich dann stellen?“ – „Ihr dürft den Kontakt mit ionisierender Strahlung diagnostizieren, sonst nichts.“ Der Kontakt mit ionisierender Strahlung ist doch noch keine Strahlenkrankheit. So stellten wir die strengstens empfohlenen Diagnosen, weil niemand von uns „Bleistifte anspitzen“ wollte. Und obwohl wir Ärzte waren, begriffen wir die ganze Gefahr, den ganzen Ernst der Lage noch nicht. Es gab zwar ein unangenehmes Gefühl und einen metallenen Geschmack im Mund und Halskratzen, die Augen tränen und man wollte ständig schlafen. Aber an so was gewöhnte man sich. Dazu noch hatte ich eine ziemlich große Erfahrung als Notarzt, für Leute wie ich war es schon egal, ob es Tag oder Nacht war, ich konnte zu jeder Tageszeit arbeiten. Vielleicht vertrugen manche so was schwieriger als diejenigen, die bei Notfallstationen arbeiteten. Also, es wurde weiter gearbeitet. Und dann wurde ich im September plötzlich für den Leiter unserer Gruppe erklärt und wir fuhren für September und Oktober nach Tschernobyl
N.K.: War es schon Ihre nächste Dienstreise?
P.P.: Genau. Es war in demselben Jahr, wir fuhren nach drüben für zwei Monate – den September und den Oktober. Dort war es schon härter. Es waren alle Evakuierungen vorbei. Doch es gab ein weiteres Problem: die sogenannten „Samosely“[9].
N.K.: Aha.
P.P.: Wir nannten sie „Partisanen“, obwohl als Partisanen die einberufenen Männer normalerweise umgangssprachlich bezeichnet wurden. Dieser Begriff passte aber auch den Samosely, weil sie sich ständig verbergen mussten. Es ist außerdem erwähnenswert, dass die echten Partisanen während des Zweiten Weltkrieges in dieser Gegend sehr aktiv waren. Es kam beispielsweise eine Meldung, dass es in einem der Dörfer fünf Personen aufgefallen sind. Die Miliz war für den Schutz der Dörfer gegen Plünderer zuständig. „Man sagt euch weiter, wohin ihr gehen sollt und was ihr tun wollt.“ Wir kamen also hin. Na ja. Und dazu muss man noch sagen, dass eine Pressekonferenz (oder war ein Briefing?) stattfand, und es stellte ein Journalist aus der damaligen Tschechoslowakei eine heikle Frage: „Wieso wurde die ganze junge Bevölkerung evakuiert, während die älteren Menschen da drüben blieben? So kümmert sich also der Staat um die sowjetischen Bürger?“ Und schon am nächsten Tag wurden die Festnahmegruppen, wie die Einheimischen sie tauften, eingeführt. Es war eigentlich auch Evakuierung, doch die verlief schon zwangsläufig.
N.K.: Aha.
P.P.: Eine Zwangsevakuierung. Ich war mit elf Milizisten im Einsatz, gelitten wurde unsere Gruppe von einem Kapitän aus Winnytzja. Wir verfügten über einen LKW und einen Bus. Wir kamen also an den Ort. Die Milizisten, die dort Bereitschaftsdienst hatten, wiesen uns hin, wo die Menschen wohnen. Wir fanden ihre Häuser. Und es begann. Gleich wurden wir zu „Faschisten“ und „Gestapo-Leuten“.
N.K.: Sie wurden also beschimpft?
P.P.: Aber wie! „Wo gehe ich jetzt hin? Ich bin 70, von welcher Radioaktivität redet ihr? Ich habe mein ganzes Leben und alle meine Kräfte in dieses Haus investiert, mein Opa und mein Uropa sind hier begraben, und nun kommt ihr und wollt mich aussiedeln. Nein, ich will nicht weg und es ist mir schnurzegal, ob es hier Strahlung gibt oder nicht!“ Ich erinnere mich an einen großen, einen riesigen, auf ein Auge schielenden älteren Mann mit Spuren vom durchstandenen Pocken auf dem Gesicht. Ich entdeckte ihn, als ich einen der Höfe betrat. Es war im Dorf Ladyschetschi, 7 km vom Kraftwerk entfernt. Der Wind wehte Gott sei Dank in Richtung Kraftwerk. Die Milizisten machten ihre Krägen auf und rauchten auf der Straße. Und ich betrat also einen der Höfe. Der Fahrer folgte mir wie ein Schatten, weil er nicht nur Fahrer, sondern auch Strahlungsmesstechniker war. Der ältere Mann war im Hof allein. Ich sagte ihm: „Na los, komm mit!“ Schweigend ging er in sein Haus und kam mit einer Leine zurück. „Wozu das denn?“ fragte ich. - „Bindest du mich an, so gehe ich mit euch. Bindest du mich nicht an, bleib ich hier. Selbstständig und freiwillig werde ich mein Haus nicht verlassen. Hier, nimm die Leine, binde mich an, dann gehe ich mit euch weg. Sonst gehe ich nicht.“ Natürlich bemühten wir uns, die alle zu überreden. Soviel ich mich erinnern kann, waren in dem Dorf elf ältere Frauen und ein älterer Mann geblieben.
N.K.: Aha.
P.P.: Die Tante Katja war ihre Kommandantin. Oder war es die Tante Sonja? Genau, die Tante Sonja war ihre Kommandantin. Das schneidigste Mütterchen des Dorfes. Diejenigen, die wir aus der Sperrzone evakuierten, waren in ein paar Tage wieder da. Ich stellte ihnen eine Frage, ich sagte: „Ihr guten Leute, wie schafft ihr es? Es ist doch nicht so einfach, sich bei dem ganzen Stacheldraht, durch all die Posten den Weg nach Hause zu bahnen!“ Da antworte mir ein Mütterchen: „Weißt du, Kind, ich war zu Zeiten des Krieges noch jung und holte den Partisanen das Essen. Von denen bekam ich Flugblätter, die ich ausbreiten sollte. Und die Nazideutschen… die schossen auf mich! Und ihr schießt auf mich nicht. Ich kenne hier jeden Pfad, jedes Stumpfen kenn ich hier. Das ist für mich ein Kinderspiel!“
Solche Situationen gab es also. Es war manchmal unerträglich während dieser zwangsläufigen Evakuierung diese Menschen zu sehen und ihre Umsiedlung zu beobachten. Erstens waren die LKWs für die Sachen bestimmt. Wie viele Sachen konnte man mit sich nehmen? Soviel man in eine Reisetasche, einen Koffer oder einen Sack stecken konnte. Oder in ein auf eine besondere Weise gewickeltes Betttuch. Dann wurden die Menschen in ein Zelt gebracht, das inmitten eines Feldes stand, wo sie sich waschen und umziehen sollten. Dazu gab es noch ein kleineres Zelt…
N.K.: Sie wohnten also in einem Zelt?
P.P.: Nein. Wir wohnten im Tschernobyler Krankenhaus. In Zelten wurden die Menschen unterbracht, die aus den Dörfern evakuiert wurden. Dort sollten sie sich waschen und umziehen. Und ich erinnere mich an ein Mütterchen, die sehr klein und schön alt (jedenfalls älter als ich jetzt bin) war und eine Strickjacke anhatte. Die Trennung von der Strickjacke fiel ihr wirklich schwer. Es war eine dicke, wollene, giftgrüne Strickjacke. „Ich hab die mein halbes Leben lang getragen, die ist mir so wichtig!“ weinte die arme Frau. Dann wurde die in die Arbeitskleidung umgezogen, zu der selbstverständlich eine Jacke und eine Hose gehörten. Und da sagte dieses Mütterchen: „In meinem Leben habe ich nur die Hose meines Mannes in den Händen getragen, während ich sie wusch. Glaubt euch etwa, dass ich, alte Bäuerin, eine Hose anziehe? Um nichts in der Welt!“ In der großen Jacke und schweren Kirsaschuhen mit Nieten sah sie wirklich jämmerlich aus. Und es tat wirklich leid, dass sie ihr Haus und alles, was sie ihr ganzes Leben lang baute, verlassen musste. Es war ihr schwer, sich vom Haus zu trennen, in eine unbekannte Gegend umzusiedeln, sich dort einzuleben. Deshalb kehrten solche Menschen zurück und wohnten dort weiter. So war meine Arbeit. Und was das kleinere Zelt angeht, woran ich mich erinnerte… Es ist richtig schwer, an so etwas zu erinnern, ohne Brustschmerzen zu bekommen und in Tränen auszubrechen. Es wurde ein Zelt eingerichtet, wo den Kindern Blutproben entnommen wurden. Sie wissen wohl, dass die Kinder normalerweise Angst haben, sich aus dem Finger Blut nehmen zu lassen. Und jene Kinder standen still und ruhig einer nach dem anderen. Sie hatten zwar Angst, reichten aber demütig ihre Finger. Und sie war gruselig, diese Szene.
N.K.: Aha.
P.P.: So. Sowohl während der zwangsläufigen Evakuierung, als auch während der planmäßigen Evakuierung gab es keine Panik. Es war eine gewisse Entrücktheit von den Augen abzulesen: „Wie wird es weiter sein? Was soll ich weiter tun? Wo gehöre ich nun hin?“. Danach gab es lauter Bereitschaftsdienste mit viel Routine. Da gab es nichts Besonderes. Es war die Zeit des Kampfes gegen Trink- und Alkoholsucht[10]…
N.K.: Aha.
P.P.: …Deswegen waren Alkoholgetränke nur sehr schwer zu verschaffen. Doch man fand immer Möglichkeiten, sich zu versaufen. Es gab viele Verkehrsunfälle, bald wurde ein Auto verletzt, bald fuhr ein Wagen fuhr in einen Zaum oder in eine Scheune hinein. Es gibt doch verschiedene Männer. Manche wussten es immer, Wodka oder Samogon[11] zu finden. Dazu noch wurde am 7. oder am 8. Mai Kfz-Inspektoren eingesetzt (vorher hatte es die nicht gegeben). Und da kam der Selbsthaltungstrieb zur Geltung. Die Autofahrer sahen einen Kfz-Inspektor auf der Straße und, da manche von ihnen ein wenig beschwipst waren, fingen die an, Winkelzüge zu machen; versuchten, den Inspektoren zu entfliehen. Das führte dazu, dass die Zahl der Verkehrsunfälle und der Verletzungen stieg (P.P. lacht), weil…
N.K.: Halt merkwürdig, ne (N.K. lacht)?
P.P.: Tja, das waren also die Folgen des menschlichen Selbsthaltungstriebes. Sonst gab es bei der Arbeit nichts Besonderes. Keinen Heroismus… Apropos, Heroismus.
N.K.: Ja, bitte.
P.P.: Wir dekontaminierten Dächer und begossen sie mit einer Flüssigkeit (ihre Farbe ähnelte sich der Farbe eines Öls oder eines starken Tees). Nach einer kurzen Zeitspanne verfestigte sich diese Flüssigkeit und ließ den Staub nicht verbreiten. So.
N.K.: Aha.
P.P.: Es klebten sich aber Steine (nicht Pflastersteine, sondern ziemlich große, formlose Steine) auf das Dach. Und es waren Maschinen eingesetzt, die wir Mondmobile tauften, weil sie wirklich den Mondmobilen ähnlich aussahen. Insgesamt waren es 4 oder 5 Maschinen, auf dem Dach waren drei davon eingesetzt und noch eine stand unten. Und dann hörten sie plötzlich auf, Befehle auszuführen. Wahrscheinlich war es auf die intensive Strahlung zurückzuführen. Ich weiß eigentlich nicht, wie sie funktionierten, vielleicht wurden sie mit Funkbefehlen gesteuert. Und da kam unser, in der Sowjetunion ausgefertigster Roboter – ein riesiger Kasten, zwei Raupenketten, die sich bewegten, zwei Antennen, die wie zwei Ausläufer aussahen. Er ging und bog dorthin, wo die Strahlung intensiver war. Aber denn er auf einen Stein stieß, da war es sehr schwierig, ihn zu bewegen.
N.K.: Aha.
P.P.: Man konnte ihn also nicht bewegen. Eine der Raupenketten zerplatzte, der Roboter wurde mit einem Drahtseil eingehackt und zum Bunker gezogen. Die Raupenkette wurde angespannt, und die Maschine wurde wieder in Betrieb gesetzt, die ging aber wieder dorthin, wo die Strahlungsbelastung höher war. Am „Rücken“ des Roboters schrieb ein Spaßmacher „Fedja“. Es war mit einer braunen Farbe, einer schlechten braunen Farbe, ein wenig schräghin geschrieben. Es kannten viele den Fedja. Ihm wurde oft liebevoll gesagt: „Gedulde dich, Fedja!“ – jene Phrase stammte aus einem beliebten sowjetischen Film, der eben damals über Bildschirme lief[12]. Dann wurde der Fedja weggenommen. Ihn nahm ein Helikopter weg, dann wurde er auf ein Lastschiff geladen und irgendwohin geholt. Also dann musste man die Steine zerschlagen. Man sagte (ich sah es selber nicht), es wäre ein Oberstleutnant mit zwei Soldaten (oder waren es Sergeanten?). Und die schlugen mit einem Maschinengewehr alle Steine, die da oben waren, in Scherben und räumten dann aus. Das Dach wurde allem Ansehen nach mit einer aggressiv giftigen Flüssigkeit begossen, und bei der unteren Gabe platzte der Schlauch.
N.K.: Aha.
P.P.: Ein dem Feuerwehrschlauch ähnliches Ding. Im Bunker standen diejenigen, die auf dem Dach arbeiteten. Etwa 19 Soldaten oder, wie sie damals dort genannt wurden, Partisanen. Auf dem Dach durfte man höchstens 90 Sekunden bleiben. Es kam der Erste und legte die Kupplung oder die Spange und die Bolzen. Dann kam der Zweite und überschlug die Spange. Dann kam der Dritte und zog die Bolzen an. Und so weiter. Es war schon der Fünfte oder der Sechste an der Reihe. Der hatte Handschuhe mit, glaube ich, Zinkfäden oder so was. In denen konnte man die Faust ballen, doch ohne Hilfe konnte man sie nicht wieder auftun. Also, da zog jeder Mann die Handschuhe aus und fuhr fort, bis er mit der Arbeit fertig war. „Komm zurück! Komm mal!“ wurde ihn geschrien. Er hatte vierzig Jahre auf seinem Buckel. Woher weiß ich das alles? Ich holte ihn nämlich ab. Seine oberen Extremitäten, genauer gesagt, die Hände, bekamen furchtbare Brandwunden. Tatsächlich waren ihm die Knochen schon entblößt.
N.K.: Wie entsetzlich!
P.P.: Ich holte ihn also ab. Ich fragte ihn damals, wieso er das getan hatte. Er war doch erst 43. „Na ja, ich hab schon ein langes Leben hinter mir, während so viele junge Männer mit mir hier arbeiten“, war seine Antwort. Dieses Verantwortungsgefühl, die Fähigkeit, für den Freund und den Arbeitskollegen die Verantwortung zu tragen – das ist eben Heroismus! Ich holte ihn zum Hubschraubergelände, es kam ein Hubschrauber und nahm ihn nach Kyjiw weg. Wie sein Leben weiterging, weiß ich nicht.
N.K.: Was Sie nicht sagen!
P.P.: Tja, das der reine, der echte Heroismus. „Ich bin 40, und da sind ganz-ganz junge Männer… Ich habe ein langes Leben hinter mir. Die Aufgabe musste sowieso erfüllt werden, und ich tat es“, sagte er. Und er führte fast die ganze Arbeit aus, ihm wurden die Knochen total entblößt, es gab auf den Händen weder Haut noch Fleisch… Dieser Mann blieb mir im Gedächtnis haften. Und deshalb weiß ich ganz gut, wie es damals dort war.
N.K.: Aha.
P.P.: Tja, so was gab es. Was uns aber angeht, taten wir nichts Hervorragendes.
N.K.: Sagen Sie nun mal, ob viele Männer dort eingesetzt wurden? Ob es auch Frauen gab?..
P.P.: Ja, Frauen gab es da drüben auch.
N.K.: Welche Arbeiten wurden von Männern ausgeführt und welche Arbeiten wurden den Frauen anvertraut?
P.P.: Die Männer wurden überall eingesetzt und führten verschiedene Arbeiten aus. Was die Frauen angeht, so gab es dort Ärztinnen, Köchinnen und Lageristinnen und Expertinnen für das Fernmeldewesen. Diese Arbeiten wurden hauptsächlich den Frauen anvertraut.
N.K.: Aber es gab jedenfalls mehr Männer?
P.P.: Sicher. Es gab sehr viele Männer, und die gab es viel mehr als Frauen. Es kamen Menschen aus der ganzen Sowjetunion. Als wir im September nach drüben kamen, arbeiteten die Jungs aus Estland mit uns zusammen. Es gab außerdem noch viele Menschen aus Mittelasien, Turkmenen oder Usbeken (weiß ich nicht genau). Turkmenen waren es, glaube ich. Aber die erfüllten eben das, was ihnen befohlen wurde, während die Esten mit Wagen fuhren, Frachtgüter lieferten und wo weiter und so fort. Außerdem zerschnitten sie den „roten“ Wald in Teile. Dann musste man am ersten Oktober den ersten Reaktorblock medizinisch versorgen. Ich wurde dorthin geschickt. Davon sind auch Fotos geblieben.
N.K.: Haben Sie die eventuell nicht mit?
P.P.: Nein, leider nicht. Doch manche davon gibt es hier. Auf diesem Foto zum Beispiel stehe ich auf einem Schutzpanzerwagen. Wir kletterten darauf und ließen sich fotografieren. Dabei weiß ich nicht, was meine Zunge los war, denn den jungen Laborantinnen, die mit uns kamen, sagte ich ganz unerwartet: „Kommt mal her, Mädchen! Lasst uns küssen, man weiß ja nicht, was uns weiter passiert.“ Zum Unglück hörte unser Betreuer, der damals die Personalabteilung des Ministeriums für Gesundheitswesen litt, was ich sagte, und mir wurde gleich panische Stimmung vorgeworfen. Eben weil ich die Worte „Man weiß ja nicht, was uns weiter passiert“ fallen ließ. Doch es passierte uns gar nichts, als wir da waren… Es gab aber ein gewisses Beänstigungsgefühl, als wir im Operationssaal waren und ein unheimliches Gedröhne vernahmen…
N.K.: Ein wenig grauenerregend war es trotzdem, ne?
P.P.: Tja, es war ein unangenehmes und, na ja, irgendwie grauenerregendes Gefühl. Als der Reaktorblock in Betrieb gesetzt wurde, wurde uns gesagt: „Nun könnt ihr frei haben“, und wir gingen weg. Wir hatten also keine Zeit, in Details einzugehen. Ich habe damals die ganze Zone durchstreift. Der Fahrer sagte, wir hätten in der Evakuierungszone gute 4 000 Kilometer zurückgelegt.
N.K.: Aha.
P.P.: Dann kam im Mai von einem der Hubschrauber eine Meldung, es stehe am Fluss Prypjat ein PKW, ein Moskwitsch, neben einem Zelt geparkt, wo eine Familie mit einem Vater, einer Mutter und zwei Kindern wohne. Und ich wurde dorthin geschickt, weil ich eben dran war. Die Kinder hießen also Jura und Schura. Der Junge hieß Jura, und Schura war ein 5- oder 6-jähriges Mädchen, ziemlich klein und mager. Der Familienvater angelte die ganze Zeit, die Mutter klagte schon, ihr gehe irgendwie schlimm. Der Jura war noch guten Mutes, während die Sascha völlig weggetreten war. Ich erzählte ihnen, was geschehen war. Die Eltern arbeiteten irgendwo nach dem Rotationsprinzip, wenn man eine Woche lang arbeitet und sich dann eine Woche lang erholt.
N.K.: Aha.
P.P.: Und so hatten sie eine Woche frei und gingen angeln. Kein Wunder bei dem wunderschönen, heißen Maiwetter. Ich holte die also ab. Es brannten mir die Worte der Schura ins Gedächtnis: „Ich glaube, ich werde jetzt sterben, Mutti“. Es ging ihr so schlimm, dass wir ihr eine Infusion geben mussten. Und es war grausam, so was von einem kleinen Kind zu hören. „Ich glaube, ich werde sterben, Mutti“. Es war ein ganz-ganz kleines Mädchen.
N.K.: Ein ganz kleines Mädchen also…
P.P.: Ich weiß wiederum nicht, wie ihr Leben weiterging. Ich holte die ganze Familie nach Iwankowo, wo die alle gleich ins Krankenhaus aufgenommen wurden. Das Mädchen landete bei der Station für Kindermedizin, wo eben meine Charkiwer Kollegen Schicht hatten. Die nahmen das Mädchen auf. Wohin sie weiterging, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe gehört, dass ein gewisser Nikoaj Grigorjewitsch Bescheid weiß, doch er könnte jetzt kaum was erzählen, weil er einen Schlaganfall vor kurzem erlitten und sich davonnoch nicht vollständig erholt hat. Also, der Nikolaj Grigorjewitsch verriet einst, dass das Mädchen dann später nach Kyjiw ging, wo es ins Krankenhaus „Oktjabrskaja“ aufgenommen wurde, und dann – nach Moskau. Mehr weiß ich von der Kleinen gar nicht. Nun sehen Sie, wie es gearbeitet wurde. Es gab kaum Schlafplätze. Und insbesondere im Mai wollten wir alle ständig schlafen. Dann wurden wir beim Stadtexekutivkomitee von Prypjat unterbracht. Es wurde uns dort ein Zimmer erteilt, aus einem Krankenhaus wurden Matratzen gebracht, die waren aber neu. Zuvor schliefen wir manchmal auf dem Fußboden, nicht einmal Betttücher gab es für uns. Meine Frau sagt, dass ich fast 40 Stundenlang schlief, als ich nach Hause zurückkehrte.
N.K.: Apropos, wie reagierte Ihre Familie auf so eine Dienstreise?
P.P.: „Wenn es die Notwendigkeit besteht zu gehen, muss man es eben tun“. So sind wir erzogen.
N.K.: Die Familie hatte also Einsicht?
P.P.: Nach Prypjat ging ich nach Turkmenien[13], wo ich Kinder mit Durchfall behandelte, dann – nach Armenien, als die Erdbebenkatastrophe dort ausbrach[14].
N.K.: Also, Sie sind…?..
P.P.: Na ja, ich bin ein abenteuerlustiger Mensch von Natur. Zum Beispiel gab es in Turkmenien eine rätselhafte Seuche. Die Patienten (meistens die Kinder) bekamen Durchfall, und es war total unklar, wo dieser Durchfall herkam und auf welche Weise man angesteckt wurde. Nach drei bis vier Tagen war der Patient tot.
N.K.: Wie Entsetzlich!
P.P.: Die Ergebnisse der Proben, die unsere Laborantinnen entnahmen, zeugten weder von Typhus, noch von Paratyphus; weder von einem Darmbakterium, noch von Dysenterie. Unser Labor konnte so gut wie nichts finden. Und dann schafften wir es, diese merkwürdige Krankheit zu besiegen. Oder ging die selbstständig weg. Aber jedenfalls arbeiteten wir sehr tüchtig. Und es kam sogar zu den Fällen, da die Einheimischen sagten: „Ich werde mich vom russischen Arzt behandeln lassen, den hiesigen Arzt könnt ihr sich sparen!“ Wir ließen die Menschen also sich von der Krankheit erholen. Irgendwie packten wir also mit der Krankheit. Aber ehrlich gesagt, war es kein Wunder, dass es dort solch eine Seuche ausbrach. Es gibt dort sogenannte Aryki, die als Bewässerungskanäle konzipiert sind, von Menschen wie Tieren aber auf alle möglichen Weisen gebraucht werden: Die Hunde stillen dort ihre Durst und waschen ihre Pfoten, die Frauen spülen dort das Geschirr ab, die Kinder baden sich darin.
N.K.: Es hätte doch viel Schlimmeres geben können!
P.P.: Genau. Doch unsere Laborantinnen entdeckten bei der Auswertung der entnommenen Proben gar nichts.
N.K.: Vielleicht war es überhaupt kein Darmbakterium?
P.P.: Kann auch sein. Ich versuchte später in der wissenschaftlichen Literatur wie im Internet darüber nachzulesen. Die Frage, was das eigentlich war, plagt mich bis auf den heutigen Tag. Vielleicht handelte es sich um einen unbekannten oder sogar mutierten Bakterien- oder Mikrobienstamm. Oder war es etwas, was nur den Ländern Mittelasiens eigen ist. Wer weiß… Unsere Laborantinnen kamen voll ausgerüstet hin, brachten viele Reaktionsmittel mit, fanden aber nichts. In dieser Gegend sind die meisten Familien kinderreich. Es ist eine durchaus normale Sache, dass eine Familie fünf bis sieben Kinder hat. Und die Reaktion auf Kindertode kam uns total unglaublich vor. Wenn ein Kind starb, wurde immer „Allahu Akbar“ gesagt: Etwa Allah hat’s gegeben, Allah hat’s genommen.
N.K.: Ach du meine Güte (N.K. lacht). Wurde das also ganz ruhig gesagt?
P.P.: Ich würde eigentlich nicht sagen, dass die Eltern, insbesondere die Mütter, dabei ganz ruhig waren. Die Väter machten sich zwar auch Sorgen, zu Tode jammerten sie sich aber nicht.
N.K.: Vielleicht war es auf die Kultur zurückzuführen.
P.P.: Na ja… Ich habe ziemlich oft gehört: „Wir waren da drüben und sahen etwas Ungeheures“. Was für ungeheure Sachen habt ihr gesehen? Die einzige Anomalie, die ich sah, waren drei riesige Pilze.
N.K.: In der Sperrzone?
P.P.: Genau. Es war im September. Unser Wagen war schon so kontaminiert, dass es nicht mehr möglich war, damit zu fahren. So fuhr ich ihn zur Grabstätte. Aber da ich der Leiter der Gruppe war, musste ich das Erlaubnis besiegelt bekommen. Unterwegs sahen wir eine Menge Schilder „Den Randstreifen bitte nicht betreten“, „Das Gras bitte nicht betreten“, „Das Unkraut bitte nicht betreten“. Nichts bitte betreten, nur auf Asphalt bitte gehen oder fahren. Wir fuhren also die Straße entlang. Und da wir die malerischen Landschaften genießen wollten, fuhren wir ziemlich langsam. Wir hätten unser Reiseziel beinahe erreicht, als wir zwei Pilze am Straßenrand und noch einen in der Nähe sahen. Und die waren unglaublich schön. Wir ließen den Wagen halten und ich stieg aus. Ich wagte es nicht, die Pilze mit der Hand zu berühren, betrat sie aber mit dem Fuß und entdeckte, dass sie weder wurmbeschädigt, noch mürbe waren. Die drei waren also wie aus einem Bilderbuch. Das wäre es. Als wir im September nach drüben kamen, erhielten wir spezielle Plastiktüten mit einem gelben Streifen und einem Verschluss. Heute gehören solche Tüten zum Alltag, damals waren sie ein nie gesehenes Wunder. Wenn wir etwas sahen, was uns merkwürdig oder ungewöhnlich vorkam, – etwa ein Unkraut, eine Pflanze, einen riesigen Apfel – sollten wir es in jene Tüte stecken.
N.K.: Wurden mit „etwas, was merkwürdig oder ungewöhnlich vorkommt“ etwa Mutationen gemeint?
P.P.: Kann sein. Es war schon September. Oder Oktober. Mir fiel ein großer Apfelbaum auf. Und ich tat, was mir empfohlen wurde. Vorsichtig (um sich nicht zu verletzen) nahm ich von diesem Baum einen Apfel, steckte ihn in die Tüte und schrieb darauf den Tag, die Zeit und den Ort, wo ich den Apfel fand.
N.K.: Aha.
P.P.: Die Tüte brachte ich dorthin, wo wir wohnten. In der Nachbarschaft wurden die Mitarbeiter des Kurtschatow-Institutes[15] von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR unterbracht. Und es waren sie, die alles Abnormale von der Zone sammelten und uns baten, ihnen alles zu bringen, was uns abnormal vorkam. Wozu? Na ja, es gab bestimmt Gründe dafür…Und so beobachtete ich, wie einer dieser Professoren einen Apfel nahm (nicht den Apfel, den ich mitbrachte, sondern einen anderen), in ein Gerät setzte, das einem Ofen ähnlich aussah, und mit Fühlern versah. Das Gerät fing an zu piepsen, das hieß also, dass der Apfel radioaktiv belastet ist. Dann wusch er den Apfel. Es wurde schon weniger gepiepst. Als er den Apfel in zwei Teile schnitt, wurde das Piepsen schon lauter. Er nahm einen Apfelkern raus und legte ihn ins Gerät. Das Gerät piepste nicht – es quäkte! Dann schälte er den Apfel und legte nur das Apfelfleisch ins Gerät. Es wurde fast nicht gepiepst.
N.K.: Ach so.
P.P.: „Kann man den Apfel essen, wenn man ihn schält und alle Apfelkerne entfernt?“ fragte ich. Doch der Professor brannte dann den Apfel und maß die Asche, die davon blieb. Und die piepste sehr stark. Auch das Mark einer Frucht konnte radioaktiv belastet sein, doch die Radioaktivität ist nicht unbedingt gleichmäßig aufgeteilt. Und als…
N.K.: Und wie war es im Frühling? Stand etwa alles in voller Blüte?
P.P.: Kann sein… Ich… Na ja, es blühte alles. Mir kamen die Tulpen, die ich im Mai da drüben sah, sehr ungewöhnlich vor. Mit ihren großen Blumen sahen sie prächtig aus. Auch die Fliederbüsche sahen üppig aus, doch es gab gar keinen Fliedergeruch. Zuerst dachte ich, dass mein Geruchsinn versagt. Aber alle behaupteten, Flieder rieche nicht. Übrigens, hat ihnen jemand von den Interviewten gesagt, dass niemand in der Zone Sperlinge sah?
N.K.: Ich habe gehört, man sah lauter tote Sperlinge.
P.P.: Das schon. Die toten Sperlinge lagen herum… Aber ich bin sicher, dass niemand behaupten wird, einen Sperling oder einen Nachtigall damals gesehen zu haben. Dasselbe geht die Schwalben an.
N.K.: Es gab also keine kleinen Vögel?
P.P.: Es gab Storche, und die waren nämlich ziemlich frech. Als die Einheimischen ausgesiedelt worden waren… Na ja, die Soldaten, die nach Tschernobyl einberufen waren, übten ihre Arbeiten aus, stiegen in Busse ein, als sie mit ihren Arbeiten fertig waren, und wurden in ihre Einheiten geholt. Die bekamen von Tschernobyl nicht so viel mit. Wir Ärzte durchfuhren die ganze Zone.
N.K.: Also, die ganze Zeit waren Sie irgendwo innerhalb der Zone unterwegs?
P.P.: Genau. Und wir sahen deshalb viel. Na, zum Beispiel. Eine Hundehütte. Die meisten Hunde wurden abgeschossen. Ein Huhn legte in der Hundehütte Eier. Es kam ein Storch, steckte seinen Kopf darin und schaffte es, das Hühnerei zu zerschlagen und den Inhalt zu trinken. Oder er nahm das Ei in seinen Nest.
N.K.: Was Sie nicht sagen!
P.P.: Dann gab es Hunde, die von ihren Herrchen verlassen wurden. Natürlich wurden nicht alle abgeschossen. Wir kamen also in ein Dorf , hielten dort an einer Wegegabelung an und überlegten, welchen der drei Wege wir nehmen sollten. Plötzlich trat ein großer, schöner Hund an unseren Wagen heran. Wahrscheinlich wurde er während der zwangsläufigen Evakuierung verlassen. Er ging um den Wagen und um den LKW herum, dann trat er an den Bus heran und guckte hinein. Wahrscheinlich erinnerte er sich, dass sein Herrchen oder sein Frauchen in den Bus…
N.K.: …einstieg
P.P.: …und wegging. Er sah den Bus und lief heran. Es war von seinen Augen abzulesen, dass er sich darin erinnert, wie ein Bus ihm sein Herrchen und sein Frauchen wegnahm. Es war eine herzzerreißende Szene. Dann sahen wir, wie das Vieh, das den Kolchosen angehörte, in Richtung Weißrussland, wahrscheinlich nach Polisske, getrieben wurde. Den Bauern, die das Vieh besaßen wurde gesagt, sie sollten ihre, sagen wir, Kuh auf einen Landwirtschaftsbetrieb bringen und dort binden, weil es später ein Wagen kommt, der das ganze Vieh wegnimmt. Und so sahen wir ein paar gebundene Kühe stehen. Ihre Euter waren schon dunkelblau…
N.K.: Oho.
P.P.: …und angeschwollen. Eine der Kühe stöhnte sogar. Mein Fahrer kam aus Gottwald, dem heutigen Smijow. „Darf ich die ausmelken?“ fragte er. Ich sagte: „Spinnst du oder was?“ Ich dachte nämlich, er wollte etwas Milch zum Trinken bekommen. „Ich werde die auf die Erde ausmelken. Du siehst doch selber, wie sie sich quält!“ Als er die Kuh ausmelkte, atmete sie erleichtert aus. Können Sie sich so was vorstellen? So eine Kleinigkeit, die in Wirklichkeit viel bedeutete.
N.K.: Der Trieb, einem Tier zu helfen?
P.P.: Genau. Ihr Euter schimmerte, war schon hellblau und voll Milch, es gab aber niemand in der Nähe, der die ausmelken würde. Für das Tier war das eine große Qual. Der Mann melkte die also aus, und das brachte der Kuh eine gewisse Erleichterung. Wann diese Kühe abgetrieben wurden, weiß ich nicht. Oder wurden sie in Wirklichkeit nicht abgeholt und mussten dort sterben, wo sie angebunden waren… Na ja, sonst gab es nichts Herausragendes zum Prahlen. Ich würde nicht sagen, dass wir dort Heldentaten begangen. Es war eine ganz normale Arbeit mit viel Routine. Es gab natürlich Fälle, da Menschen mogelten, gaben vor, es ginge ihnen schlimm und baten sie irgendwohin zu holen. Sonst gab es keine Anfälle. In Charkiw gab es fast bei jeder Schicht Anfälle und Herzinfarkte, da drüben wurde ich mit keinem einzigen Herzinfarkt konfrontiert.
N.K.: Klar.
P.P.: Entweder wirkte sich die Extremität der Situation aus, da der Mensch auf Gesundheitsprobleme nicht achtet, oder wurden nach drüben ziemlich gesunde Menschen geschickt. Jedenfalls wurde ich nie mit Herzinfarkten konfrontiert. Was ich aber behandeln musste… Es ist mir eben ein Zwischenfall eingefallen. Es kamen aus Donezk Bergarbeiter, die unter dem Reaktorblock eine Untergrabung machen, darin flüssigen Stickstoff einleiten und ihn kühlen sollten. So. In Details gehe ich nicht ein. Die hatten also Spiritus mit. Aus den mir unbekannten Gründen fanden sie Germerlikör und tranken es, jeder je eine Flasche. Es sei aber zu erwähnen, dass dieses Germerlikör tatsächlich ein Gift ist, das auf Nieren so stark einwirkt, dass die Nieren zusammenschrumpfen…
N.K.: Oho.
P.P.: …und natürlich versagen. Wir schafften es aber, die zu retten…
N.K.: Und warum fiel es denen ein, Germerlikör zu trinken?
P.P.: Weil er gut roch. Eigentlich wird Germer in der Tiermedizin zur Bekämpfung beißender Schädigungsinsekten angewendet. In einem Eimer Wasser wird normalerweise eine Flasche Germerlikör gelöst und es wird darin ein Besen getaucht. Die Flüssigkeit wird der Kuh ins Fell eingerieben. Das Likör hat wirklich einen angenehmen Geruch und… 70 Grad Stärke. Das lockte eben die Jungs an. Wir schafften es, die dem Tode aus den Händen zu reißen. Ich arbeite mit Ljuda Iwanowa und Kolja, Nikolaj Repa, Nikolaj Iwanowitsch Repa, mit.
N.K.: Pflegen Sie jetzt freundschaftliche Beziehungen zu den Menschen, mit denen Sie damals zusammenarbeiteten?
P.P.: Sicher. Wir sind alle befreundet. Die Ljuda Iwanowa ist großartige Frau. Ehe sie aus Afganistan zurückkehrte, ging sie mit uns nach Tschernobyl (P.P. lacht). Sehen Sie, die Notärzte sind eigenartige Menschen. Vor allem haben wir tatsächlich keine Unterordnungsverhältnisse. Genauso wie zum Beispiel bei Milizisten, bei denen ein Sergeant einen Obersten duzen kann. Der Arzt, der Fahrer, die Krankenschwester und der Sanitäter sind ein Team.
N.K.: Aha.
P.P.: Und wir haben familiäre Verhältnisse. Ist die Krankenschwester sehr jung und der Arzt etwa 50 Jahre alt, dann siezt sie ihn natürlich. Aber statt ihn mit beispielsweise „Nikolaj Iwanowitsch“ anzusprechen, sagt sie „Onkel Kolja“. Es ist also eine ziemlich spezifische Arbeit.
N.K.: Waren Sie von Ihren Freunden und Bekannten irgendwie anders behandelt, als Sie von der Dienstreise zurückkamen? Auf der Arbeit waren vielleicht alle …
P.P.: Ganz im Gegenteil, es kam eben auf der Arbeit zu peinlichen Situationen.
N.K.: Echt?
P.P.: Als wir nach drüben im Mai fuhren und dann zurückkehrten, wusste niemand, wie es bezahlt werden soll und wie es wahrzunehmen ist. Ob es eine Dienstreise, ein Urlaub oder so was in der Art ist. Für jeden Tag der Dienstreise sollte jeder von uns jedenfalls den sogenannten Dienstreisenzuschuss in Höhe von 3 Rubeln 80 Kopeken erhalten. Doch als wir nach drüben gingen, brachten wir sehr viele Medikamente sowie viel Verbrauchstoff mit. Dazu noch mussten wir da drüben die Wagen verlassen.
N.K.: Aha.
P.P.: Als wir zurückkehrten, wollten wir die Kästen füllen, mit denen wir Kranke besuchten. Wir wurden mit Bussen in Krankenhaus Nr. 4[16] gebracht, wovon jede Notfallstation ihre Mitarbeiter abholte. Als ich an den Schalter kam, sah ich daran Raissa Iwanowna (der Familienname ist mir schon entfallen), die als Disponentin arbeitete, obwohl sie vom Fach Krankenschwester war. „Weg von mir! Du bist ansteckend! Mein Enkelsohn Roma ist noch klein, es fehlt noch, dass er kontaminiert wird!“ Und das brannte mir ins Gedächtnis ein. Ihr Worte bedeuteten etwa „Geh weg, wir wissen doch alle, wo du war!“ … Doch was meine Nachbarn und meine Familie angeht, waren sie davon, wo ich war, gar nicht beeindruckt. Als ich zurückkehrte, wurde mein älterer Sohn zum Pflichtwehrdienst einberufen.
N.K.: Aha.
P.P.: Er musste in Karelien[17] dienen. So gingen meine Frau und ich nach Karelien, um seinem feierlichen Gelöbnis beizuwohnen. Damals ging es mir noch gut. Nach Hause gingen wir über die Stadt Kem. Ich ging auf den Bahnhof Fahrkarten lösen. Ich hatte den mir kurz vorher erteilten Schein, wo es geschrieben stand, dass ich mich an der Bewältigung von der akuten Periode der Havarie beteiligt habe und berechtigt bin, außertourlich in Hotels unterbracht zu werden und Fahrkarten für alle Verkehrsmittel zu erwerben, und so was in der Art. Als ich diesen Schein vorwies, trat die Kassiererin heraus, um den Menschen zu sehen, der in Tschernobyl war (P.P. lacht). Zuerst kapierte sie nicht, wo Tschernobyl liegt, doch sie wusste, dass es sich um die Ukraine handelt. Auch unter den Holzhauern, die mit uns „ins Festland“ gingen, genoss ich große Popularität: Es gab sehr viele Fragen über Tschrnobyl.
N.K.: Es war doch sicher spannend, alles von einem Zeitzeugen zu erfahren…
P.P.: Aber wie. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, der in Tschernobyl war und der aus Tschernobyl heil und gesund zurückkehrte… Doch im Februar 1990 gab es schon den ersten „Fingerzeig“. An dem verhängnisvollen Tag wurde ich während des Besuches eines Patienten ohnmächtig.
N.K.: Hoho!
P.P.: Tja, ich wurde ohnmächtig.
N.K.: Sie kamen den Patienten ins Krankenhaus abholen, wurden aber selbst ohnmächtig (N.K. lacht)?
P.P.: Seit dem Tag fingen Aufnahmen bei Krankenhäusern, Behandlungen und so was in der Art an… Ich versuchte, den Patienten zu untersuchen, wurde aber selber ohnmächtig. Ich erinnere mich, wie ich mich zu ihm bückte. Ich wollte nämlich seinen Blutdruck messen, seine Lungen und sein Herz abhorchen, fiel aber ganz unerwartet, womit ich den Patienten bis ins Mark erschrak (P.P. lacht).
N.K.: Und das, obwohl der Patient ohnehin erschrocken war. (N.K. lacht).
P.P.: Dann kamen meine Kollegen und holten mich ab. Und dann wurden wir mit diesen Erkrankungen konfrontiert. Es war eigentlich seltsam. Seit mehr als 19 Jahren bin ich stellvertretender Präsident des regionalen „Verbandes Tschernobyl“. Dort war übrigens mein Büro. Also, innerhalb der ersten 5-8 Jahre nach der Katastrophe starben waren etwa 40-70 Personen, während des drauffolgenden Jahre überschritt die Zahl der Verstorbenen die 200-Schwelle und hielt einige Jahre bei 200 Personen stabil. In den letzten Jahren (im Jahr 2013 zum Beispiel) starben…
N.K.: Welchen Zeitraum meinen Sie?
P.P.: Ein Jahr. Innerhalb eines Jahres.
N.K.: Aha, klar.
P.P.: In Charkiw und der Oblast Charkiw… Also 2013 zählt nicht. Innerhalb sieben Jahre, vor 2012 lag die Zahl der Verstorbenen bei 300, genauer gesagt, bei 330 bis 337 Personen.
N.K.: Allem Ansehen nach…
P.P.: In diesem Jahr waren es schon 203, genauer gesagt waren es im Jahr 2013 203 Personen. Wir verlassen also langsam diese Welt, die Zahl der Zeitzeugen nimmt ab, neue Zeitzeugen gibt es selbstverständlich nicht. Es tut mir wahnsinnig Leid wegen jener Jungs, die sterben mussten. Die schienen alle jung und gesund zu sein. Doch in der letzten Zeit werden schon manche von uns durch solche Tode nicht mehr überrascht.
N.K.: Na ja.
P.P.: Wissen Sie, wir nehmen es so wahr… Na ja, es tut natürlich Leid, bei jeder solchen Nachricht presst man sich natürlich eine Träne heraus, doch die Sache ist die, dass wir uns an die Tode unserer Kameraden schon einigermaßen gewöhnt haben. Es klingt ja grauenhaft, doch es ist wahr.
N.K.: Wie meinen Sie, was hat zu dieser Havarie geführt? Viele sagen, es seien die allgemeine Eile und die Nachlässigkeit schuld… Was halten Sie davon?
P.P.: Wissen Sie, ich hatte einmal bei einer Regierungskommission Bereitschaftsdienst. Dort gab es auf Basis von Sanitätsstelle Nr. 116 eine medizinische Hilfestelle. Dort hatten wir also Bereitschaftsdienst. Die Einheimischen hatten schon Feierabend und waren nach Hause gegangen. Wir legten eine Rauchpause an und gingen heraus. Es gab unter uns ein Regierungskommissionsmitglied – sein Familienname ist mir entfallen, doch soviel ich mich erinnern kann, war es kein russischer, sondern ein tatarischer Familienname. Man merkte es außerdem, dass er Asiat aussah. Also wir standen und rauchten. Und ich fragte die: „Könnt ihr wenigstens ein paar Worte darüber fallen lassen?“ Denn es wäre natürlich irgendwie peinlich, direkte Fragen zu stellen. Andererseits veranlasste diese lockere Situation zur Ehrlichkeit. Man hätte angeblich experimentieren wollen und ein Lager oder so was in der Art versetzen. Eine Platte sei sicherheitshalber daruntergelegt worden, doch es habe angefangen zu vibrieren. Die Grube, in die sich der Reaktor senkt, hätte 60 Meter tief sein sollen, wäre aber wegen des Grundwassers nur 27 Meter tief.
N.K.: Aha.
P.P.: So. Es wurde ein spezielles Beton eingegossen, das mit sechs Liftanlagen nach oben gebracht werden sollte. Man musste absolut synchron arbeiten, doch während der Arbeit wurde die Synchronität gestört. Und es drohte… … Es wusste niemand gleich, was los war. Aber die Sache ist die, dass als der Reaktor hochfuhr, stieg die Temperatur bis auf 1000 Grad. Da unten gab es Grundwasser, und obwohl es unten alles mit Beton begossen wurde, drang das Wasser raus. Es drohte eine Dampf- und Wasserstoffexplosion. Alle verstanden es angeblich. Die Sache wurde mit „Jelena“ bedeckt, einem riesigen 5 Tonnen schweren Deckel. Als es Explosion gab flog die 5 Tonnen schwere „Jelena“ etwa 200 Meter entfernt. Zuerst gab es die Dampf- und Wasserstoffexplosion, die an sich nicht besonders gefährlich war. Die echte Gefahr bestand darin, dass der Reaktorblock zerstört wurde und es sich um den Austritt radioaktiver Stoffe handelte und so weiter. Ich sah auch selbst die Emissionen…
N.K.: Also…
P.P.: …die orangenfarbigen Emissionen, genauer gesagt. In einer Entfernung hörte und sah man zuerst, und dann vernahm man einen Klaps. […] Ein paarmal sah ich das Aufleuchten. Manchmal mussten wir auch nachts arbeiten, irgendwohin gehen. Wiederum muss ich erwähnen, dass wir viel mehr als die Übrigen sahen. Na ja, ich war zwar nicht mit dem Spaten auf dem Dach des Kraftwerks eingesetzt, musste den „roten“ Wald nicht abhauen, ich machte zwar nichts Besonderes, aber ich musste aber ins Kraftwerk fahren. Manchmal kam ich viermal innerhalb eines Tages ins Kraftwerk. Manchmal brauchte ich dorthin nicht zu kommen. Nun wiederhole ich meine eigenen Worte, aber wir hatten gute 4000 Kilometer innerhalb der Sperrzone mit dem Wagen zurückgelegt. Und eines Nachts sahen wie also ein Aufleuchten. Es war lila und sah wie ein Pfosten aus. Es stand über dieser Spaltung. Wie hoch es war, kann ich nicht sagen, weil es in der Ferne sahen. Wir waren nicht nah und sahen es. Und es war kein Fluss, sondern eine Kühlanlage.
N.K.: Kapiert.
P.P.: Es war eine Kühlanlage. Wir sahen es aber von der Brücke aus. Was kann ich noch sagen… Wir begingen keine Heldentaten.
N.K.: Wie meinen Sie, haben diese Ereignisse die Ukraine im Großen und Ganzen beeinflusst? Hat man vielleicht bestimmte Konsequenzen daraus gezogen, was sich 1986 in Tschernobyl ereignete?
P.P.: Ich würde sagen, es wurden so gut wie keine Konsequenzen gezogen. Etwa 16 oder 18 Jahre nach der Havarie, als ich schon hier arbeitete, besuchte ich die Archive in Prypjat und Tschernobyl. Apropos, als wir Iwankowo hinter euch ließen und sich Tschernobyl näherten (wir fuhren selbstverständlich mit einem Wagen), empfand ich den bitteren, metallenen Beigeschmack im Mund und das Halskratzen. Es fiel mir ein, wie ich dorthin zum ersten Mal kam.
N.K.: Waren es eigentlich mehr Assoziationen als Empfindungen?
P.P.: Na ja. Und als wir ins Kraftwerk kamen, sprachen wir mit Herr Lichtorjow, der als Mitglied der Akademie der Wissenschaften dort damals für die Forschungsfragen zuständig war. Während des Mittagessens tranken wir je 100 Gramm Wodka. „Jungs“, sagte Herr Lichtorjow, „wenn, Gott bewahre, eine bestimmte Wassermenge zur richtigen Zeit am richtigen Ort reinfließt, dann wird euch das, was ihr 1986 taten, als Unterhaltungsreise vorkommen. Es bleiben nach den einen Einschätzungen 185 bis 187 Tonnen Brennstoff, nach den anderen Einschätzungen 205 bis 207 Tonnen Brennstoff unter den Ruinen liegen. Gut, wenn das alles unter den Ruinen aufgeteilt ist. Was wenn das alles angehäuft liegt und eine bestimmt Wassermenge darauf kommt?“
N.K.: Gott bewahre.
P.P.: „Das, was ihr 1986 taten, wird euch als Unterhaltungsreise vorkommen“, sagte er. Dann sagte er noch, dass der Staub, der an den Wänden des Reaktorblockes gibt – Moment mal! (P.P. flüstert jemandem etwas) – jener Staub wird zu einer breiartigen Masse und fließt nach unten, unterwegs alle Hindernisse herunterreißend. Die Oberfläche sieht danach schön aus. Dich was ist das denn? Ist das etwa ein mutiertes chemisches Element, ein neues Isotop?
N.K.: Mein Gott, wie grauenhaft!
P.P.: Es gibt noch viel Rätselhaftes.
N.K.: Verstanden. Ich wollte noch fragen… Oder haben Sie es schon eilig?
P.P.: Einigermaßen.
N.K.: Na gut.
P.P.: Sie können sich gerne meine Telefonnummer speichern. Rufen Sie mich dann bloß an und ich werde vielleicht was hinzufügen. Aber eigentlich weiß ich nicht, was es so hinzuzufügen gibt…
N.K.: Dann lieber noch ein paar Fragen mal kurz. Wie ist Ihre Einstellung zu den Exkursionen in die Sperrzone, die unter den Jugendlichen im Trend liegen? Denn manche sagen, es bestehe keine Gefahr mehr, die Sperrzone zu besuchen, während manche behaupten, es sei immer noch gefährlich, sich in der Sperrzone aufzuhalten.
P.P.: Den Menschen, der eine Exkursion dorthin vornimmt, würde ich gerne in ein paar Monaten danach sehen.
N.K.: Klar.
P.P.: Ich würde gerne so eine Person sehen. In die Augen würde ich nicht einmal gucken, denn das sind garantiert die Augen eines dummen Menschen. Hast du mal Lust auf Extremitäten? Kein Problem, geh mal hin…
N.K.: Klar…
P.P.: …geh dort wandern, töte einen Hasen, iss ihn… Wenn man kein Problem darin sieht, eine Gegend aus bloßer Langweile zu besuchen, wo Leute ihre Gesundheit verloren… die Landschaften zu bewundern, wo Menschen starben… wieso denn nicht? Es sind nicht einmal ein tausend Menschen, sondern 5 Tausend Menschen gestorben, deren Leben mit Tschernobyl auf diese oder jene Weise verbunden war, und es will jemand einen Touristen in diesem verhängnisvollen Ort spielen? Und sich dann als Helden präsentieren?
N.K.: Klar. Und noch eine Frage. Was halten Sie von den Gedenkmaßnahmen? Wie meinen Sie, sollten die besser oder ganz anders veranstaltet werden? Vielleicht sollten mehr Kinder miteinbezogen werden?
P.P.: Davon würde ich lieber nicht sprechen.
N.K.: Gut.
P.P.: Dafür gibt es einen Grund. Den besprechen wir am Telefon.
N.K.: Gut. Dann die letzte Frage. Neue Lehrbücher werden herausgegeben. Die Geschichte wird umgeschrieben. In 20 Jahren werden die Kinder von dem, was 1986 in Tschernobyl geschah, nur aus den Büchern erfahren. Wie sollten diese Ereignisse ihres Erachtens beschrieben werden? Sollen sie als bestimmte Erfahrung oder bloß als Zusammenfassung serviert werden? Was soll im kollektiven Gedächtnis bleiben? Was darf keineswegs vergessen werden?
P.P.: Erstens sollte man immer darauf achten, dass das Atom immer eben das Atom bleibt. Auch wenn es das „Friedensatom“ genannt wird. Damals hatten wir auch mit dem Friedensatom zu tun, doch es war das tobende Friedensatom. Man muss immer der Sache bewusst sein, dass energiesparende Technologien bei jedem Betrieb bis auf kleinste Details durchdacht werden müssen und dass vor allem die Sicherheit der Menschen berücksichtigt werden muss. Zweitens muss der Umweltschutz groß geschrieben werden, man muss dafür kämpfen und dafür sorgen, damit es nicht wie in einem alten Witz ist: „Opa, ist es wahr, dass es hier ein Kernkraftwerk gab? – Stimmt, mein Kind. Ich war damals noch klein. – Opa, ist es wahr, dass das Kernkraftwerk explodierte und viele Leben ums Leben kamen? - Ja, das stimmt. Mach dir doch keine Gedanken darüber, es ist schon längst vorbei. Der Opa streichelte den Enkelsohn an einem seiner Köpfe, und die beiden gingen weiter, ihre Hufe klappernd“. Natürlich gibt’s hier nichts zum Lachen (P.P. lacht). Natürlich ist das grausam. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass wir dort keine Heldentaten begangen. Manche Leute, die in Tschernobyl waren, nennen sich selbst Helden. Kann sein, dass sie Recht haben. Aber trotzdem. Wäre ich nicht stellvertretender Präsident des Vereins, würde ich ihnen gerne noch mehr erzählen. Nun aber möchte ich darüber lieber nicht sprechen.
N.K.: Gut.
P.P.: Alles, was sich um jene Gedenkmaßnahmen herum abspielt und so weiter und so fort… Das möchte ich lieber nicht besprechen. Vor 5-6 Jahren wurden solche Veranstaltungen wirklich großzügig durchgeführt. Heute aber ist von der Großzügigkeit keine Spur.
N.K.: Danke!
[1] Kleinstadt in der Oblast Charkiw.
[2] Kleinstadt in der Oblast Charkiw.
[3] Siedlung des städtischen Typs in der Oblast Kyjiw.
[4] Kleinstadt in der Oblast Kyjiw.
[5] Kleinstadt in der Oblast Kyjiw
[6] Ukrainisches Wort, das das Geld bedeutet.
[7] In der Sowjetunion fing das Schuljahr am ersten September an. Dabei war der erste September noch kein Schultag. An diesem Tag wurden für die Schulkinder und ihre Lehrer Feierlichkeiten veranstaltet, für die frischgebackenen Erstklässler gab es Einschulungsfeiern. Die mit dem ersten September verbundenen Schultraditionen blieben auch im postsowjetischen Raum erhalten.
[8] Sammelbegriff für die Staaten Lettland, Litauen und Estland, die bis 1991 der Sowjetunion angehörten.
[9] Als „Samosjoly“ („Selbstsiedler“) bezeichnete man während der Beseitigung der Folgen von der Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl Menschen die vor der Katastrophe die 30-km-Zone bewohnt hatten und nach der Evakuierung zurückkehrten.
[10] Gemeint ist das Alkoholverbot, das in der Sowjetunion 1985 eingeführt wurde und bis 1990 dauerte.
[11] Hausgebrannter Schnaps
[12] Damit ist die beliebte sowjetische Komödie „Operation „Y“ und andere Abenteuer Schuriks“ gemeint, die auch heutzutage in den Ländern des postsowjetischen Raums große Popularität genießt.
[13] Das heutige Turkmenistan
[14] Im Dezember 1988 erschütterte ein heftiges Erdbeben die damalige Armenischen Sowjetrepublik (das heutige Armenien). Während des Erdbebens kamen schätzungsweise 25 000 Menschen ums Leben. Bei der Beseitigung seiner Folgen waren wiederum die Menschen aus der ganzen Sowjetunion eingesetzt.
[15] Eines der größten und der bedeutendsten Forschungsinstitute der Sowjetunion und des heutigen Russland
[16] Krankenhaus Nr. 4 ist in Charkiw als Notfallklinik bekannt und gehört zu den größten Krankenhäusern der Stadt.
[17] Karelien (heute Republik Karelien) gehört heute der Russischen Föderation an und liegt tatsächlich an der Grenze zu Finnland.