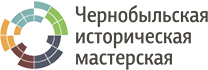Wladimir
Wladimir
- liquidator
Birth date:
Place of Birth:
Place of residence:
Time spent in the Chernobyl Zone:
Natalia Kozlowa (weiter N.K.): Also, heute haben wir den 8. Juli 2014, ich, Natalia Kozlowa, mache ein Interview mit… stellen Sie sich bitte vor.
Wladimir Livyi (weiter W.L): Ich heiße Liwyi Wladimir Nikolajewitsch, Geburtsjahr 1947, Bewohner von Charkow. Na also, heute bin ich schon 67 Jahre alt. Nun, was soll ich sagen? Das Jahr 1986 war für mich nicht so einfach, aus dem einfachen Grund, dass es das Jahr meiner Übersiedlung aus Odessa nach Charkow zu einem dauernden Wohnsitz war. So ist das.
N.K.: Und vorher, wie hat sich Ihr Leben gestaltet? Wo sind Sie geboren, was haben Sie gemacht?
W.L.: Geboren, geboren (lacht), na also. Geboren bin ich auf einer Insel, auf dem Polarkreis.
N.K.: Unglaublich.
W.L.: Die Insel heißt Kotlin, die Stadt heißt Kronstadt. Die Familie der Marinesoldaten: die Mutter war Militärärztin bei der Marine, und der Vater war Fregattenkapitän. Sie haben den ganzen Krieg bestanden. Die Mutter hat zwei Kriege bestanden: den finnischen und den Großen Vaterländischen. Und der Vater hat den Großen Vaterländischen Krieg im Verband der Baltischen Flotte bestanden. Er kämpfte gerade auf jenen Kampfeinheiten – es waren die Seejäger. Und die Mutter die Militärärztin, sie war im Spital in einer Brigade, einer zweiten Brigade von Minenräumschiffen. Das Spital befand sich in Leningrad auf der Wassiljewski-Insel. Nun, der Vater war in Kronstadt. Nun, in Kronstadt war ich 1947 geboren. Nun, es ist die Familie des Militärs, deshalb hing alles vom Vater ab. Der Vater wurde versetzt. Zuerst wurde er nach Nikolajew versetzt, dort haben wir nicht so lange gewohnt. Danach nach Sewastopol und, endlich, nach Odessa. In Odessa sind wir schon niedergelassen. Und seit 1950 bis 1986 lebte ich in Odessa. Habe den Schulabschluss gemacht, arbeitete, wurde an der Seefahrtshochschule immatrikuliert. Arbeitete an der Flotte in einem Expeditionsverband für Rettungs- und Tiefbauarbeiten. Zuerst war ich an Rettungsschiffen und danach an einem Schiffsheber. Habe vom ersten bis zum letzten Tag an der Epopöe von der Schiffshebung in der Nähe von Odessa teilgenommen. Wir haben „Mozdok“ gehoben. Damals war ich Kranbediener auf dem Kranhebeschiff „Chernomorez – 8.“ Nun dann ging ich an den Strand hinüber zu arbeiten. Arbeitete auf dem Strand als Maschineneinrichter.
N.K.: Aha.
W.L.: Damals hatten wir EWU-Maschinen mit einem einheitlichem System „Stanzyr“, damit war ich eigentlich beschäftigt. Nun, danach folgte eine Scheidung und 1986 im Februar zog ich nach Charkow um.
N.K.: Und waren Sie schon verheiratet und haben sich scheiden lassen, oder?
W.L.: Ja.
N.K.: Aha.
W.L.: Zuvor begegnete ich einer Frau in Charkow und beschloss, ein zweites Mal zu heiraten. Weswegen bin ich meinem Schicksal dankbar. Im Februar kam ich an und am 4. Mai… Gerade angekommen, fing ich gerade an zu arbeiten und die ganz unbekannte Stadt zu erschließen. Ich war zuvor noch nie in Charkow gewesen. Eine ganz neue Mitarbeiterschaft. Das heißt, dass ich weder Freunde noch Schulkameraden, niemanden, einfach nichts. Fing wieder an zu leben. Und plötzlich, um 12 Uhr nachts klingelte es an meiner Tür und man brachte mir eine Benachrichtigung: Ich sollte mich innerhalb von 15 Minuten fertigmachen und zum Sammelplatz kommen.
N.K.: Am Wievielten war es schon?
W.L.: Am 4. Mai.
N.K.: Aha, am 4. Mai.
W.L.: 1986. Man hat uns abgeholt, in einem Pionierpalast versammelt, in die Liste eingetragen, die Dokumente abgenommen, danach setzte man uns in den Bus und nach Sawinzy gefahren. Es ist in der Nähe von Barwenkowo bei Charkow. Und dort wurde eigentlich schon die Aufstellung von einem Feuerwehrbataillon durchgeführt.
[…]
N.K.: Aha.
W.L.: Wir hatten ein kleines Training dort im Laufe von drei, vier Tagen direkt in Sawinzy. Bei uns waren schon vorbereitete Feuerwehrleute – diejenigen, die in der Feuerwehr gedient haben, diejenigen, die in der Zivilarbeit eine Beziehung zu Feuerwehrleuten hatten. Da ich Retter war, war ich nämlich mit den Systemen der Schiffsfeuerarbeiten gut vertraut. Man vermittelte uns sowohl Fachkenntnisse, als auch bereitete man uns darauf vor, dass wir an den nicht so sehr einfachen Situationen teilnehmen werden. Es geht um Verstrahlung. Uns hat man Filme gezeigt, erzählt, wie man sich vor der Strahlung schützen musste, welche Methoden und Auswirkung es geben kann. Das heißt, man kann nicht sagen, dass gerade unser Bataillon dazu nicht bereit war, was dort in Tschernobyl passiert war.
N.K.: Aha.
W.L.: Wir waren bereit, uns hat man konkret eingewiesen und angezeigt. Und dann am 8. Mai wurde die ganze Technik zugeführt. Wir wurden in die Busse gesetzt, und die Technik wurde von den etatmäßigen Fahrern der Feuerwachen transportiert, aus denen sie geschickt wurde. Und wir fuhren nach Tschernobyl als Wagenkolonne los. Wir übernachteten irgendwo bei Lubny, fuhren über Kiew. Es war am 9. Mai.
N.K.: Aha.
W.L.: Der Tag des Sieges. In Kiew war ein ziemlich festliches Umfeld, die Menschen haben sich schön gemacht. Es gab sehr viele Jugendliche auf den Straßen. Die Mädchen hatten gewinkt, gelächelt, schrien verschiedene Glückwünsche. Unsere Fahrzeugkolonne war groß, bis zu 240 Wagen. Und auf den Bussen war die Aufschrift, dass sie aus Charkow sind. Und ältere Frauen und Männer, ehrlich gesagt, weinten. Sie wussten, dass der Unfall schon passiert war.
N.K.: Haben sie es damals verstanden, ja?
W.L.: Und wir verstanden auch, wohin wir fuhren. Und auch ältere Menschen, die schon den Krieg bestanden hatten, sie weinten. Das tat mir sehr weh. Danach wurden wir in Kiew an einer der Straßenkreuzungen geteilt, haben uns verlaufen, man hat die Teile von der Fahrzeugkolonne lange gesucht, endlich haben wir uns wieder zusammengeschlossen und sind bis zum Abend nach Iwankow angekommen. Wir wurden in einem Flusstal niedergelassen, man hat uns auf den Platz gezeigt, wo wir aufschlagen mussten. Das Komischste war, dass die Busse und andere Wagen noch da standen, aber wo sollte man schlafen? Das Bataillon wurde mit dem Höchststand ausgestattet, d.h. die ganze notwendige Ausrüstung dabei war, wir hatten auch Feldzelte, aber dummerweise verstand niemand sie aufzuschlagen. (lacht)
N.K.: (lacht) Es gab wahrscheinlich sehr viele Ideen, ja?
W.L.: Ja, es gab sehr viele ganz komischen Nuancen. Z.B., als man uns die Bekleidung, also die Felduniform, Khakihosen und Stiefel ausgegeben hatte. Nun sehe ich diese Fußlappen und weiß nicht, was damit zu tun ist. Nebenan sitzen Kerle und wickeln sich fesch auf die Füße. Und ich sage: „Männer, erklärt mir, wie man damit umgeht“. Sie lachen und sagen: „Hast du beim Militär nicht gedient?“ Ich sage: „Doch, aber an der Flotte gibt es keine Fußlappen“ (lacht). Nun keine. „Ähm, dann ist es ja klar“ (lacht). Irgendwie habe ich sie gewickelt, doch habe mir die Füße wund gerieben. Das Erste, was ich nach dem ersten Dienst im Kraftwerk gemacht habe, war, dass ich die Stiefel ausgezogen und weit weg in einen Treppenaufgang weggeworfen habe. Ich weiß nicht einmal, wohin dieser Treppenaufgang ging. Dahin habe ich geworfen.
N.K.: Wirklich? (lacht)
W.L.: Da hab´ ich es. Also hatten wir einen Sergeant, Witja, er war Grenzer. Ich kann mich an seinen Familiennamen nicht erinnern. Der Mann war einzigartig, er wusste und konnte alles. Und er hat geradezu allein, noch drei Männer haben ihm geholfen, und er sagte denen: halt und zieh hier. Er hat vier Zelte aufgeschlagen, d.h., wir hatten Unterkunft schon in der ersten Nacht.
N.K.: Ein Supermensch!
W.L.: Na ja. Wenn es irgendeine Probleme gab, gingen wir zum Sergeant und fragten ihn. Er wusste immer alles.
N.K.: Wahrscheinlich ist er ein Alleskönner?
W.L.: Ja, genau. Und wie es sich herausstellte… wir haben jeden Tag geduscht, die Strahlung ja, er war stark tätowiert. Ich stellte definitiv fest, dass er schon zweimal abgesessen hatte. Davor leistete er Wehrdienst an der Grenze. D.h., dass der Mensch alles wusste und konnte. Und als ich schon verstand, dass ich in den Dienst, ins Kraftwerk fahren musste, kam ich zu ihm heran und sagte: „Schneide mir die Haare kahl.“ - „Wieso denn?“ Ich antworte: „Weil ich in die Zone fahren muss.“ Das Haar bewahrt die Strahlung auf, deshalb ist es besser es loszuwerden. - „Na ja, es stimmt.“ Die Kollegen lachten mich aus, aber ich sagte: „Anstatt zu lachen, geht lieber euch die Haare schneiden lassen.“ Danach gingen alle und taten es wirklich.
N.K.: Woraus bestand der Dienst, standen Sie einfach da, oder?
W.L.: Nein. Die Tatsache war, dass als man uns schon nach Tschernobyl zu der Feuerwache gebracht hatte, war sie praktisch ganz mit hauptamtlichen Feuerwehrleuten besetzt. Wir galten als übrig, passten nicht hinein, da wir eine eigene Truppeneinheit waren. Und wir bekamen nicht einmal Platz innerhalb der Feuerwache, wo man übernachten könnte. Und darum haben wir unsere Zelte gerade auf dem Boden neben der Feuerwache aufgeschlagen. Wir hatten zwei Zelte: ein kleines und ein großes. So lebten wir. In der Feuerwache hatten wir nur eine kalte Verpflegung. Aber wie lange kann man sich damit ernähren? Einen, zwei und höchstens drei Tage, denn dort in der Feuerwache sorgte niemand für unsere Verpflegung, weil wir zur dortigen Verpflegung nicht gehörten. Das Einzige, was wir erbetteln konnten, war ein Glas Tee. Danach hatten wir uns mit einem General gestritten, wie es sich herausstellte, war er Chef der Politabteilung. Und solches Gespräch gab es, und um 14 Uhr hatte ich den Dienst angetreten und am Abend um 20-00 Uhr kamen wir vom Dienst zurück. Unsere Zelte waren schon vollständig mit Gummimatten gedeckt und bei uns waren schon Pritschen gemacht, sodass man schlafen konnte. Wir hatten ja auf dem Boden geschlafen. Und man fing an, uns warmes Essen in Thermoflaschen aus Iwankowo zu bringen. Es war sicher ein großer Unterschied.
N.K.: Waren Sie froh?
W.L.: Ja, klar. Es waren jene soldatischen Kleinigkeiten, die die Seele erfreuen, wenn man endlich das warme Essen bekommt. Ja, die kalte Verpflegung ist gut, aber das Warme ist besonders notwendig. Aber was den Dienst anging… Vor dem Dienstantritt hat der Stabschef eine Feuerüberwachung aufgestellt, die in den Dienst zum AKW ausfahren sollte, hat uns die Ziele und die speziellen Aufträge erklärt. Der Befehl wurde immer vorgelesen, dass die 30-km-Zone als Kampfbereich gemeldet wurde. Es galt das Regime der Kriegszeit, also Kriegszeitgesetze, und man musste den Befehlen schnell nachkommen und anderes mehr. Plündern wurde mit Erschießen bestraft. Und da gab es auch ein Alkoholverbot.
N.K.: Und hat niemand das Gesetz verletzt? Oder doch?
W.L.: Nun, jedenfalls bin ich solchem in der Zone nicht begegnet. Allerdings war es einmal. Während des Aufenthalts in der Zone bekamen wir die kalte Verpflegung zum Mittagsessen am AKW, solche riesigen Plastiktüten, großartige Lebensmittel. Es gab sogar Kaviar und Krabben, geschweige denn Hartwurst, Salami, Jagdwürstchen. Einmal haben wir sogar zwei Flaschen Bier in diesen Paketen bekommen. Ja, es war so was.
N.K.: Waren es zwei Flaschen insgesamt? (lacht)
W.L.: Nein, in jedem Paket.
N.K.: Ach so!
W.L.: Zwar gingen wir in den Bunker rauchen. Es gab dort einen Raum und wir sahen da die Metallkasten mit Weinflaschen „Cabernet“ stehen. Es gab einen großen Vorrat, aber ich wusste nicht für wen, uns hat man nichts davon gegeben. Es war neben den Räumen, wo Bergleute wohnten. Dort gruben sie die Tunnels und wohnten, arbeiteten in Schichten.
N.K.: Wahrscheinlich für die Bergleute?
W.L.: Nein, sie hatten auch Alkoholverbot, wobei ausschließlich. Sie arbeiteten dort in sehr schwierigen Bedingungen. Sie wurden so müde in der Schicht, dass keine Rede vom Trinken war. Sie sollten ja danach wiederum in die Schicht.
N.K.: Na ja.
W.L.: Es war kaum vorstellbar. Die Kerle arbeiteten, als wären sie verrückt, ja. Es gab Erdölarbeiter dort, Männer aus der Westukraine. Sie bedienten die Pumpen, die den Zellstoff vorbereiteten, und dieser Zellstoff wurde in diesem Emissionsbereich rund ums Kraftwerk geflutet. Eine Betonmischung, durch solche starke Röhre. Und diese Pumpen wurden von Bohrinseln gebracht, sehr stark. Sie konnten einen Druck von 200 atm geben. Das heißt, sie haben gut gepuscht. So. Und natürlich war unsere Aufgabe, vor allem den Brandschutz des Kraftwerks zu gewährleisten, zweitens Wasser den Bergleuten und Bohrern zur Verfügung zu stellen, entweder durch Zu- oder Ableitung.
N.K.: Aha.
W.L.: Wir hatten Leitungen gespannt, es gab Pumpstationen, in den Schleusen nahmen wir Wasser und leiteten es zu. Es wurde im Feuerlöschsystem des Kraftwerks selbst und auch auf diesen Bohrpumpen und von Feuerwehrleuten verwendet. Das war unsere Aufgabe, das heißt, es gab mehrere Verteilungspunkte mit Ventilen in meiner Kompetenz, große Hauptschläuche. Es gab eine Auffahrt, also baute man sogar eine Brücke mit 2 Autos und Feuertreppen. Und man legte die Hauptleitungen dorthin, um das Kraftwerk mit Wasser zu versorgen. Nun, hier war es unsere Aufgabe und das nächste – als wir den direkten Weg mit dieser Brücke blockierten und dort eine Auffahrt zum Kraftwerk um einen Hain machten. Ein kleiner Hain war vor dem Eingang. Und dieser Weg war auf einem bloßen Boden, das heißt, Staub stieg auf. Und es war immer noch unsere Pflicht zu wässern, diesen Staub zu löschen, so dass er nicht aufging, weil es ein sehr hohes Strahlungsniveau in der Nähe des Kraftwerks selbst gab, wo der Ausstoß lag. Es war möglich – mit einem Radiometer gingen wir und beobachteten – es war möglich, auf einen Splitter von etwa 200, 600 Röntgen zu springen.
N.K.: Aha.
W.L.: Deshalb hat man natürlich versucht, Posten in der Nähe dieser Verteilungsventile auszustatten, Geröll aufgeschüttet, um irgendwie ferner vom Boden zu sein. Ich erinnere mich nicht mehr, an welchem Tag Pflichtdienstsoldaten in diesen Hain gekommen sind, um eine Feldradiostation einzusetzen. Nun, wie es sich gehört – sie haben die Ausrüstung installiert, die Antenne aufgestellt, Spandrähte, alles fixiert, Hauptleitungen durchgelegt. Und sie hatten ihren Oberleutnanten, der ihnen noch befahl, Pfade auszurüsten, und sie kamen in der üblichen Soldatenuniform heraus, auch ohne Atemschutz, und mit den Spaten begannen sie, den Rasen abzutragen. Als ich das sah…
N.K.: Und warum gab man ihnen keine Atemschutzmasken oder wusste man einfach nicht?
W.L.: Nein, niemand hat... Als ich es sah, sprang ich zu diesem Leutnanten und sagte: "Was machst du?" Und wir alle trugen schon die Stationskleidung, alle mit Atemschutz, ich habe ein Strahlenmessgerät auf meinem Bauch. Ich sagte: "Schau dir hier die Strahlung an! Wohin hast du die Leute geschickt? Sie haben keine Überschuhe, keine Atemschutzmasken, keine Fäustlinge, warum musst du das tun?" Er schaute überrascht auf: "Es kann nicht sein, ist es wahr, dass die Strahlung hier so stark islt?" Ich sagte: "Ja, gerade hier ist die Verstrahlung sehr stark". - "Oh, und was soll man tun, wo sind die Überschuhe?" Ich sage: "Komm schon". Ich führte ihn ins Kraftwerk, zeigte eine Speisekammer, in der man Atemschutz nehmen kann, so viel man brauchte, Überschuhe und das alles, was…
N.K.: Also gab es da etwas, oder?
W.L.: Ja, er war so erfreut. Ich schaue, nach 15-20 Minuten gingen schon alle Jungs in Überschuhen und in Atemschutzmasken.
N.K.: Das wusste er nicht, oder?
W.L.: Nein, er wusste das nicht. Ich habe gesagt, wohin man geht, wo man duscht, jeden Tag, sagte ich, sollte man sich waschen und wenn möglich sich umziehen – die Kleidung wird dort ausgegeben. Lass deine Leute umkleiden, wenigstens die Unterwäsche. Und jetzt kommt dieser Oberleutnant oder Kapitän, ich erinnere mich nicht genau, etwa zwei Tage später zu mir und sagt: "Kommandant, man hat mir Bleiplatten aus der Zentrale gebracht, um die Ausrüstung vor Strahlung zu schützen. Ich habe auch ein paar davon für dich genommen, also lass deine Kerle kommen und sie abholen." So haben wir das, was wir hatten, miteinander geteilt.
N.K.: Gut gemacht.
W.L.: Ja, und das waren solche Platten, in Tischgröße, vielleicht sogar ein bisschen mehr, so dick und schwer. Zu viert konnte man sie kaum heben. Aber direkt auf diesen Kies hat man die Platten gelegt, Ventile gestellt, die Pfade waren schon so mehr oder weniger rein. Solcher Juri schleppte diese Platten sogar ins Cockpit, auf die Sitze, damit…
N.K.: Aha.
W.L.: Nun, ja, damit es weniger strahlt.
N.K.: Gut gemacht, ja.
W.L.: Es gab interessante Momente dort: Witja war ein leidenschaftlicher Fischer, und wo wir standen, war die Pumpstation, unsere Feuerwehrautos, der Schleusenstandort und die Schleuse, dort platschte der Fisch wie verrückt.
N.K.: Und was war mit ihm?
W.L.: Es war Mai, die Laichzeit. "Kommandeur, darf ich mal fischen?" Ich sage: "Nun, Witja, pass auf ..." Am nächsten Tag fand er irgendwo einen Haken, nahm eine Angelschnur.
N.K.: Ja?
W.L.: Ich sagte ihm, er könne den Schwimmer aus unserem Erste-Hilfe-Kasten bauen. Tabletten aus den Plastikkapseln wegwerfen, dann verschrauben – und hier ist ein Schwimmer. Kurz gesagt, war er zufrieden, nahm Brot mit und lief, und es gab eine Leiter von Schleusen nach unten und ein Eisenpontonchen, also zwei Fässer. Und dann nach etwa 15 Minuten hört man ihn schreien vor Begeisterung, er läuft und hält so hier auf der Linie, das würden Sie nicht glauben, eine derart breite Orfe. Schön, so drall, gerade wie ein Spiegel, zappelt. Ich sage: "Also, Witja, nur fasse nicht an, sie ist so in der Leitung, komm her." Er nähert sich, ich nehme den Stab des Radiometers, messe sie, sage: "Sieh mal, 60 Röntgen, nicht berühren, nimm sie so vom Haken ab und wirf ins Wasser zurück." Und seine Augen sind so, Freude, die Seele nämlich singt, zittert. Ich sage: „Jetzt, bitte, lass diesen Blödsinn, weil... nun…“
N.K.: Also, hat er vom Herz losgelassen?
W.L.: Ja, hat er. Er hat den Fisch losgelassen... Nun, vom Herzen ist ihm ein Stein gefallen, das ist die Aufregung, die abgenommen hat. Nun, alles war mehr oder weniger normal. Aber da waren so viele leere Flaschen im Wasser. Wir tranken nur Wasser aus Flaschen, nahmen es am Kraftwerk. Und da, jedes, das eingebracht wurde. Es gab "Essentuki", "Borjomi" und andere.
N.K.: Das heißt, dass das Wasser gebracht wurde?
W.L.: Ja, das Wasser war, aber in Glasflaschen, damals gab es keine Plastikflaschen. Und wohin mit den leeren? Also warfen alle sie von der Brücke in den Graben. Nun, sie schwammen. Ich erinnere mich, dass es viele leere Flaschen gab. Ich erinnere mich an den Fall, als eine neue Delegation hochrangiger sowjetischer Beamter zum Kraftwerk kam. Also fuhren sie mit einem Kleinpanzer, ich fand es später sogar im Internet – ich habe ein Foto von diesem Kleinpanzer. Dies ist Kleinpanzer mit einem absoluten anti-atomaren Schutz auf Raupenkette. Aber das einzigartige ist, dass es keinen gewöhnlichen Motor hatte.
N.K.: Es ist ein solcher Transport, ja.
W.L.: Kein Diesel... Ja. Weder Diesel noch Verbrennungsmotor, sondern ein Düsentriebwerk.
N.K.: Wahnsinn.
W.L.: Dahinter stand es so schräg. Das heißt, das Klirren von Raupen, die Bewegung von Raupen und das Gebrüll eines Düsentriebwerks waren zu hören. Das Gehirn wehrte sich so stark dagegen, es zu vereinigen, dass bis ich es mit meinen eigenen Augen sah, dass es sich bewegte und dass es ging, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es sein könnte.
N.K.: Jemand hat es erfunden.
W.L.: Ja, das Ding fährt, es hat eine kubische Kabine und fährt direkt auf die gerade Straße. Nicht auf einem Umweg, sondern in einer geraden Linie, da liegt die Brücke mit meinen Leitungen. Ich springe hinaus, ich komme so vor ihr her, ich sage: „Wohin fahrt ihr, Leute? Hier könnt ihr nicht, ihr schafft es nicht, ihr werdet meine ganzen Leitungen reißen“. Und es hatte ungefähr 4 oder 6 Antennen und solche starken. Da springen Kerle von den Seiten, und hinter ihnen fuhr ein Bus. Sie springen aus diesem Bus heraus – das waren die ersten Leute, die ich mit Waffen gesehen habe, mit Pistolen. Sie haben mir die Arme so schnell und zärtlich und eng verdreht, hoben und bewegten mich abseits und sagten: "Mensch, mach dir keine Sorgen, wir sind hier nicht zum ersten Mal. Alles läuft perfekt." Und sie hielten mich so fest, bis dieses Kleinpanzer durchfuhr. Wissen Sie, in der Tat ist es ideal unter diesen Brücken gefahren.
N.K.: Oh la la!
W.L.: Sie haben es so fein poliert. Ja, dann fuhren sie zu dem Ort, wo die Dekontamination bereits vor dem Eingang zum Kraftwerk abgeschlossen war. Aus diesem Kleinpanzer kam eine weitere offizielle Person heraus, ließ sich vor dem Kraftwerk aufnehmen.
N.K.: Na ja. Eine klare Sache.
W.L.: Ja, es ging dann irgendwo in die Nachrichten, oder auf jeden Fall erhielt jeder von ihnen später den Liquidatorenstatus. Also gingen sie dorthin, ins Kraftwerk, wo auch alles desaktiviert war. Das heißt, ihr Aufenthalt am Kraftwerk war buchstäblich 3 Minuten, an der Luft. Und dann in einem geschützten Raum. Aber so ein Fall war auch. Ein interessanter Fall war. Wir fuhren einmal zum Kraftwerk, Dienst zu tun. Zuerst wurden wir in einem Schützenpanzerwagen gebracht. Der Fahrer war ein Junge, er, nun, vielleicht hatte er sehr viel Angst. Ich weiß nicht warum, aber er hat die gesamte Belüftung überhitzt. Das heißt, die Luftzufuhr zum Schützenpanzerwagen. Das heißt, es gab nur die interne Belüftung. Und als wir dort in Iwankow einstiegen und nach Tschernobyl kamen, konnten wir die Feldblusen, die Kleidung abnehmen und wringen.
N.K.: Und wieso hat er das gemacht, wegen des Staubes?
W.L.: Er hatte Angst, dass der radioaktive Staub eingesogen werden könnte.
N.K.: Ach so, klar.
W.L.: Denn uns hat man einen eindeutigen Befehl gegeben, bei einer Panne oder einem Unfall auf der Straße sollte die Technik so stark wie möglich an den Straßenrand gedrückt werden – keine Reparatur am Ort. In die Mitte der Straße gehen, so, in jede Richtung autostoppen und wegfahren. Und schon nachts lief eine Spezialbrigade, sammelte die kaputte Technik auf eine Pritsche mit einem Kran und brachte sie zu Reparaturplattformen… Und eines Tages fuhren wir zum Kraftwerk und so stand am Straßenrand ein Auto, und die Leute standen da und winkten mit den Händen. Wir sahen so. Ich schaute durch die Kommandantenkuppel – sie hatten einige Kisten, Federmäppchen, Stative. „Nun, steigt ein. Wir fahren zum Kraftwerk.“ Sie stiegen ein, etwa zu viert. Mit allen Kisten. Es stellte sich heraus, dass dies eine Filmemachergruppe von „Minatomenergo“[1] war. Und sie drehten buchstäblich vom ersten Tag an. Und das war eine kurze Pause für sie, sie nahmen das Material in das Kiewer Studio für die Entwicklung. Und sie sagen: "Leute, ihr werdet es nicht glauben, also haben wir die Kamera geschützt, alles geschützt, damit der radioaktive Staub nicht kommt. Als wir die Filme entwickelten, waren sie fast alle belichtet. Weil wir die Boxen mit dem Film direkt auf den Boden gestellt hatten.“
N.K.: Ach!
W.L.: Es war alles…
N.K.: Die ganze Arbeit war umsonst.
W.L.: Und so viel einzigartiges Material ist verschwunden. Nun, sie haben einfach nicht darüber nachgedacht.
N.K.: Na ja.
W.L.: Und wenn man sich Filmaufnahmen anschaut, keine digitalen, sondern Filme jener Zeiten, kann man auf dem Film sehen, wenn die Strahlenkörner wie Sonnenflecken fallen, Blitze. Dies ist genau der Fall… Dann war eine Epopöe…
N.K.: Und bis wann waren Sie dort?
W.L.: Ich war dort vom 11. bis zum 16. Mai, im Dienst am Kraftwerk. Am 14.05 war ein sehr interessanter Fall. Hier ist, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Die ganze Zeit, als wir dort waren, wurde dieser Reaktorkollaps mit Glimmersäcken bedeckt, mit einer Mischung von Helikoptern. Dieser Hubschrauberlandeplatz war gegenüber unserer Feuerwache in Tschernobyl. Da war eine Sondermischung, Bleikugeln und Glimmer, Sand und Lehm und noch etwas Bindendes. Die Säcke waren größer als ich, so groß. Und so haben die Hubschrauber zuerst je einen Sack getragen und dann je zwei Säcke. Und die Hubschrauber gingen immer paarweise. Hier sind unsere Mi-8s. Und so habe ich ein solches Bild gesehen: Wenn sie anfliegen, kommen sie gegen den Wind. Und sie gingen nacheinander. Hier kommen sie auf den Kampfkurs, der erste Helikopter hat gezielt und abgeworfen. Abgeworfen, die Säcken sind nach unten geflogen, der Helikopter vorwärts, hat den Reaktorbereich verlassen und der zweite bleibt auf dem Kampfkurs, kommt zu diesem Reaktor. Zu diesem Zeitpunkt fallen die Säcke auf eine schwache Sperre. Und von dort geht ein verrückter Auswurf. Dieser braun-orange Rauch hat ungefähr 40 Meter im Durchmesser, na ja, und ist etwa 80 Meter hoch gestiegen. Und in diese Säule ist der zweite Hubschrauber hineingeflogen. Er ist nicht ausgewichen, er hat die Säcke genau an seinem Punkt abgeworfen und erst dann weg. Was dann mit diesen Kerlen passiert ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
N.K.: Na ja.
W.L.: Aber ich hab´ es gesehen. Sie konnten ausweichen, sie konnten abziehen, sie sind nicht ausgewichen, sie haben ihre Säcke abgeworfen. Genau in dem Punkt.
N.K.: Wahnsinn.
W.L.: Wen ich danach auch gefragt habe, habe ich es nicht geschafft, das Schicksal dieser Kerle herauszufinden. Es gab eine Menge Hubschrauberpiloten, mit denen ich gesprochen hatte, aber konkret…
N.K.: Es ist ja normal, man kann ja alle nicht kennen.
W.L.: Ja, konkret kann ich diese Menschen nicht kennen. Aber das habe ich mit meinen Augen gesehen – als sie von einem Auswurf aus dem Reaktor erfasst wurden. Gerade der zweite Hubschrauber.
N.K.: Das heißt, dass Sie am Atomkraftwerk waren, und dann lebten Sie noch eine Zeitlang in der radioaktiv verseuchten Zone?
W.L.: Nein, wir lebten die ganze Zeit in der radioaktiven Zone – es ist Tschernobyl.
N.K.: Na ja.
W.L.: Und dazu fuhren wir noch zum Atomkraftwerk zum Dienst.
N.K.: Na ja.
W.L.: Es war meine Zeit im Dienst. Und dann war unser Basislager in Iwankow. Es ist außerhalb der Zone.
N.K.: Ach so, verstanden.
W.L.: Es war außerhalb der Zone.
N.K.: Und wie lange standen Sie in Iwankow?
W.L.: Wir standen lange, denn wir wurden später ersetzt und der zweite Bataillonbestand war noch lange dort. Iwankow wurde als saubere Zone betrachtet, weshalb alle Übersiedler dorthin gebracht wurden, das war der nächste Punkt außerhalb der Zone. Also ging ich durch die Stadt, und wir wurden ins Krankenhaus geschickt, um Blutproben entnehmen zu lassen. Und da sah ich diese verlorenen, verwirrten Frauen verschiedenen Alters, die herumgingen. Eine kleine Handtasche in den Händen, ein Trägerkleid, eine Bluse und Hausschuhe und sonst nichts.
N.K.: War es in Iwankow?
W.K.: Ja, in Iwankow.
N.K.: Na ja.
W.L.: Sie sagte: „Uns hat man gesagt, dass wir morgen nach Hause zurückkehren werden. Ich habe nichts mitgenommen.“ Und sie hatte wirklich kein Geld, nur irgendwelche Ausweispapiere dabei. Weder Kleider noch Wechselschuhen, nichts. Keine Unterkunft. Sie erwartete wirklich, dass sie zurückkommen wird. Und in diese Augen konnte ich nicht einfach so sehen. Es hat so die Seele geklemmt. Danach, als bereits in Charkow dieses Geschwätz, Epos umging, dass „hier, das sind solche Evakuierten, lügen sie alle, ziehen sie alles heraus.“ Aber ich sah diese Menschen ohne Heimat, ich weiß ja, was sie erlebt haben, was es ihnen gekostet hat. Es tut mir wirklich leid für sie bis zum heutigen Tag… Nun, und die Raffer, sie waren immer und überall da: in jedem Volk, bei jeder Macht…
N.K.: Und betreffend Medizin, medizinisches Personal, wie wurde die Hilfe überhaupt geleistet? Gab es wahrscheinlich eine Behandlungsstelle, ja, wohin man im Notfall gehen könnte?
W.L.: Zuerst werde ich so sagen. Der Schutz war, was vorgesehen war, das heißt, wir hatten unsere militärischen Atemschutzmasken und Schluss. Der Rest des Schutzes, den wir benutzten, war im Kraftwerk. Überschuhe haben wir nicht getragen, nur Atemschutzmasken, so genannte "Blätter". Aus Gaze, sehr bequem. Und natürlich – Waschen, jeden Tag. Sich jeden Tag waschen. Hast du einen Dienst gehabt, gehst du dorthin, in die Dusche. Du wechselst komplett deine Kleidung, bekommst alles neu, schon desaktiviert: Schuhe, Oberbekleidung, Unterwäsche, alles, alles. Jeden Tag. Auf dem Kraftwerk erhielten wir Speichergeräte, die den Grad der Strahlung bestimmten, d.h. die Dosis, die du erhältst, wenn du es mithast. Aber, wie es sich herausstellte, wurden uns die Speicher selbst, sagen wir, von der "B"-Reihe ausgegeben und die Stände für ihre Verifizierung und Aufladung von der "A"-Reihe.
N.K.: Aha.
W.L.: Das heißt, sie waren nicht kompatibel, man konnte diese Speichergeräte weder überprüfen noch erneut aufladen.
N.K.: Na ja, nutzlos.
W.L.: Das heißt, sie... diese Stifte waren nur zum Schein. Dann gab man Filmspeicher aus, nun ja, auch sie... Ich weiß nicht, wir hatten keine solche Kontrolle.
N.K.: Verständlich.
W.L.: Ja, man hat uns in diesen Büchern geschrieben. Wir hatten spezielle Bücher, in denen die Strahlungsdosis geschrieben wurde. Aber das wurde nach den Daten der Stabsradiologen aus der Zentrale geschrieben. Also gaben sie diese Zahlen, und unsere Kommandeure stellten diese Zahlen in unsere Bücher. Wie sie berechnet haben – ich weiß es nicht, weil ich mein eigenes Radiometer hatte, ich habe andere Zahlen ausgerechnet.
N.K.: Und wenn es jemandem übel wurde, an wen konnte man sich wenden? Konnten Sie irgendwie medizinische Hilfe anfordern oder nicht?
W.L.: Gar nichts. Das Einzige war, man konnte eine Krankenschwester schicken, so. Wie es unserem Oleg Malyschew nach dem Löschen eines Feuers am 23. Mai schlecht wurde. Nun, man gab ihm Ammoniak.
N.K.: Ach, na ja.
W.L.: Und etwas gegen Übelkeit und Schluss. In der Zone selbst gab es nichts. Es gab immer noch ein Epos mit dem Auslöschen dieses Feuers, ich habe das vergessen.
N.K.: Könnten Sie es erzählen?
W.L.: Es war bereits, nachdem wir im Dienst abgelöst worden waren, das heißt, wir haben unsere Strahlendosis bereits erhalten. Und wir waren bereits in Iwankow, gut, so, als Nachhilfe, um etwas Wachdienst zu tragen. Nun, im Grunde hat man uns nicht berührt. Wir waren bereits in der Atomkraftwerkkleidung, quasi im Zivilzustand. Trotzdem, als wir in Iwankow gingen, werde ich Ihnen ehrlich sagen, war ich sogar erfreut, dass ich mit Feuerwehrleuten zu tun hatte, weil alle Leute, absolut alle uns mit großem Respekt behandelten. Es war so berührend und angenehm, dass ich mich immer noch an dieses Gefühl erinnere. Nun, ich fühlte mich, als wäre ich mit den Leuten zusammen, die in jener Nacht gestorben waren. Es war allen schon bekannt. Und wir haben sie abgelöst, wir waren dort, an denselben Orten, in denselben Räumen. Wir gingen, um das Niveau der Überschwemmung in diesen Kellern zu überprüfen, wo sie Wasser beim Löschen gegossen hatten. Und da war der Hintergrund von über 3000. Wir haben eine Technik ausgearbeitet, wie man es auspumpen kann, das Wasser. Haben dafür eine Dankbarkeit des Ministers für Innere Angelegenheiten der Ukraine erhalten.
N.K.: Gut gemacht.
W.L.: Also, am 23. Mai klingt das Alarmsignal. Hektik überall. Meine Jungs wachen auf: „Kommandeur, was tun?“ Ich sage: „Na, Alarm heißt Alarm, alle sollen gehen“. Also gehen wir raus. Alle laufen durcheinander. Ich komme zum Bataillonskommandeur und frage: „Aber was sollen wir tun? Unser Dienst ist schon vorbei, unser Fahrzeug auf dem Endlager, schon fertig“. Er sagt: „Dann nehmt ein Ersatzfahrzeug und fahrt nach Tschernobyl“.
N.K.: Und wo waren Sie dann?
W.L.: In Iwankow.
N.K.: Ach, schon in Iwankow. Na ja.
W.L.: Das war schon in Iwankow, wir waren mit unserem Dienst schon fertig. Ich sage doch, wir waren quasi Nachhilfe des Wachdienstes. Wir steigen in ein Ersatzfahrzeug, fahren los und direkt nach Tschernobyl. Und ich bin gerade nach dem Dienst, kenne alle Rufzeichen. Ich setze mich mit dem Feuerwehrstab Tschernobyls in Verbindung: „Strand, Strand, hier ist Fluss so und so“, habe die Fahrzeugnummer genannt. „Ich bin aus Iwankow unterwegs. Wie lauten die Anweisungen?“ Ich höre: „Das Kraftwerk direkt anfahren, dem Wachhabenden zur Verfügung eintreten“. Das war´s, man hat nur zugefügt, wir sollen irgendwo unterwegs einen Stopp machen, um den Chemikalienschutz anzuziehen.
N.K.: Aha.
W.L.: Nun irgendwo bei Tschernobyl haben wir Halt gemacht, den Schutz angezogen und sind zum Kraftwerk gekommen. Ausgestiegen, da ist der Dienstherr zugelaufen. Und wir sind alle in den Schutzanzügen, niemand ist zu erkennen. Er befiehlt: „Rasch je zwei Schläuche und folgen“. Wir nehmen also diese zusammengerollten Schläuche mit und gehen weiter. Man hat uns dorthin, in den Bereich des 3. Blocks gebracht. Gänge, dort haben wir die Schläuche ausgerollt, noch eine Leitung angeknüpft. Und er sagt: „Das nächste Paar geht dorthin“, und erklärt jedem, wohin zu gehen, wo stehen zu bleiben und wohin zu gießen. Danach wechseln und einem weiteren abgeben. Als wir dorthin gelangten, war das Löschen noch im vollen Gang. Ich sollte länger stehen, weil ich mit einem Scheinwerfer mit einem Akkumulator schien. Danach sind wir rausgegangen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist, es war ja in der Nacht. Aufstellung im Korridor… Witja Morgun, der Dienstältere, sagt: „Also, Leute, ihr geht runter, ins Kraftwerk. Ich brauche nur zwei von euch, die hier bleiben und von Zeit zu Zeit dorthin laufen und prüfen, ob es eine neue Entzündung gibt oder nicht.“
N.K.: Aha.
W.L.: Und dann geht er die Wand entlang, sieht mich an und sagt: „Zieh mal deine Maske ab“. Ich ziehe sie ab, sobald er mich erkannt hat, flucht er: „Zum Teufel, ihr habt doch eure Strahlungsdosis schon gekriegt, euer Dienst ist doch zu Ende! Wieso bist du hier?“ Ich sage: „Na, der Befehl, also bin ich hier“. Es stellte sich heraus, alle, die schon im Kraftwerk Dienst gemacht hatten, wurden in Tschernobyl eingehalten. Sie blieben in der Feuerwehrstation und diejenigen, die im Kraftwerk noch nicht gewesen waren, fuhren zum Kraftwerk fort. Und mit mir ist es so geschehen (lacht). Ich wurde mit Schimpfworten voll gestopft (lacht) aber es war nichts mehr zu tun.
N.K.: Na ja.
W.L.: Nun, wir gehen nach unten, draußen neben dem zentralen Kraftwerkeingang. Und Kolja Najda, mein Unterstellter, fragt: „Kommandeur, wie lange waren wir dort?“ Ich: „Ich weiß nicht, du hast nämlich eine Uhr. Hast du sie nicht gelassen?“ Und bevor wir in die Zone fuhren, ließen wir alle Metalldinge, Uhren, Ringe, so. Er sagt: „Nein, nicht“. Und er hatte eine Digitaluhr. Ich sage: „Dann guck mal“. Er guckt und sagt: „Kommandeur, du wirst nicht glauben: 99 Stunden 99 Minuten“. Also war die Elektronik… (lacht)
N.K.: Völlig aus. (lacht)
W.L.: … hat total versagt.
N.K.: Hat nicht ausgehalten. (lacht)
W.L.: Ich sage: „Kolja, lass den Quatsch, nimm das ab und wirf in den Kanal, trag das nicht“. Und so war seine Scheidung mit dieser Uhr. Danach suchten wir lange, womit nach Tschernobyl, in die Feuerwehrstation zu fahren. Dann stiegen wir selbst in ein Auto ein, fuhren selbst nach Tschernobyl. Aus der Station wurden wir in ein anderes Ort eingewiesen, dort stand eine Schule. Es stellte sich heraus, wir waren dort untergebracht worden. Nun, es wurde schon später organisiert. Die Leute wurden aus Zelten in normale Wohngebäude umquartiert. Dort blieben wir eine Weile. Damals erschienen schon Mediziner. Sie entnahmen Blutprobe und das war´s. Dann fuhren wir nach Iwankow. In Iwankow sollten wir Blut für die Analyse in einem lokalen Krankenhaus abgeben. Aber die Ergebnisse… Es gab einen Wirrwarr, völlig unklar. Und eines schönen Tages wurden wir in ein Hospital abgeholt. (lacht) Gerade meine Mannschaft, weil wir am meisten bestrahlt waren.
N.K.: Das heißt, die gesamte Mannschaft wurde ins Hospital abgeholt?
W.L.: Ja. Also kommt der Bataillonskommandeur und sagt: „Wolodja, tu, was du willst, aber ihr sollt morgen im Hospital sein.“ Ich weiß selbst nicht, wie ich ihnen es erklären soll. Denn in Iwankow war es schon los mit diesem Zeug.
N.K.: Mit Alkohol?
W.L.: Ja, sie haben am Strand des Flusses gesessen. Ich komme, setze mich, wir trinken und ich fange an, sie einzureden. „Auf keinen Fall.“ Ich sage: „Leute, könnt ihr euch vorstellen? Wir werden 3 Mahlzeiten pro Tag haben, aus Tellern, nicht aus Kesseln. Man wird unser Geschirr spülen und wir werden jede Nacht auf einem weißen Betttuch schlafen.“ Dieses „weiße Betttuch“ hat sie fertiggemacht und auf die Schultern gelegt.
N.K.: Meinen Sie, sie haben sich totgelacht?
W.L.: Ja, sie lachten (lacht): „Jawohl, Kommandeur, alle auf einem weißen Betttuch, fahren wir“. Kurz und gut wurden wir am nächsten Tag in eine Sanitäter-UAZ gesteckt und ins Hospital nach Kiew gebracht.
N.K.: Ach so, es war in Kiew.
W.L.: Ja. Und dort war schon alles strikt. Erstens die Sanitätskontrolle gleich nach der Anmeldung, Verarbeitung, Sachen abgeben. Als wir bemessen wurden, stellte sich heraus, dass unsere Schilder und After je, glaube ich, 15 oder 20 Milliröntgen hatten. Also jeder. Wir wurden durch Abteilungen, Stockwerken verteilt. Alle in verschiedenen Plätzen aber wir haben uns zurechtgefunden. Und ich kann mich bis jetzt erinnern, uns hat man ein braunes Pulver gegeben, dabei in großen Mengen. Es sah wie gemahlener Torf aus. Brikette der Holzkohle – wenn man sie gemahlen hat, da sieht sie so aus. Und mit demselben Geruch. Wir haben es angenommen und buchstäblich nach zwei Tagen haben wir die Grundstrahlung in unserem Körper niedergeschlagen. Was für ein Pulver das ist, weiß ich nicht. Aber es sah so aus. Sehr viele Männer gab es im Hospital. Na, das war ja das republikanische Hospital des Innenministeriums, des Streifendienstes und der Staatlichen Verkehrsinspektion. Also die Männer, die an der Evakuierung teilgenommen hatten.
N.K.: Aha.
W.L.: Sie haben selbst beschlossen, keine Schutzmasken zu tragen, um keine Panik bei der Bevölkerung zu verursachen. Natürlich haben sie hohe Dosen abbekommen. Und auch Verkehrspolizisten, es gab Jungs des Pflichtdienstes aus Sicherungsregimenten, die rundherum Wache gehalten und die Zone patrouilliert hatten. Sie haben von Plünderungen, Ausraubungen, so, von vielen unangenehmen Fällen erzählt. Ich erzähle von einem Fall. Neben unserer Feuerwache in Tschernobyl gab es eine landwirtschaftliche Veranstaltung. Dort gab es große Plätze, wohin man Technik für Endlagerung brachte. Einige Kerle gingen also dorthin, um Werkzeug zu klauen, Mutternschlüssel, irgendwelche Ersatzteile, und nach Hause zu schicken. Das war auch der Fall. Und im Hospital war natürlich Relax. Da wurden wir eingetragen, untergebracht. Am dritten Tag kommt der Abteilungschef und sagt: „Wolodja, sind es deine Kerle in Zimmer so und so?“ – „Ja.“ – „Na, also fordert der Hospitalleiter, dass du sie findest, wo und wie du willst.“ – „Aber was ist los?“ – „Sie sind schon zwei Tage weg vom Hospital.“ Na, die Kerle wurden los, es gab ja keine Handys. (lacht)
N.K.: Und wo, wie sollte man sie suchen?
W.L.: Ja. Und ich habe mich in Gedanken vertieft. Da sehe ich – einer ist zurückgekommen. Eine wahre Erscheinung Christi. Und er quasi geht übers Wasser. Ich habe es kaum geschafft, ihn zu schütteln, habe alles ausgeschüttelt. Es stellt sich heraus, sie sind zu einem Bekannten, Serjosha, in den Pyjamas des Militärhospitals zu Besuch gefahren.
N.K.: Wirklich in Pyjamas?
W.L.: Mit einem Taxi, durch das ganze Kiew. Kurz und gut habe ich sie nach zwei Stunden gefunden und ins Hospital gebracht. „Kommandeur, es wird nie wieder passieren.“ Ich antworte: „Ja, ich glaube, dass das jetzt mit euch nie wieder passieren wird.“ (lacht)
N.K.: Und hat es ihnen nichts gemacht, dass sie in Pyjamas waren?
W.L.: Gar nichts. Ich hab´ es so überlegt, dort war das Stadion „Dinamo“ neben dem Hospital. Genau das Stadion, wo unsere Fußballspieler gegen Deutsche während des Krieges gespielt haben. Dort steht auch ein Denkmal. Ich bin also in meinem Pyjama dorthin gegangen. Habe hinter dem Stadion zweistöckige Gebäude mit kleinen Zimmern gefunden. Kurz und gut hab´ ich das Trainerzimmer gefunden. Ich erkläre, dass ich irgendwelche alte Sportbekleidung brauche, also T-Shirts, Pumphosen. Keine Schuhe, nur das. „Ja, haben wir, aber sie sind so schmutzig, gerissen.“ Ich sage: „Macht nichts, geben Sie so, wie es ist, ich werde es waschen, zunähen.“ Also haben sie es mit mir geteilt, mir diese Bekleidung gegeben. Aber das hat uns später echt gerettet. Ich hab´ all das gewaschen, während diese ausgeschlafen haben. So, ich habe gewaschen, zugenäht und ihnen ausgeteilt, als sie aufgewacht sind. Ich sage: „Wenigstens könnt ihr darin fahren.“ Gott sei Dank, es war Ende Mai, schon warm.
N.K.: Nur keine Pyjamas, oder?
W.L.: Na ja, keine Pyjamas. So. Wir sind gegangen, dort hat es einen kleinen Markt in der Nähe gegeben. Haben Gartenerdbeeren gekauft. Es ist heute kaum zu glauben – 25 Kopeken pro Kilo. Und niemand hat es gekauft, so groß war die Angst.
N.K.: Na ja.
W.L.: Nun, das Wasser läuft im Mund zusammen. Wir haben diese Beeren gekauft, gemessen – sie strahlen.
N.K.: Oh je.
W.L.: Wir haben die Schwänze von den Beeren getrennt. Gemessen – die Beeren sind sauber, die Schwänze strahlen.
N.K.: Ach so, da lag es an den Schwänzen.
W.L.: Sie waren nach der Zone, na also bitte schön. Was noch interessant war: Hinter dem Zaun des Hospitals, in einem fünfstöckigen Wohnblock gab es einen Laden. Damals arbeitete die Alkoholabteilung von 11 bis 17 Uhr. Aber uns in der Hospitalbekleidung wurde Alkohol im Hinterhof vom frühen Morgen bis zum späten Abend verkauft. Und was kennzeichnend war, hatten sie immer Rotwein. Ich weiß nicht, was vielleicht auch gerettet hat, dass ich bis jetzt auf Beinen sicher bin und der Kopf funktioniert, war Rotwein. Wir hatten immer 4-5 Flaschen davon in unserem Zimmer, in einem Nachtschränkchen. Eines Tages kommt unsere Ärztin zu Besuch, wir haben viel geredet, dann sagt sie: „Na, wo kann man Rotwein in Kiew kriegen? Ganz verschwunden, aber er ist ja nötig.“ Alle wissen, dass Rotwein nötig ist. „Frau Doktorin, kein Problem.“ Wir öffnen das Schränkchen: „Na, bitte.“ (lacht) Sie war so erstaunt. „Woher denn?“ – „Aus dem Laden“ – „Es gibt doch keinen Rotwein dort.“ – „Für Sie, aber nicht für uns.“ (lacht) Es gab einen solchen Fall. Sehr viel Geschwätz wanderte damals Kiew hindurch, Klatschgeschichten. Erstens waren alle Frauen draußen mit dem bedeckten Kopf. Bald Kopftuch, bald Hut. Männer auch.
N.K.: Wegen dee Haare, ja?
W.L.: Die Straßen wurden regelmäßig besprengt. Sprengwagen haben es ständig getan. Die Panik in der Stadt war unglaublich. Ich sah es persönlich nicht, aber die Männer waren zum Bahnhof gefahren und erzählten, dass man Kiew beinahe auf den Dächern der Wagen verlassen hatte. Einst beschloss ich, nach dem Abendessen… Ah ja, nach dem Abendessen, dann erzähle ich über das Frühstück. Ich beschloss, nach dem Abendessen in die Innenstadt zu fahren. Es war nicht weit vom Hospital, ich erinnere mich an den Straßennamen nicht. Man konnte mit einer Straßenbahn oder mit einem O-Bus in die Innenstadt fahren, es war nur zwei Haltestellen entfernt. Zum Hauptpostamt, um zu Hause anzurufen. Selbstverständlich waren wir in der Sportbekleidung.
N.K.: Aus dem Stadion, ja? (lacht)
W.L.: Ja. Ich erinnere mich daran wie heute, Witja wollte dieses T-Shirt nicht anziehen, er hat den Pullover gleich auf den bloßen Körper angezogen. Also Sporthose und Pullover, es war jener begeisterte Fischer. Geringgroß, stämmig. Nun sind wir aus dem Hospital gekommen und ich habe eine Frau gefragt, wie wir zum Zentrum, zum Hauptpostamt gelangen könnten. Sie sagt: „Na, hier um die Ecke biegen, dort ist eine Haltestelle, Sie können mit jedem O-Bus bis zum Ende fahren, dort ist der Platz. Und woher kommen Sie?“ Wir antworten: „Na, aus dem Hospital.“ – „Oh, Leute, waren Sie dort?“ – „Ja.“ – „Oh, haben Sie Bustickts?“ – „Was für Tickets? Natürlich nicht“ – „Oh, Leute, ich gebe Ihnen Karten.“ Sie hat uns Karten und etwas Geld gegeben. Na, das waren ja Leute.
N.K.: So war die Einstellung, oder?
W.L.: Ja. Also sind wir im Zentrum spazieren gegangen, ein Milizionär ist zu uns angekommen, hat uns genau angeschaut, wegen unseren Aussehens. Hat nach Papieren gefragt. Welche Papiere? Wir haben ihm erklärt, wer wir sind, woher und warum. Er sagt: „Leute, mögen Sie im Zentrum nicht einfach so herumgehen, sonst wird es für mich…“ Ich sage: „Na, wir gehen gerade zur Fernpsrechstelle und dann nach Hause, also keine Sorgen.“ Wir sind in die Stelle eingetreten, zu dieser Frau angekommen, haben die Telefonnummer, die Stadt genannt. Und dann sitzen und warten. Witja ruft zu Hause an, ich auch. Normalerweise hat man innerhalb einer Stunde verbunden. Wir sitzen und warten, eine halbe Stunde, 40 Minuten und nichts. Ich sehe Menschen telefonieren, die nach uns gekommen sind und auch Charkow gefordert haben. Und uns verbindet man nicht. Dabei ist ein Gedränge in dieser Sprechstelle, es gibt keinen Raum, ich stehe an einer Wand, kann mich nicht einmal setzen. Schließlich ist mein Geduld aus, ich komme zu dieser Frau, streite, sage: „Wie kann man das? Ich bin aus der Zone gekommen, aus einem Hospital, ich will nach Hause anrufen und sagen, dass ich am Leben bin, und ich stehe da, nach mir haben schon 8 Leute mit Charkow telefoniert und Sie verbinden mich nach wie vor nicht.“ Und Witja ist dort geblieben, wo wir gestanden sind, an den Kabinen. Ich sehe Leute von mir abtreten, drehe mich um und sehe Leute auch von Witja abtreten.
N.K.: Aus Angst? (lacht)
W.L.: Augenblicklich sind freie Plätze auf der Bank entstanden. Ich komme zu Witja und frage: „Was ist denn los?“ Er sagt: „Wahrscheinlich haben sie Angst, sich von uns anzustecken.“ Also gut (lacht), wir haben geschwind auf dieser Bank Platz genommen, warten. Es sind kaum 5 Minuten vergangen, bevor wir verbunden sind. Ich bin so zufrieden, rufe meine Frau an: „Meine Liebe, alles ist gut, ich bin im Hospital.“ (lacht)
N.K.: Sie muss…
W.L.: Ernst, meiner Frau haben sich die Haare vielleicht gesträubt von diesem Satz: „Liebe, mach dir keine Sorgen, alles ist gut, ich bin im Hospital.“ (lacht) Dann war eine Epopöe, dieses Hospital zu verlassen. Man hat uns aus Iwankow angerufen und gesagt, dass Leute am nächsten Tag kommen würden, um uns abzulösen, und dass wir mit denselben Bussen nach Charkow zurückfahren sollten. Ich gehe zu meinem betreuenden Arzt, er sagt: „Ich darf Sie nicht entlassen, mit Ihren Messzahlen, solcher Bestrahlung.“ Ich erwidere: „Aber ich muss fahren. Wenn ich hier stecken bleibe, kann ich dann nirgendwo rauskommen, gelangen.“ – „Gehen Sie zum Abteilungsleiter.“ Kurz gesagt bin ich zum Hospitalleiter geraten. Der sagt: „Ausschließlich auf Ihre eigene Verantwortung“. Ich sage: „In Ordnung, entlassen Sie uns.“ Also sind meine Mannschaft und ich auf meine eigene Verantwortung. So.
N.K.: Sind nach Charkow zurückgefahren?
W.L.: Na, zurückgefahren ist noch zu einfach. Wir waren ja in diesen Kraftwerkroben, also weiße Schuhe, weiße Roben, weiße Mützen…
N.K.: Sie sollten also noch die Kleidung finden, oder?
W.L.: … Schutzmasken. Und diese Robe hat solche Siegel, Spießkante und Aufdruck „ЧАЭС“[2]. So schwarz. Also los, wir mussten wiederum zu diesem O-Bus gehen, einsteigen, bis zum Ende fahren, dann noch ein bisschen bis zur Trasse gehen. Auf der Trasse war ein Kontrollpunkt, dort mussten wir den Führer dieses Kontrollpunktes um ein Mitfahrzeug nach Iwankow bitten. Sonst nichts. Und die O-Busse waren aus Tschechien, „Skoda“ mit einem Balg. Wir sind in einen solchen O-Bus eingestiegen, er war bombenvoll. Als man uns erblickt hatte, waren alle schon an der nächsten Haltestelle weg von diesem Anhänger, wo wir eingestiegen waren. Das heißt, wir fuhren den ganzen Weg auf Sitzplätzen mit Komfort.
N.K.: Sie haben alle erschreckt, ja? (lacht)
W.L.: Ja, also. Dann sind wir in diesen Kontrollpunkt gekommen, dort war ein Marinefähnrich aus irgendeinem Grund im Dienst. Und dieser Marinefähnrich hat uns einen Bus buchstäblich nach 15 Minuten gefunden, so sind wir nach Iwankow gekommen. Außer uns vor Freude waren wir. Und in Iwankow echt, schon am nächsten Tag sind Busse angekommen, wir wurden eingeladen und sind nach Charkow gefahren.
N.K.: Und was war weiter, in Charkow und danach?
W.L.: Moment, ich hab´ über das Frühstuck noch nicht erzählt.
N.K.: A ja, Entschuldigung.
W.L.: Das Frühstuck im Hospital, das Essen war prima, in Tschernobyl sowie im Hospital. Fabelhaft. Und zum Frühstuck sind sehr wenige Leute gekommen, ich glaube, es hatte mit Rotwein zu tun. Als ich gekommen bin, legt sie eine Krabbe mit dem Löffel auf den Teller. Ich hab´ es erblickt und sage: „Ach, Schatz, leg mir mehr, ich mag sie sehr“. Sie sagt: „Ich kann für Sie eine ganze Dose öffnen.“ Und ich: „Unmöglich, öffne natürlich.“ (lacht) Sie hat geöffnet. Natürlich war alles wie in einem Restaurant: Tische mit Tüchern bedeckt, Esszeug darauf. Ich habe mich zur Tafel gesetzt und am Nachbartisch sitzen Jungs des Pflichtdienstes, aus diesen Sicherungsbataillons, Sicherungsregiment, ganz jung. Und da essen sie und unterhalten sich: „So lecker. Das müssen die Krevetten sein. Ich hab´ sie nie geschmeckt, so lecker!“ Ich esse und denke: „Meine Güte, diese Jungs sind einberufen, also 19-20 Jahre alt, und sie haben keine Ahnung, was eine Krabbe ist.“ Ich wurde sogar nachdenklich: So ein Glück haben die Jungs – Krabben im Hospital zu schmecken.
Es gibt verschiedene sozusagen Erinnerungsflecken, die aus jener Zeit auftauchen. Noch ein Fall, ein Fleck, eine Skizze. Vor dem Dienst hatte ich am Morgen nichts zu tun, da hab´ ich mein Radiometer genommen und mich auf den Weg durch Tschernobyl gemacht. Das Bild einer bewohnten Stadt. Also grüne Bäume, Gras, Fenster, Gardinen, Fenstervorhänge fächeln in einem Klappfenster, Wäsche hängen auf einem Balkon, Strampler, Strumpfhose, Blumen in Blumentöpfen sind noch nicht verblüht, hier und da wird Fisch gedörrt. So. Ich gehe, messe, rechne aus und es scheint… Das hab´ ich schon später ausgerechnet und es hat geschienen, dass es für 80 Jahre ist. Also in 80 Jahren kann man dorthin kommen und es wird ziemlich unbedenklich sein. Dann ging ich durch ein Privathäuserviertel und danach große Wohnblöcke – und da tauchte bei mir eine Situation… also Assoziation mit Bergmans Werken, wo der Held durch eine quasi bewohnte, aber völlig menschenleere Stadt geht.
N.K.: Ich habe nicht alle Filme gesehen.
W.L.: Echt? Dann empfehle ich Wilde Erdbeeren stark, aber das war, glaube ich, aus einem anderen Film. So. Und diese Schaurigkeit einer stimmlosen Menschenleere, es wurde mir sogar ungemütlich. Es hat mich sehr stark beeindruckt. Man kann ja das den Kameraden nicht erzählen, aber mir wurde schaurig.
N.K.: Übrigens erwähnen alle das Gefühl, dass es niemanden gibt und es schaurig ist.
W.L.: Ja, ja, ernsthaft schaurig. Nun, es gab erfreuliche Momente, es gab wehmütige Momente. Na, zum Beispiel ging ich morgens mir das Gesicht zu waschen, dort in Tschernobyl stand ein Fass hinter dem Feuerwehrhaus, ein Fasswagen. Damit wurde uns sauberes Wasser aus Kiew gebracht. Mit diesem Wasser haben wir uns das Gesicht gewaschen. Also stehe ich, wasche mich und 20 Meter weit wachsen Bäume, junge Pappelbäume. Und Nachtigallen flöten. Und so schön ist es, ich stehe, wasche mich, höre diese Nachtigall zu und Tränen steigen mir in die Augen. Du Gottes Geschöpf, du singst, hier ist eine große Trauer und dein Gesang ist so schön. Noch ein Beispiel: eine Krähe. Die ganze Zeit rauchte der Reaktor, die ganze Zeit stieg dieser braune Rauch, manchmal dicht, manchmal nicht besonders dicht. Er stieg so säulenförmig. Und, so verstehe ich, es gab dort eine starke Wärmefreisetzung. Warum? Denn die ganze Zeit kreisten Möwen und Krähen herum. Sehr viele und ständig, ständig. Ich habe einst mit jemandem gesprochen. Und da kommt Kolja durch den Horst vom Kraftwerk. Er ist in den Bunker gegangen, um zu rauchen, zu schwätzen, mit Bergleuten zu sprechen, Witze zuzuhören und zu erzählen. Interessant, die Kerle waren spitze. So kehrt er zurück und ich habe zuvor eine Krähe umfliegen sehen. Sie ist so im Kreis umgeflogen und neben einem Wagen, einem Rad gelandet. Da erscheint Kolja. Ich sage: „Kolja, Vorsicht, trete auf die Krähe nicht auf.“ – „Welche?“ – „Na, diese.“ – „Was sagst du, Kommandeur, sie ist tot.“ – „Unmöglich.“ Ich komme zu und sie ist schon fertig.
N.K.: Na ja, sie hat doch nicht gewusst… Und erzählen Sie, bitte…
W.L.: Natascha! Könnten wir eine 5-Minuten-Pause machen?
N.K.: Ja, ja. (Pause) Also, wo sind wir stehen geblieben? Sie sind schon nach Charkow gefahren.
W.L.: Ja, wir sind schon nach Charkow gefahren. Die Fahrt werde ich nicht beschreiben. Die Fahrt ist die Fahrt.
N.K.: Na, Nebensache.
W.L.: Selbstverständlich haben wir irgendwo übernachtet, sind in Charkow angekommen und dem Fahrradwerk entgegen ausgestiegen. Damals war ein Badehaus dort. In diesem Badehaus wurde eine Personenschleuse für uns organisiert. Wir gingen hinein, nahmen die sämtliche Kleidung für Desaktivierung ab, jedem von uns machte man eine Schnellblutanalyse. Wir gingen eine Sanierung durch und uns erteilte man unsere zivile Kleidung, die wir abgegeben hatten, als wir die Uniformen erhalten hatten. Und als wir Papiere erhielten, gab man uns eine übliche Bescheinigung, dass wir in einer Wehrübung so viele Tage verbracht hatten. Kein Wort über die Zone, nichts solches. Eine übliche Wehrübung. Und jeder, der die Blutprobe abgab, nicht jeder, nur mehrere bekamen noch eine Karte. Dort stand auf
einer Seite die Blutnummer und die Empfehlung, sich an… Die Empfehlung, sich an einen Arzt zu wenden, war mündlich. Das war´s. Nun, die Karte in die Tasche, die Tasche in die Hand und los mit Kerlen in den Bezirk Traktorenwerk. Dort sind wir noch zum Abschied gesessen und ich bin nach Hause gegangen. Mit dem kahlen Kopf. (lacht)
N.K.: War die Familie beeindruckt?
W.L.: Die Frau war doch bei der Arbeit. Ich habe sie angerufen, gesagt, ich sei schon zu Hause. Sie kam gelaufen, um mich zu sehen. Ich hatte ihr gesagt, ich sei jetzt kahlköpfig. So. Noch ein Tag ist vergangen, es war gerade Wochenende, ab dem 8. Juni. Nach zwei Tagen hab´ ich meiner Frau gesagt, mir habe man dieses Ding gegeben und gesagt, dass ich mich an einen Arzt wenden soll. Blutanalyse. Sie führt mich in die Bezirkspoliklinik, ich weiß doch nicht, was und wo. Sie führt mich, jetzt suchen wir die Bezirksärztin, aber sie ist nicht da. Es gibt eine andere Ärztin, ganz jung. Wir kommen herein, wir sind zu zweit, und sie fragt: „Warum sind Sie so?“. Ich antworte, mir würde gesagt, dass ich mich an einen Arzt wenden soll. „Aber warum?“ – „Na, ich bin gerade aus Tschernobyl.“ Sie hat sogar einen Sprung getan.
N.K.: Vor Angst? (lacht)
W.L.: „Und wer hat Ihnen das gesagt?“ Ich sage: „Na, in einer Personenschleuse hat man eine Blutanalyse gemacht und so gesagt. So bin ich da.“ – „Nun gut, nehmen Sie das Hemd ab, ich horche Sie ab.“ Und diesen Schlauch, wie heißt er? Endoskop, oder? Also, das zum Behorchen hielt sie mit einem gestreckten Arm, als sie mich behorchte. Dann fragte sie noch etwas. Ich sage: „Ich weiß doch nicht, mir wurde gesagt.“, und reiche ihr die Karte mit diesen Analysen. Sie guckt in diese Karte, dann dreht sie herum und macht einen anderen Sprung vor Freude: „Oh, sehen Sie mal, hier steht geschrieben, dass Sie sich an die medizinische Radiologie wenden sollen.“ Pfui Teufel, zu dumm, um sie zu Hause herumzudrehen. Also fahren wir in die Radiologie. Und dort war das Gespräch schon kurz – sich aufs Bett legen und Schluss.
N.K.: Na klar.
W.L.: Und da startete eine drei Jahre lange Epopöe. Drei Jahre der medizinischen Radiologie.
N.K.: Und wie war das Verhalten bei der Arbeit? Wurden Sie als Liquidator irgendwie besonders behandelt?
W.L.: Natürlich war das bei der Arbeit. Die Männer waren spitze, wirklich gute Kerle. Mir wurden zwei Last-Minute-Reisen im Juli angeboten, für mich und meine Frau.
N.K.: O la la.
W.L.: Nach Gagra.
N.K.: O!
W.L.: So. Man gab irgendwelches Prämiengeld, quasi Einstiegsgeld, noch etwas wurde ausgezahlt. Nein, es war wirklich sehr gut. Und wir fuhren damals in ein Sanatorium nach Gagra. Gingen durch Gagra spazieren. Na, ich hatte wiederum diese Assoziation mit Bergman – das leere Gagra. Mittag, Mittagszeit, aber die Gaststätten sind leer – keine Person, geschweige denn Schlangen.
N.K.: Wieso?
W.L.: Die Panik verbreitete sich durch die ganze Sowjetunion und jemand setzte ein Gerücht, dass das schwere Wasser aus dem Tschernobyl-Kraftwerk über Dnepr ins Schwarze Meer gelangt. Das ganze Schwarze Meer sei verseucht. Die Einheimischen stöhnen, sagen: „Die Leute haben mit uns telefoniert, gesagt, sie werden kommen. Jetzt rufen alle an und absagen, niemand will nach Gagra auf Urlaub fahren.“ So was gab es auch.
N.K.: Also hat das Gerücht seine Rolle gespielt?
W.L.: Ja, ja. Panik. In Gagra hab´ ich damals zum ersten Mal bestimmt, dass ich eine wirklich hohe Strahlungsdosis bekommen habe. Nämlich auf den nächsten Tag nach der Ankunft gingen ich und meine Frau auf dem Kai spazieren. Wir waren in einem Sanatorium an der Einfahrt in Gagra, es steht ganz am Meeresstrand. Wir gingen zum Kai aus und buchstäblich nach 15 Minuten fiel ich in Ohnmacht. Meine Frau erschrak natürlich. Und ich verstand seitdem, dass ich mich der Sonne nicht aussetzen darf. Erst später stellte sich heraus, was notwenig war: unbedingt Kopfbedeckung, unbedingt Sonnenbrille. Damals trug ich ein Hemd mit langen Ärmeln und eine lange Hose. Dann erfuhr ich, dass kurze Hose und kurze Ärmel auch tun. Die ersten 3-4 Jahre hatte ich jedoch da, wo die Manschetten der Kraftwerkkleidung gewesen waren und sich der Staub in die Ärmel eingerieben hatte, also hatte ich Verbrennungen im Mai. Einfach Verbrennungen, als ob jemand mich mit einer Zigarette ansengte. So. Na, Ohnmacht. Das war… Und dann eine besondere, ganz besondere Geschichte mit der medizinischen Radiologie. Es gab viel sowohl Gutes, als auch Schlimmes, Trauriges und Erfreuliches.
N.K.: Und haben Sie sich mit Ihren Kameraden aus Tschernobyl dann später getroffen oder sind alle Kontakte verloren gegangen?
W.L.: Die Sache ist so. Es geschah nicht ganz gewöhnlich. Wie ich schon erzählte, man erteilte uns übliche Bescheinigungen. Aber wir blieben im Kontakt miteinander. Und als die Männer, die uns in Tschernobyl abgelöst wurden, der zweite Bataillonbestand, zurückkehrten, stellte sich heraus, dass man ihnen ganz andere Bescheinigungen erteilte, darin gab es schon Zonen, 5fache Entlohnung. So. Und wir wurden empört: wieso? Sie waren nach uns und haben alles bekommen und wir waren als Ersten da – und nichts. Wir haben uns zum Militärkommissariat begeben. Dort wurden wir beinahe mit Schimpfworten abgewiesen: „Wir wissen nichts. Raus.“ Wir haben uns in die Feuerwehrverwaltung begeben, eigentlich waren wir dort unter dessen Leitung. Dort hat man auch nichts gewusst und uns abgewiesen. Wir haben angefangen Briefe zu schreiben, sowohl gemeinschaftliche, als auch persönliche. Ich habe bis jetzt diese Briefe irgendwo, Umschläge mit Antworten. Wir haben in die Gewerkschaft in Moskau geschrieben, ins Ministerkabinett, ins Zentralkomitee der Partei, in, kann mich nicht erinnern, ins Verteidigungsministerium. Aus allen Ämtern sind formelle Absagen gekommen. Einfach nichts. Es dauerte lange, glaube ich, etwa bis Ende September. Dann ging mir die Geduld aus.
N.K.: Aha.
W.L.: Ich denke: „Letztendlich muss ich meinen Vorteil irgendwann ausnutzen.“ Ich wechselte Jeans auf ordentliche Hose, nahm das Parteibuch mit und begab mich zum Gebietsparteikomitee. Damals war der dritte Sekretär des Gebietskomitees, ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern. Ich wurde von ihm empfangen. In der Regel kommen die Leute, um etwas zu erbitten, er war eigentlich dafür bereit. Fragt: „Was haben Sie da?“ Ich sage: „Ich brauche Ihre Hilfe, helfen Sie mir eine Sache klären.“ So und so, wir wären dort, wir kehrten zurück, wir haben jetzt nur das und nichts mehr. Es stelle sich heraus, dass es noch das, das und das gibt, aber niemand gebe uns das. Er sagt: „Warten Sie, wir werden gleich alles klären.“ Er nimmt den Hörer ab, wählt eine Nummer, dann wird er mit jemandem noch verbunden und noch und noch. Er hat sehr lange telefoniert, etwa 20 Minuten. Er hat meine Papiere: Ausweis, Militärausweis, dort gibt es Truppenbezeichnung, alle Friste. Er legt den Hörer und sagt: „Also, jetzt beschließen wir direkt hier ein Gesetz über Partei. Sie gehen in die Gebietsverwaltung für Miliz, es ist ganz in der Nähe, und dort zum Kassenleiter. Er wartet auf Sie bereits, er hat alle Papiere, die Sie brauchen.“ Bis ich zu dieser Gebietsverwaltung gekommen bin, hatte der Diensthabende am Eingang schon eine Einlasskarte für mich.
N.K.: Hat man die schon gemacht?
W.L.: Ja. Jemand hat mich dort geführt, im zweiten Stock war ein Oberst mit einem asiatischen, samarquandischen Nachnamen.
N.K.: Aha.
W.L.: Ja, so. Er: „Ja, ja, all das steht Ihnen zu. Ich soll nur einige Konkretisierungen machen. Lassen Sie Ihren Militärausweis bei mir liegen und kommen Sie morgen“, ich erinnere mich nicht, um wie viel Uhr, etwa um 10. Alles in Ordnung. Ich komme zufrieden raus, telefoniere mit allen Kameraden. Alles solle morgen sich entscheiden. Und am nächsten Tag treffen wir uns wirklich in einem Haufen aus unserem Bataillon zusammen. Sie sind vor der Verwaltung geblieben und ich bin hineingegangen. Und dieser Oberst gibt mir meinen Ausweis zurück und sagt: „Jetzt folgen Sie in Richtung Gebietsfeuerwehrverwaltung, ihnen sind alle Anweisungen, Erklärungen gegeben, erhalten Sie die Ihnen zustehenden Bescheinigungen anstatt der früher erteilten und Sie werden alles haben.“
N.K.: Aha.
W.L.: Na, wunderschön. Wir haben sie vollständig besiegt, sie sollen sich nicht damit beschäftigen, was ihnen bestimmt ist, aber das ist Nebensache. Die Hauptsache ist, das Eis ist geborsten. Also los zur Feuerwehrverwaltung. Und mit uns hat sich der Zivilschutzstab beschäftigt. Dort sagt man: „Na, Männer, Sie haben ein Riesending in Bewegung versetzt, wir konnten gar nichts durchbrechen und Sie haben es in einem Zug geschafft. Ja, wir haben ein Muster dieser Bescheinigung, jedoch haben wir die Bescheinigungen selbst nicht. Lediglich ein Muster.“ Und einer meiner Kameraden, er arbeitete als Abteilungsleiter in einer Druckerei, sagt: „Geben Sie her, ich mach´ das. Wie viele Exemplare brauchen Sie? Nämlich jetzt gehe ich und schon morgen bringe so viel Exemplare, wie nötig.“ In der Tat ist er zur Arbeit gegangen und die Leute dort haben es getastet, eins zu eins…
N.K.: Toll. Das heißt, alle haben zusammengearbeitet.
W.L.: … eine notwendige Auflage gedruckt. In der Tat haben wir ein solches Bündel dieser Blätter gebracht. Und unser Bataillon betrug, glaube ich, 260 Personen. Na, nicht so wichtig. Wir haben es geschafft, nicht nur für uns, sondern auch für die etatmäßigen Feuerwehrleute herauszuschlagen. Und erst im Oktober haben wir die Bescheinigung bekommen, dass wir in der Zone gewesen sind und uns eine Entlohnung zusteht. Als ich diese Bescheinigung, die Entlohnungsbescheinigung zur Arbeit gebracht habe, sagt man mir: „Wolodja, aber wie sollen wir das? Es ist schon Oktober. Wir können für den Mai nicht einschließen, weil es für den Mai schon ausgezahlt worden ist. Wollen wir das am Jahresende einschließen und dann schon alles im Dezember auszahlen.“ Ich sage: „Um Gottes willen, von mir aus.“ Das komischste war später. Als die Kalkulation meines Gehalts während meines Aufenthalts in Tschernobyl begonnen hat – im Mai hatte ich kein Gehalt. Ich sage: „Sie haben es ins Jahresende, in den Dezember eingetragen.“ – „Nein, es steht hier geschrieben, dass im Mai, also werden wir rechnen.“ Und Schluss. Ich sage: „Da ist doch die Bescheinigung. Sehen Sie, im Oktober erteilt.“ Niemanden geht das an und bis heute hat mir niemand…
N.K.: Na, seien Sie nicht traurig. (lacht)
W.L.: Nun, es ist doch bitter. Es ergibt sich, dass… Im Februar bin ich umgezogen, habe angefangen zu arbeiten. Der erste Monat ist nicht vollständig, er wird gar nicht gerechnet. Im zweiten Monat hatte ich keine Prämie, weil es quasi Probezeit war, also März, April. Und Mai sollte der erste normale Monat mit Prämien sein. Aber ich war bei der Wehrübung. Welche Prämien?
N.K.: Na klar. Also, damals haben Sie eine große Sache mit Ihren Kameraden durchgedrückt. Und haben Sie sich mit ihnen später getroffen, unterhalten?
W.L.: Natürlich haben wir. Danach haben wir uns jedes Jahr am 4. Mai im Bezirk Traktorenwerk getroffen. Unser ganzes Bataillon hat sich am Traktorenwerk versammelt. Wir haben uns miteinander unterhalten. Dann haben sich bestimmte Kontakte, bestimmte Gruppen ausgebildet. Mit mir sind etwa 8 Personen zusammengehalten.
N.K.: Na ja, wer hat sich mit wem befreundet.
W.L.: Ja. Mit zweien habe ich mich quasi verschwägert: Serjosha Kolesnik wurde mein Gevatter und die Frau von Wolodja Kosterew meine Gevatterin.
N.K.: Ach, so schön.
W.L.: Sie haben meine Tochter getauft. Dieser Kontakt hat für immer bewahrt. Und auch die Kameraden, mit denen ich dort gewesen bin. Und dann habe ich mich mit so vielen Leuten im Institut für medizinische Radiologie befreundet: ebenso von Tschernobyl, mit gleichen Krankheiten. Mit ihnen treffen wir uns auch jedes Jahr.
N.K.: Und woran haben Sie sich beim Treffen am meisten erinnert? Worüber haben Sie gesprochen?
W.L.: Wissen Sie, wir machten uns damals mehr Sorgen nicht dafür, was schon geschehen war, sondern was auf uns noch zukam. Das heißt, am Anfang hatten wir keine Rechte, nichts. Wir mussten irgendwas irgendwie irgendwo erringen. Denn in allen Behörden sagte man uns: „Wir haben Sie dorthin nicht geschickt. Gehen Sie zu denen, die Sie geschickt haben.“
N.K.: Also, Sie waren vielmehr mit Ihrer Zukunft beschäftigt, oder?
W.L.: Ja. Wir waren total im Unklaren. Man erklärte uns, dass der Staat die ganze Verantwortung für uns genommen hätte und man uns mit allem versorgen würde. Aber wir beobachteten das nicht. Dann wurden wir der Radiophobie beschuldigt, wir sollen eine Phobie haben, uns selbst verleumden und in der Tat gebe es keine Krankheiten. Also, wir sollen perfekt gesund sein. So. Es ging so weit, dass ein Amtsmensch, ein Beamter, der im Büro saß und zu dem ich kam, um Hilfe zu bitten, sagte mir von vornherein beinahe mit Schimpfworten ab: „Du bist niemand, ein armer Bitter… du bist ein Null Komma nichts.“ Ich verstehe es so, dass dieser Beamte… Ich war darauf stolz, dass ich in Tschernobyl gewesen war, der Heimat hilfreich und nützlich. Dass ich Leute gerettet hatte. Und dieser Beamte war darauf stolz, dass er es versäumt hatte. Das war Heldentat für ihn. Dass er eine Weise gefunden hatte, um dorthin nicht zu geraten. Und das war, worauf er stolz war. Für ihn war ich eine Schande, deshalb versuchte er, mich so weit wie möglich wegzustoßen.
N.K.: Also, eine ganz andere Weltanschauung.
W.L.: Absolut. Diese Barriere hatten wir zu bekämpfen. Dann haben wir uns vereinigt, dank Walera Bolotow. Er ist von einem Krankenhaus zum anderen gelaufen, hat mit uns verabredet und wir haben uns schließlich versammelt. Dann mussten wir das finden, was man heute „ein Dach“ nennt, eine Ägide. Der Kommunistische Jugendverband hat uns nicht angenommen, obwohl ich ihm beigetreten bin, sondern hat uns Swetlana Gorbunowa, „das Rote Kreuz“, Zuflucht gewährt. Und sie hat den ersten Tschernobyl-Verband in der UdSSR gestiftet. Dann haben wir uns vereinigt. Dann wurde Walera Bolotow ausgebootet, es stellte sich heraus, er war in Tschernobyl gar nicht gewesen, hatte sich einfach angebiedert. Wir schickten eine Anfrage an die Politverwaltung des Kiewer Militärbezirks und erhielten eine offizielle Antwort: Jawohl, Bolotow hatte freiwillig an der Arbeit der Politabteilung teilgenommen, hatte einer Konzertbrigade angehört, die Militäreinheiten umgereist hatte, war in die Zone nicht eingefahren. Also war in der Zone nicht gewesen. Als er jedoch zwischen uns in Krankenhäusern aufhielt, hörte er mal hier, mal dort zu. Und bei einem neuen Besuch erzählte er, er sei in Tschernobyl gewesen, habe als Feuermann etwas gelöscht, mal das Kraftwerk…
N.K.: Na klar.
W.L.: … mal Wälder. Mal sei er im chemischen Schutz gewesen, mal habe Fahrzeuge bearbeitet. Mal noch was. Und jedes Mal erzählte er. Wir wählten ihn zunächst zum Vorsitzenden, dank seiner Tatkraft. Und dann stellte sich heraus, dass er nur mit sich selbst beschäftigt war. Und man musste die Organisation ausbilden. Dann wurde ich gewählt, ich organisierte die Struktur, Abteilungen, Glieder, die ganze Kette im Gebiet, in der Stadt, in Kreisen. Dann begann die Organisation zu leben, zu arbeiten. So.
N.K.: Und wann haben Sie sich für Justizausbildung entschieden, wie sind Sie dazu gekommen?
W.L.: Ich muss sagen, ich hatte Glück, dass ich ab und zu in die Stadtwahlkommission als Vertreter der Tschernobyl-Sozialorganisation geschickt wurde. Dort verstand ich, dass man heute ohne Justizausbildung nichts anzufangen hat.
N.K.: Also, es war eine Notwendigkeit, oder?
W.L.: Ja, und um die Rechte der Leute von Tschernobyl korrekt und konkret wahrzunehmen, muss man eine Justizausbildung haben. Und so dachte ich: das Kopf funktioniert, allerdings ist es schlimm mit der Gesundheit, aber das Kopf funktioniert doch. Ich muss mindestens versuchen, zumal ich eine Präferenz bei der Immatrikulation habe. Ich ließ mich also bei der juristischen Akademie immatrikulieren, Fernstudium, absolvierte sie normal, alle Jahresarbeiten, Klausuren…
N.K.: Hat es gefallen?
W.L.: Ja, das Prozess selbst hat gefallen. Heute, ehrlich gesagt, bedauere ich allerdings in manchen Fällen, dass ich eine Justizausbildung habe. Wissen Sie warum?
N.K.: Warum?
W.L.: Die letzten Ereignisse in der Ukraine, ich beobachte sie und denke: „Mein Gott, es ist ja Wahnsinn.“ Wenn man das Weiß das Schwarz nennt, wobei Amtspersonen es tun, die für jeden ausgesprochenen Buchstaben haften sollen. Geschweige denn ein Wort oder eine ganze Phrase. Und diese Person behauptet etwas heute und etwas ganz gegensätzliches morgen. Vom Rechtsstandpunkt aus wird es ganz eindeutig bestimmt. Jedoch interpretiert man es, nun…
N.K.: Na klar.
W.L.: … nach eigenem Belieben. Und ich, ehrlich gesagt, bedauere.
N.K.: Na, werden Sie nicht verstimmt.
W.L.: Ich denke: „Gott, wie unbegabt es getan wird. Sehen die Leute es nicht?“ Offenkundig sehen sie nicht.
N.K.: Na, wer nicht ausgebildet ist, sieht nicht. Der weiß nicht, wie es richtig ist, deshalb glaubt er.
W.L.: Oh, schade um die Leute, schade.
N.K.: Natürlich. Aber sagen Sie, es gibt eine Tendenz unter Studenten, weiß ich nicht, es ist interessant, einen Ausflug in die Zone zu machen. Glauben Sie, es ist bis jetzt bedenklich?
W.L.: Gott bewahre. Ich hab´ es meinem Neffen vor kurzem abgeraten.
N.K.: Echt?
W.L.: Ja. Er hat gesagt: „Da kommt ein Ausflug, man muss mitfahren.“ Und ich sage: Leute, gut ist es im Buch geschrieben, ein Film über Stalker wurde gedreht, das Videospiel ist gut, vielleicht, ich hab´ es nicht gesehen, ich weiß nicht. Aber in der Tat weißt du nie, wo du auf denjenigen Splitter kommen wirst. Die Strahlung riecht nicht, scheint nicht, sie kann nur mit einem Gerät festgestellt werden. Niemand von euch wird solche Geräte haben. Was man euch erteilen wird, ist eine Fiktion. Ein echtes Gerät werdet ihr nicht mithaben. Und wo du dich darauf setzen wirst, wo er dir auf die Kleidung oder in die Tasche, auf die Schuhsohle geraten wird, weiß niemand. Und dann wirst du das ganze Leben jenen Tag oder drei Tage, die du dort verbracht hast, bereuen. Spaß wirst du dort nicht haben, weil alles, was dort ist, auf einen gesunden Menschen bedrückend wirkt. Diese Ungepflegtheit, Vernachlässigkeit, Leere, dieser Verfall, dieses Bild einer zerstörten Welt. Ich weiß nicht, wieso es interessant sein kann. Ich selbst halte es für sinnlos. Jene Heroik, Bücher, Filme, Spiele, all das ist nicht zutreffend. In der Wahrheit ist ein Verfall dort. Es ist dasselbe, wie durch unsere, ich sage noch mal, unsere alten slawischen Friedhöfe zu gehen. Das kann nicht Spaß machen. Keinen Spaß wird es auch beim Zonenbesuch geben und man wird sie nur nach Prypjat und nirgendwo anders fahren.
N.K.: Klar. Und sagen Sie, was halten Sie von den Gedenkmaßnahmen? Wie sollten sie Ihrer Meinung nach ideal aussehen?
W.L.: Ja, bis vor kurzem hatten wir nur einen Datum, den 26. April. Und man versuchte alles in diesen Tag hineinzuquetschen. Irgendwelche Auszeichnungen, irgendwelche Geldleistungen und so weiter und so fort. Wir waren dem gegenüber feindlich. Ja, feindlich. Wir sagten der sämtlichen Leitung Charkows und des Gebiets: „Lassen Sie es in Ruhe, es ist ein Gedenktag, ein Trauertag. Verleihen Sie Medaillen und Urkunden am Tag des Ausbruchs des Großen Vaterländischen Krieges? Nein. Das ist ein Trauertag. Lassen Sie all das in Ruhe, lassen Sie uns trauern.“ Dann kapierten sie offensichtlich und Juschtschenko stiftete den Tag des Liquidators am 14. Dezember. Da passte alles zusammen. Da wurden wir alle einverstanden und alles wurde richtig. Am 14. Dezember können Sie uns rühmen, auszeichnen, das ist richtig. Aber am 26. April, Entschuldigung.
N.K.: Nicht berühren, oder?
W.L.: Sträuße und Gedenken sind heilige Sachen. Irgendwie hat sich hier in Charkow ein quasi Ritus herausgebildet. Es hat mit mir angefangen, als unsere Stadtverwaltung dank… damals war es nicht mehr Sokolowski. Es war Jewgeni Kuschnarenko.
N.K.: Kuschnarew?
W.L.: Kuschnarew, ja. Auf sein, sagen wir so, Anhieb hat man uns erlaubt, einen Gedenktag am 26. April im Rahmen der Stadt durchzuführen. Zuvor haben wir uns gewöhnlich seit 1988 am 26. April neben dem ewigen Feuer versammelt, um 10 Uhr. Und dann, als man uns vorgeschlagen hat, alles offiziell durchzuführen, habe ich gesagt: „Nein, Leute, wollen wir das ewige Feuer bis zum Schluss aufsparen und das erste und das wichtigste ist, Blumen am Feuerwehrleutendenkmal niederzulegen.“ Sie waren es, die als erste gestorben sind. Das war der Anfang. Und jetzt von Jahr zu Jahr kommt erst die Sträußenniederlegung am Feuerwehrleutendenkmal und dann… nun, früher sind wir zum ewigen Feuer gegangen und heute gehen wir zum Tschernobyl-Denkmal im Park der Jugend. Aber das Feuerwehrleutendenkmal bleibt bis jetzt der erste Punkt des Gedenktages. Mir ist angenehm sogar. (lacht)
N.K.: (lacht) Na, sehen Sie, wie toll Sie es ausgedacht haben? Und was, weiß ich nicht, welche Erfahrung, Quintessenz aus diesen Ereignissen könnten Sie den Leuten, die später leben werden, unseren Nachfahren empfehlen? Die z. B. ein Lehrbuch aufmachen und nicht wissen werden, von wem sie all das hören könnten, weil es uns nicht mehr geben wird, nur Lehrbücher. Etwas, woran man sich erinnern soll oder was man nicht vergessen darf, also, was für sie von Bedeutung ist. Was würden Sie empfehlen?
W.L.: Das wichtigste, was ich empfehlen würde, ist NICHT glauben.
N.K.: Was? (lacht) Oder alles?
W.L.: Ich erkläre. Den Wissenschaftlern und Beamten, die sagen, dass das Atom friedlich ist. Das darf man nicht glauben. Keine Erfindung der Menschheit wird je friedlich sein, wenn sie nicht kontrolliert und überwacht ist. Sobald Kontrolle oder Überwachung verloren sind, wird jede Erfindung tödlich. Deshalb darf man den Wissenschaftlern und Beamten nicht glauben. Man darf den Politikern nicht glauben, die sagen: „Tue jetzt, heute alles für den Staat, später wird der Staat alles für dich tun.“ Das darf man nie glauben. Heute sag´ ich es jedem offen. Und ich sag´ es jenen Burschen, die jetzt in Donbass sind: Glaubt nicht. Sobald ihr eure Aufgabe erfüllt habt, wird keiner der Politiker euch je mehr benötigen. Das ist zweifellos. Der Staat wird euch verlassen und die Mutter-Heimat wird zur bösen Schwiegermutter. Wir haben es am eigenen Leibe erfahren. Und erfahren bis heute. Einst hat jemand gesagt, dass wir nach Tschernobyl um fetter Entlohnung willen gefahren sind. Ich sage: Im Mai hab´ ich gar nichts von fetter Entlohnung in Tschernobyl gehört. Aber ich weiß ganz bestimmt, dass wenn eine Dorfhütte in Brand gerät, fasse ich einen Eimer, einen Hakenstock, ein Beil und renne sie zu löschen. Erst danach frage ich: „Wessen Hütte ist es? Was bekomme ich dafür?“ Nein, wenn es ein Unglück gibt, muss man retten. Deshalb war diese fette Entlohnung damals ganz außer Frage. Wenn ich damals nicht aufgefordert worden wäre, würde ich vielleicht etwas selbstständig unternehmen, um dorthin zu geraten und Leute zu retten. Also: Man darf weder Politikern noch Beamten noch, wie es sich herausstellt, Wissenschaftlern glauben. Leuten… Leute sind verschieden. Es gab einen Fall bei meiner Arbeit, als ich schon den Tschernobyl-Status erhalten hatte, Behinderung hatte. Wir durften damals im öffentlichen Verkehr kostenlos fahren, uns wurden Verpflegungen erteilt. Das heißt, ich kaufte einen Lebensmittelsatz für einen halben Preis. Und Leute wurden so neidisch. Eine meiner Kolleginnen sagt mir: „Sieh mal, du hast das, das und das.“ Ich sage: „Lena, machen wir so. Ich tausche mit dir, gebe dir meine Beglaubigung. Fahr kostenlos, niemand wird auf die Karte gucken. Ich werde mit dir gehen und diesen Lebensmittelsatz für dich kaufen. So dass du diese sogenannte Tschernobyl-Verpflegung hast. Das einzige, was ich von dir brauche, ist, dass du 4mal jährlich Blutproben auf meinen Namen gibst.“ – „Und falls ich eine andere Blutgruppe habe?“ – „Deine Blutgruppe ist nicht wichtig. Gebe deine Blutgruppe aber konkret für Liwyi Wladimir Nikolajewitsch. Und mir wird mein Blut eingegossen. Dann übergebe ich dir meine sämtlichen Präferenzen.“ Sie hat geschwiegen, nachgedacht und sagt: „Nein, das will ich nicht.“ Ich frage: „Warum empörst du dich denn? Es wird ja nicht umsonst gegeben. Versuche mal, einen Grad der Behinderung aus bloßem Wollen zu erhalten. Es ist einfach unmöglich.“
N.K.: Na ja, Leute sind verschieden.
W.L.: Ich sage ehrlich, ich habe 3 Jahre lang dagegen gewehrt, einen Grad der Behinderung zu erhalten. Sooft die Schwestern in der Radiologie sagten, Ludmila Jewgenjewna Tschernucha bereite meine Papiere für einen GdB vor, kam ich zu ihr: „Ludmila Jewgenjewna, lassen Sie es.“ – „Nein, die Leiterin hat gefordert.“ – „Dann morgen gehe ich zur Arbeit.“ – „Und ich werde dir dann die Bescheinigung nicht ausstellen.“ – „Kein Problem, man wird mir Arbeitstage melden.“ So.
N.K.: Danke. Wär´s das oder möchten Sie noch etwas hinzufügen?
W.L.: Nein, das wär´s.
[1] Ministerium für Atomenergiewirtschaft
[2] Tschernobyl-AKW