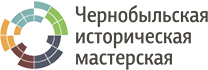Aleksandr
Aleksandr
- Liquidator
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Wohnort:
Die Zeit, in der Tschernobyl-Zone :
Aktivitäten in der Tschernobyl-Zone durchgeführt :
Natalia Koslowa (nachstehend kurz N.K. genannt): Also, heute haben wir den 11. September 2015. Wir sind jetzt im Raum des „Verbandes Tschernobyl“ und ich, Natalja Koslowa, interviewe gerade Herrn – stellen Sie sich bitte vor...
Aleksandr Lykow (nachstehend kurz A.L. genannt): Aleksandr Nikolajewitsch Lykow, geboren 1962 im Dorf Nischneje Dolgoje der Oblast Orjol. Seit 1976 wohne ich hier in Charkiw.
N.K.: Also, meine erste Frage an Sie, die ist ziemlich umfassend, und es ist eigentlich eine Frage und eine Bitte zugleich. Ich bitte Sie, die Geschichte Ihres Lebens zu erzählen, mindestens das, was Sie selbst für relevant halten. Sie können sie vom Anfang an erzählen.
A.L.: Die Geschichte meines Lebens also… Ich zog nach Charkiw um, schloss hier die Mittelschule ab, wurde zum Pflichtwehrdienst in die sowjetischen Streitkräfte einberufen[1], arbeitete danach als Fahrer. 1987 wurde ich durch das Charkiwer Militärkommissariat zur Beseitigung der Folgen der Havarie im Atomkraftwerk Tschernobyl einberufen. Ich diente bei der Einheit 49-903, wo ich die Fahrzeuge und die Maschinen bediente, die im Kraftwerk eingesetzt wurden. Einmal fuhren wir zum Kraftwerk, sonst bedienten wir die Fahrzeuge, die im Kraftwerk eingesetzt wurden. Ich wurde am 18. Juli einberufen und blieb da drüben bis zum 27. September.
N.K.: 1986?
A.L.: 1987.
N.K.: Ach so, 1987.
A.L.: Genau, 1987. So bekam ich eine Strahlungsdosis. Damals betrug die höchst zulässige Strahlungsdosis 10 Röntgen.
N.K.: Pause?
A.L.: Ja bitte. (Pause)
N.K.: Können wir weiter machen?
A.L.: Ich bekam also eine Strahlungsdosis von 5,27 Röntgen, während die höchst zulässige Strahlungsdosis 10 Röntgen betrug. Wir verfügten weder über Speicher noch über Strahlungsmessgeräte. Eingetragen wurden unsere Strahlungsdosen…
N.K.: Ins Blaue hinein…
A.L.: Wie der Kommandant sagte… So diente ich 2,5 Monate da drüben mit täglichen Strahlungsdosen von 5,27 Röntgen. Als ich nach Hause zurückkehrte, setzte ich meine Arbeit als Fahrer fort. Aber nach jenen 2,5 Monaten arbeitete ich immer weniger und landete immer öfter in Krankenhäusern. Ich litt nun an furchtbaren Kopfschmerzen, verweigerte es aber sehr lange, zum Arzt zu gehen. Bis die Kopfschmerzen gar unerträglich wurden. Erst 2009 stellte ich mich bei einer Klinik vor. Meine Unterlagen wurden ausgewertet, und es wurde der Zusammenhang[2] bestätigt. Mir wurde die Behindertengruppe 2 zuerkannt. Eigentlich wurde mir die Behindertengruppe 3 zuerkannt, wegen progredienter Verschlechterung des Gesundheitszustandes wurde mir dann später die Behindertengruppe 2 zuerkannt. Momentan bestreite ich meinen Lebensunterhalt mit 2 419 Hrywnja Mindestrente, von denen man kaum leben kann. Ehrlich gesagt kommen mir allein die Tabletten teuer zu stehen, geschweige denn…
N.K.: Sagen Sie bitte, wie wurden Sie nach drüben transportiert? War ihr Transport gut organisiert? Wie gelangten Sie nach drüben?
A.L.: Also, der Transport nach drüben war tadellos organisiert. Wir wurden in der Sammelstelle an der Kozarskaja Straße versammelt. Mit dem Zug kamen wir nach Bila Zerkwa. Dort zogen wir uns um, stiegen in die SILe (SIL-130)[3] und URALe[4] ein und fuhren damit ins Dorf Orane, das als Sammelort diente. Von dort aus wurden wir alle in unsere Einheiten geschickt. Um die Rückreise sollten wir uns schon selbstständig kümmern. (A.L. lacht)
N.K.: Nach Hause gingen Sie also selbstständig und auf eigene Kosten?
A.L.: Genau. Zuerst kamen wir wieder nach Bila Zerkwa, wo wir unsere Kleidung erhielten (die wurde dort nämlich während der Zeit, da wir da drüben waren, aufbewahrt), und gingen dann nach Hause.
N.K.: Ich bitte um Entschuldigung für eine vielleicht unanständige Frage. Waren Sie damals schon verheiratet?
A.L.: Ja, ich war schon verheiratet und hatte ein Kind, das 1984 geboren war. Nach Tschernobyl bekam ich noch eines, einen Sohn. Gott sei Dank, leidet er an keine genetischen Krankheiten, die durch die Strahlungseinwirkung bedingt sein könnten.
N.K.: Gott sei Dank.
A.L.: Genau. Er hat selber schon einen Sohn… So läuft’s bei uns.
N.K.: Wo wurden Sie da drüben unterbracht?
A.L.: Wir wohnten in Militärzelten mit zweistöckigen Pritschen. Da es schon September war, wurden die schon beheizt. In der Mitte des Zeltes stand normalerweise eine Burschujka[5]. Wir aßen in der Kantine. Das Essen wurde in großen Kesseln zubereitet. Die Kessel waren mit 180 Mikroröntgen pro Stunde, unsere Betten – mit 220 Mikroröntgen pro Stunde belastet. Wurde das alles mit einem einheimischen Strahlungsmessgerät geprüft, zeigte es 0,03, was als zulässige Strahlungsdosis galt. Als ein Seemessgerät einmal geholt wurde und die Nuklide und β-Zerfall damit geprüft wurden, ergaben sich viel höhere Strahlungswerte. Wir bekamen also das Essen, das in den kontaminierten Kesseln zubereitet wurde, und schliefen in den kontaminierten Betten. Täglich wurden jedoch Decken und Matratzen ausgeklopft …
N.K.: Wegen des radioaktiven Staubs?
A.L.: Ja. Dann kam unser Bataillonskommandant auf eine noch bessere Idee, die Wattematratzen durch Schaumstoffmatratzen zu ersetzen. Der Schaumstoff ist doch eine Art Schwamm, der den ganzen Staub aufsaugt, und es ist halt unmöglich, ihn abzustäuben. So einen Streich spielte der Bataillonskommandant uns…
N.K.: Na ja
A.L.: …einen „schönen“ Streich…
N.K.: Unter Anführungszeichen, stimmt‘s?
A.L.: Aber sicher.
N.K.: Wie hieß Ihr dortiger Wohnort?
A.L.: Wir wohnten in der 30-km-Zone, im Dorf Orane.
N.K.: Also unmittelbar in Orane.
A.L.: Doch.
N.K.: Also in der Nähe.
A.L.: Ja, etwa 15 km von der Brigade 25 entfernt. Sie waren eigentlich alle aufeinander gehäuft und befanden sich in einem geringen Abstand voneinander.
N.K.: Dann so eine Frage… Während Sie da drüben waren, beobachteten Sie wahrscheinlich, wer noch eingesetzt wurde. Ich nehme an, es gab lauter männliche Militärangehörige. Welche Arbeiten wurden aber den Männern anvertraut und welche – den Frauen? Gab es vielleicht eine gewisse Arbeitsteilung?
A.L.: Na ja… Was die Arbeitsteilung angeht, so gab es in unserer Einheit keine Frauen. Im Städtchen Selenyj Mys gab es aber freie Lohnarbeiterinnen, ganz junge Frauen. Ich weiß das, weil wir ein paarmal in dieses Städtchen zu Sportwettkämpfen gingen. Es gab überhaupt sehr viele junge freie LohnarbeiterInnen. Laut einer Anordnung sollten alle jungen Leute, die ihr 30. Lebensjahr damals noch nicht vollendet hatten, aus der Zone weg. Aber die freien LohnarbeiterInnen blieben dort. Aus den mir unbekannten Gründen waren es überwiegend junge Frauen. Sie verdienten dort gute Kohle. In unserer Einheit gab es aber keine Frauen.
N.K.: Ok.
A.L.: Es gab Köchinnen wie Köche (A.L. lacht). Es waren drüben alle Altersgruppen vertreten. Es gab ganz junge Männer, die gerade vom Pflichtwehrdienst entlassen worden waren, sowie Männer, die ihr 50. Lebensjahr noch nicht und schon vollendet hatten. Manche von ihnen wurden sogar einberufen. Die Arbeitsbedingungen waren aber für alle – egal, ob jung oder alt, - gleich, niemand achtete auf das Alter. Alle hatten der Reihe nach Außendienst, es gab wiederum keine Ausnahmen. […]
N.K.: Und wie war die Verpflegung? Wie schätzen Sie ein? Hungerten Sie dort?
A.L.: Nein. Wir bekamen jeden Tag gezuckerte Kondensmilch und Butter, also eine verstärkte Verpflegung. Die freien LohnarbeiterInnen bekamen dazu noch Schokolade, das sagten sie uns. Jeden Tag wurden uns Filme gezeigt. Eine Zeit lang zwang man uns, in die Kantine im Exerzierschritt zu gehen, musste aber schnell darauf verzichten.
N.K.: Waren Sie alle dagegen?
A.L.: Niemand wollte diesem Befehl nachgehen. Es gab doch ältere Leute unter uns, und es war absurd, sie nach der Arbeit in die Kantine im Exerzierschritt gehen und dabei noch ein Marschlied singen zu lassen. Wir erhoben also dagegen Protest und die Führung hörte auf, uns dazu zu zwingen. So war das Leben dort.
N.K.: Gab es außer den Blütenblättern sonst Schutzmittel?
A.L.: Da wir uns mit den Fahrzeug- und Maschinenreparaturen beschäftigten, hatten wir keinen Anspruch auf Schutzkleidung oder sonstige Schutzmittel. Wir mussten also den Staub einatmen, mit dem die Fahrzeuge bedeckt wurden, die wir reparierten. Man erlaubte uns nicht, auf einer Stelle lange zu bleiben. Bei den Fahrzeugen, die zu uns zur Reparatur kamen, konnten die einen Teile mehr und die anderen weniger kontaminiert sein. Deshalb sollten wir möglichst viel und möglichst oft um diese Fahrzeuge herumlaufen. Doch auch wenn wir uns ständig bewegten, berührten wir ab und zu kontaminierte Teile. Na ja, bevor die Fahrzeuge zur Reparatur kamen, mussten sie zur Wasch- und Entseuchungsstelle, aber trotzdem…
N.K.: Trotzdem waren sie radioaktiv belastet?
A.L.: Genau. Man maß die Strahlungsdosen mit Messgeräten… Das Metall saugte sowieso bestimmte Strahlungsdosen auf, dazu gab es noch den radioaktiven Staub… Unter solchen Bedingungen mussten wir also arbeiten.
N.K.: Erinnern Sie sich an Ihre ersten Eindrücke, die Sie bekamen, als Sie die Zone erreichten? Waren Sie erstaunt oder überrascht?
A.L.: Wir kamen in der Zone an, als es Nacht war. Später… wenn wir die Patienten besuchten… Oh, ich bitte um Entschuldigung, wenn wir eingesetzt wurden…
N.K.: Kamen Sie sich selbst eher als Arzt vor? (N.K. lacht)
A.L.: Tja, früher fuhr ich Notarztwagen (A.L. lacht). Also, damals sahen wir natürlich grauenhafte Sachen. Vor allem waren es die Häuser. Die Fenster und die Türen waren mit kreuzweise festgenagelten Brettern verschlossen. Höfe und Gärten waren mit Unkraut bewachsen. Es war überall menschenleer. Zu Zeiten des Krieges würde es heißen „Alle sind an die Front gegangen“. Das alles sah schauderhaft aus. Ich war einmal in Prypjat. Damals war Prypjat eine junge Stadt. Nach der Dekontaminierung wurde sie aber mit Stacheldraht eingezäunt, irgendwo ertönte Musik… Das machte einen schauderhaften Eindruck. Sobald wir nach drüben kamen, traten Symptome wie Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen auf. Uns wurde verboten, die ärztliche Hilfe bei der Sanitätsstelle oder woanders zu ersuchen. Denn das war die Eingewöhnungsphase, die auf die Strahlung zurückzuführen war. Nach zwei Wochen ließen diese Symptome nach. Als wir nach Hause kamen, gab es sie wieder – Schnupfen, Halsschmerzen und so weiter – bis wir uns wieder eingewöhnten. In Prypjat gab es einen Hafen, wo Schiffe sicher lagen. Und natürlich waren alle Schiffliegeplätze auch menschenleer und verschlossen.
N.K.: Meinen Sie den Fluss Prypjat?
A.L.: Genau. Es wurde dort alles verlassen. In den Wäldern gab es viele Pilze, manche von uns sammelten und brieten sie. Die Pilze waren natürlich… Also sie hatten alle gute Stiele und große Köpfe… Ich kostete grüne Äpfel.
N.K.: Hatten Sie denn keine Angst?
A.L.: Na ja, schon, aber erst später, nachdem wir schon die Äpfel gegessen hatten…
N.K.: Und während Sie aßen, hatten Sie also keine Angst? (N.K. lacht)
A.L.: (A.L. lacht) Erst später begriffen wir, dass man so was lieber nicht hätte tun müssen. Als wir einberufen wurden, waren wir uns offen gestanden kaum bewusst, wohin wir eigentlich gingen. Niemand gab sich Mühe, uns was zu erklären. Wir hatten zwar alle in der Schule Zivilschutz gelernt, waren uns aber nicht im Klaren, was die Radioaktivität ist, was sie bedeutet. Wir stellten uns nicht vor, wie gefährlich die Radioaktivität sein kann. Die war doch unsichtbar. Na ja, wir sahen zwar verlassene Häuser und Unkraut, empfanden aber außer Schnupfen und Halskratzen nichts. Aber natürlich spielte dieses Unsichtbare später eine verhängnisvolle Rolle.
N.K.: Und wie reagierte Ihre Familie auf Ihre Dienstreise? Wie reagierte man darauf überhaupt?
A.L.: Wie konnte meine Familie reagieren… Damals gab es nur eine Reaktion. Wenn dein sowjetischer Heimatstaat dir was befiehlt, sollst du dem Befehl nachgehen, ohne lange nachzudenken. Wir erfüllten bloß unsere Pflicht. Die Familie hatte dagegen nichts einzuwenden.
N.K.: Erinnern Sie sich daran, wie die Gesellschaft damals diese Ereignisse wahrnahm? Waren Sie als Katastrophe empfunden? Wie nahm das Volk das alles wahr?
A.L.: Also, diejenigen, die da drüben nicht waren, die… Das alles wurde also nicht ernst genommen. Die übrigen Menschen waren nach wie vor mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Die durch die Havarie Betroffenen wie etwa zum Beispiel die Umsiedler, die ihre Häuser verlassen mussten, spürten das alles hautnah… Genauso wie Menschen in den heutigen Donezk und Luhansk.
N.K.: Es lassen sich also Parallelen ziehen.
A.L.: Diese Menschen verloren alles. Na ja, es wurden zwar manchen neue Wohnverhältnisse gewährt, aber die meisten wurden tatsächlich obdachlos. Was die Menschen angeht, die fern davon waren, so begriffen, glaube ich, nur wenige den ganzen Ernst der Lage.
N.K.: Gab es Zwischenfälle, die Sie vielleicht miterlebten oder die Ihnen passierten und die sich Ihnen ins Gedächtnis einprägten? Sollen wir eine Pause einlegen? (Pause) Gut. Wie war Ihre Freizeit gestaltet? Hatten Sie überhaupt Freizeit und wie war sie gestalten?
A.L.: Wie wurde unsere Freizeit gestaltet? Uns wurden Spielfilme gezeigt, es gab des Öfteren Konzerte, prominente Pop-Sänger gastierten oft bei uns. Wir nahmen außerdem an Sportwettbewerben teil, die in Selenyj Mys stattfanden. Sonst gab es keine Quize oder so etwas, denn eigentlich war niemand zu solchen Sachen auferlegt. Nach den Einsätzen kamen alle müde, gingen sich waschen... Wir hatten ein Dampfbad – ein Militärzelt mit fließendem Wasser.
N.K.: Also, es war einigermaßen eingerichtet
A.L.: Na ja. Es gab warmes Wasser. Man wusch sich, aß zu Abend, sah sich einen Spielfilm an und ging schlafen. So war unsere Freizeit. Sonst…
N.K.: Spielten Sie vielleicht Schach, Domino oder Karten?
A.L.: Nein, wir hatten weder Schach, noch Domino. Und einen extra dafür eingerichteten Raum hatten wir auch nicht.
N.K.: Wurde es vielleicht im Stillen gespielt?
A.L.: Nein, glaube ich, nicht, so was fiel mir allerdings nicht auf.
N.K.: Klar.
A.L.: Ich glaube, es wurde nicht gespielt…
N.K.: Aha. Gab es vielleicht einen Moment, da sie die damaligen Ereignisse als Katastrophe wahrnahmen? Wenn ja, wann kam er?
A.L.: Meinen Sie, wie und wann empfand ich das alles als Tragödie?
N.K.: Ja… Sie wissen doch, wie es oft ist. Man hört eine Nachricht. Zuerst legt man darauf keinen großen Wert. Dann fragt man sich: „Mein Gott, was ist dort eigentlich passiert?“ Manche begreifen den Ernst der Lage, erst nachdem sie alles vor Ort gesehen haben... Wann begriffen Sie es?
A.L.: Erst später. Vorher hatte ich keine Ahnung von Krankenhäusern. Doch später, als ich des Öfteren dort landete …
N.K.: Also, als Sie in Krankenhäusern landeten. Nicht während des Aufenthaltes in der Zone.
A.L.: Nein. Während des Aufenthaltes da drüben machte ich mir darüber keine Gedanken. Es war wie bei einer normalen Arbeit. Wir kamen jeden Tag zu unserem Arbeitsplatz und erfüllten Aufgaben, die uns erteilt wurden. Erst später, als viele von uns in Krankenhäusern landeten, begriffen wir, wo wir eigentlich gewesen waren und was uns danach passierte. Aber damals legten wir darauf keinen großen Wert. Ich versuchte sogar, meinem Sohn die gezuckerte Kondensmilch aus diesem Ort zu schicken. (A.L. lacht).
N.K.: (N.K. lacht) Meine Güte, was sie nicht sagen.
A.L.: Na ja, wir waren uns nicht bewusst, dass es innerhalb der Dose das gab, was…
N.K.: Sie waren sich also des Ernstes der Lage nicht bewusst?
A.L.: Ganz und gar nicht. Das Leben dort war einigermaßen dem Zivilleben gleich.
N.K.: Als Sie zurückkamen, wurden Sie als Mensch, der da drüben war, von Ihrer Umgebung irgendwie anders behandelt?
A.L.: Ja. Es kamen meine Freunde. Natürlich wurde ein Korn auf die Rückkehr runtergeschüttet…
N.K.: Sie tranken also auf die Rückkehr?
A.L.: Na selbstverständlich. Wie es sich gehört. Ich war auf mich stolz und es war unumstritten angenehm, im Mittelpunkt zu stehen. Genauso war es auf meinem Arbeitsplatz. Dazu erhielt ich einen erhöhten Lohn. Alle gratulierten mir dazu. Für 2,5 Monate erhielt ich 600 Rubel. Dann kam alles wieder ins Lot.
N.K.: Klar.
A.L.: Ja.
N.K.: Sehr oft kann man im Internet lesen oder an Universitäten und Hochschulen hören, dass immer mehr Jugendliche gerne in die Zone als Touristen fahren würden. Was halten Sie von solchen Exkursionen. Braucht man sie oder sind sie eher überflüssig? Wie ist Ihre Meinung?
A.L.: Ich bin der Meinung, man sollte nach drüben lieber nicht gehen. Wir wissen jetzt schon alle, wie lange der freie Atomzerfall dauert. Es wird doch hin und wieder gesagt, es sei dort schon alles in Ordnung und es werde dort bald geackert und gesät... Ich glaube aber, es ist ein totaler Quatsch. Es gibt da wenig Spannendes. Hat man Lust zu erfahren, was es dort alles gibt, kann man sich schließlich Fotos ansehen und sich die Erinnerungen anderer Menschen anhören. Doch ich würde niemand raten, nach drüben zu gehen, um alles hautnah zu erleben. Man muss doch seine Gesundheit ernst nehmen. Und ich meine, es lohnt sich nicht, nach drüben zu gehen.
N.K.: Wäre es nicht gefährlich nach drüben zu fahren, wäre es jetzt unschädlich, sich dort aufzuhalten, würden Sie vom emotionalen Aspekt her, nach drüben fahren? Möchten Sie die Orte sehen, wo sie einst gearbeitet haben?
A.L.: Wäre dort alles in Ordnung, würde ich die Zone mit meinen Kindern und Enkeln gerne besuchen.
N.K.: Also, Sie würden die Zone gerne besuchen?
A.L.: Ja. Ich würde die Orte besuchen, wo ich gearbeitet habe, und sehen, wie es dort heute ist. So ist es halt.
N.K.: Was halten Sie von Veranstaltungen zum Gedenken daran, was sich 1986 in Tschernobyl ereignete? Genügen Sie? Sollten Sie vielleicht ein bisschen anders sein? Was muss noch getan werden, damit die Tragödie von Tschernobyl im kollektiven Gedächtnis verankert bleibt?
A.L.: Zur Durchführung von allerlei Veranstaltungen meine ich… Also, ja, es gibt Veranstaltungen, die auf städtischer Ebene, auf Oblast- oder Rayonebene durchgeführt und entsprechend finanziert werden… Zum Beispiel kommen wir alle zweimal jährlich zu den Gedenkmaßnahmen, die am Tschrnobyler-Denkmal im Park „Molodjoschnyj“ stattfinden. Natürlich könnte man diesen Maßnahmen vielleicht etwas hinzufügen, aber im Großen und Ganzen sind die Veranstaltungen, die die Stadt organisiert, ganz angemessen. Das Bürgermeisteramt legt darauf einen ganz großen Wert und kümmert sich um städtische Verbände, die Verbände, die es in der Oblast Charkiw oder in den Rayons, die dem Oblast Charkiw angehören, gibt, werden aber im Stich gelassen.
N.K.: Wirklich? Können Sie ein paar Beispiele anführen? Welche Orte sind im Stich gelassen? Bin halt neugierig.
A.L.: Ich komme zum Beispiel aus Wassischtschewo[6]. Wir sind uns selber überlassen. Nicht einmal einen Vorsitzenden haben wir.
N.K.: Verstanden.
A.L.: So. Niemand kümmert sich um uns.
N.K.: Verstanden.
A.L.: Sieht so aus, als ob uns niemand braucht. Deshalb schlagen wir die Brücken zu den städtischen Verbänden und besuchen Veranstaltungen, die im Park „Molodjoschnyj“ stattfinden. Man könnte doch vielen von uns ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Zum Beispiel haben manche Auszeichnungen, manche haben die aber nicht und fühlen sich beleidigt, weil sie sozusagen unberücksichtigt sind.
N.K.: Meine letzte Frage behandelt die nächsten Generationen. Welche Konsequenzen wurden dem Nachwuchs überlassen, den Kindern, die noch sehr klein sind und denjenigen, die in der Zukunft zur Welt kommen? Was würden Sie, wenn Sie auf Ihr Leben, auf die Erfahrung und die Kenntnisse, die Sie erworben haben, zurückblicken, sagen, was den nächsten Generationen von Nutzen wäre? Woran sollen sie immer denken, was dürfen sie nie vergessen? Was könnten Sie also sagen, wenn Sie auf das alles zurückblicken?
A.L.: Weiß ich nicht. Man muss natürlich immer im Bilde sein, dass die Radioaktivität sehr gefährlich ist und viele Leiden bringen kann. Was noch? Weiß ich nicht.
N.K.: Und was ist für den Menschen wichtig? Was halten Sie persönlich für wichtig? Worauf würden Sie unbedingt großen Wert legen?
A.L.: Ich meine, es ist wichtig, deine Pflicht zu erfüllen. Andererseits muss man immer an die Menschen denken, die ihre Pflicht erfüllt haben, und sie respektieren. Denn unsere Heimat erinnerte sich an uns, wenn wir sie retten mussten. Nachdem wir sie gerettet hatten, gerieten wir in Vergessenheit.
N.K.: Diese Erfahrung muss also berücksichtigt werden?
A.L.: Ja, unbedingt. Ich meine, die ist sehr wichtig. Und unsere Regierung muss ständig daran erinnert werden, dass wir unsere Pflicht erfüllt und das Land gerettet haben. Das muss bei uns groß geschrieben werden. Sonst weiß ich nicht, was ich hinzufügen kann.
N.K.: Danke.
[1] In der Sowjetunion bestand für die meisten männlichen Staatsbürger die Wehrpflicht. Die Dienstzeit betrug für Soldaten und Unteroffiziere normalerweise zwei Jahre.
[2] Die Verbindung zwischen den Strahlungsdosen, die die Menschen während ihrer Arbeit oder Dienstzeit in Tschernobyl und der 30-km-Zone bekamen, und den Krankheiten, an denen sie danach litten. Wurde die Verbindung bestätigt, gewährte es einem soziale Privilegien.
[3] SIL steht für die Marke sowjetischer LKWs und Busse, die der Kraftwagenbetrieb „Sawod imeni Lichatschowa“ (kurz SIL genannt) herstellte.
[4] URAL steht für die Marke sowjetischer Nutzfahrzeuge, die der Kraftwagenbetrieb „Uralski Awtomobilny Sawod“ hergestellte.
[5] (rus.) Kanonenofen, ein gusseiserner zylinderförmiger Ofen.
[6] Dorf in der Oblast Charkiw