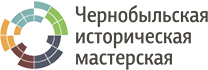Anatolij
Anatolij
- Liquidator
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Wohnort:
Die Zeit, in der Tschernobyl-Zone :
Gelinada Grintschenko (G.G.): Großartig. Heute haben wir also den 13. März 2013 und sind jetzt im Raum des „Verbandes Tschernobyl“. Über seinen Aufenthalt in Tschernobyl erzählt uns heute…
A.G.: Ich stelle mich gerne vor. Ich heiße Anatolij Aleksandrowitsch Gubarew und bin Präsident des eingetragenen Vereins „Verband Tschernobyl“.
G.G.: Anatolij Aleksandrowich, ich möchte mich bei Ihnen für die Angelegenheit herzlich bedanken, Ihre Lebenserinnerungen zu lesen. […] Sie haben darin ziemlich ausführlich und emotional Ihren Aufenthalt in Tschernobyl geschildert: Wie Sie überhaupt hingeraten sind, wie sie zum ersten Mal dorthin kamen. Darf ich aber ein paar präzisierende Fragen stellen?
A.G.: Gerne.
G.G.: Was ihren ersten Besuch in der Zone, wo sich die Havarie ereignete, und jenen Arbeiten, die Sie ausführen mussten, anbetrifft, waren Sie dort, soviel ich aus Ihren Erinnerungen verstanden habe, vom 9. Mai bis zum 6. Juni. Stimmt das?
A.G.: Ja. Genau.
G.G.: Meine erste Frage ist eben mit dem 9. Mai verbunden. Hatten Sie damals mit dem Tag, an dem Sie dorthin kamen, keine Assoziationen?
A.G.: Wissen Sie, ich hatte selbstverständlich bestimmte Assoziationen, und ich musste natürlich bestimmte Parallelen ziehen. Und die waren, glaube ich, unerfreulich. Es fällt mir ein, dass wir in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai aus dem Rayon Balakleja ausreisten und irgendwo in dem Oblast Poltawa, ganz in der Nähe der Stadt, übernachteten. Am Nachmittag des 9. Mai (oder war es vielleicht Mittag?) zogen wir nach Kyjiw ein. Zuerst konnte ich nicht kapieren, wieso wir über Kyjiw fuhren. Und erst später begriff ich, was des Pudels Kern war. Man versuchte in erster Linie unseren Kampfgeist zu steigern. Uns zu zeigen, dass die Stadt lebt. Uns zu zeigen, dass die Stadt noch einen Tag des Sieges gefeiert hat. Uns schöne, bunte Lichter, Plakate und anderes mehr zeigen. Unsere ganze Kolonne hielt in Kyjiw an. Wir blieben irgendwo am Ufer des Dnipro (Dnepr) 20 Minuten stehen. Wir atmeten also die Kyjiwer Luft auf. Dann stiegen wir in die Wagen ein und fuhren weiter. Natürlich hatte man ein gewisses Beängstigungsgefühl. Wieso? In meinen Lebenserinnerungen beschrieb ich, was sich mir ins Gedächtnis einbrannte. Die älteren Menschen erinnern sich sicher an die Motorfahrräder „Werchowina“. Mir ist also ein mit einer ganzen Familie beladenes Motorfahrrad „Werchowina“ im Gedächtnis haften geblieben. Ich weiß nicht, ob Sie davon gelesen haben?
G.G.: Nein.
A.G.: Nein? Also an diesen Zwischenfall erinnern Sie sich nicht. Es bleibt immer das Erste und das Letzte im Gedächtnis, pflegte Stierlitz[1] zu sagen. Also, das Erste, was damals auffiel, waren die Dorfbrunnen, an denen wir vorbeifuhren. So.
G.G.: Tja, das wurde schon erwähnt.
A.G.: Und die waren mit PE-Folie bedeckt.
G.G.: Was sollte das bedeuten? Was wäre so Besonderes daran?
A.G.: Was war daran so Besonderes? Dass die nicht mehr nutzbar waren. Allem Ansehen nach waren schon die Wasserentnahmen vorgenommen, und es hatte sich herausgestellt, dass das Wasser schon kontaminiert war. Damit die Einheimischen das radioaktiv verseuchte Wasser nicht benutzen, wurden die Brunnen mit PE-Folie bedeckt und verschlossen. Damit die Menschen dieses Wasser nicht benutzen. Einerseits wäre es in Ordnung. Andererseits fing ich im Bus gleich an, mir Gedanken zu machen: Wie lange kann der Mensch ohne Wasser aushalten? Woher soll er das Wasser kriegen, wenn alle Brunnen verschlossen sind? Im offenen Fluss oder anderswo? Das Wasser bedeutet doch das Leben. So. Deshalb blieb mir dieser Augenblick im Gedächtnis haften. Auch später gab es einen Moment, der sich mir im Gedächtnis einbrannte, von dem ich schon zu erzählen angefangen habe. Aus mir unbekannte Gründe fuhren wir ziemlich langsam. Wahrscheinlich war das auf eine Kolonne zurückzuführen, die aus einem innerhalb der Sperrzone liegenden Ort in der uns entgegengesetzten Richtung ging. Und ausgerechnet in dem Augenblick, als ich mich umdrehte, sah ich dieses Motorfahrrad „Werchowina“ vorbeifahren. Darauf saßen der Familienvater – ein junger Mann von, glaube ich, meinem Alter, etwa 26 Jahre alt, und seine Frau, die etwa 20-21 Jahre alt war, zwischen ihnen saß ihr ein oder ein halbes Jahr altes Kind, der 10 x 15 cm Kofferraum war mit einer sowjetischen Awosjka[2] beladen, in der alles Mögliche gestopft war. Und so verließen sie ihr Haus und fuhren mit diesem Motorfahrrad (der Begriff ist ungewöhnlich, handelt es sich vielleicht um ein Moped?) von der Strahlung weg. Das hinterließ einen unumstritten starken Eindruck. Vorher waren wir darüber nicht im Klaren gewesen, wohin wir gehen. Das Beängstigungsgefühl gab es natürlich. Und hier nahm diese Beängstigung reelle Gestalt an. Ich sah ein, dass es sich um eine ziemlich komplizierte Situation handelt, da die Menschen den Ort möglichst schnell und mit allen zugänglichen Verkehrsmitteln verlassen. Das war eben das erste Moment. Nun wiederum was den 9. Mai angeht, hatte ich an dem 9. Mai das Gefühl nicht, das man normalerweise zu diesem Tag bekommt, da man sich an die Heldentaten unserer Väter und Großväter erinnert. So. Es war eher das Beängstigungsgefühl, (von Angst) weil wir ins Unbekannte gingen.
G.G.: Wenn wir über das Unbekannte sprechen, sagen Sie bitte, wann das Unbekannte ins Bekannte hinüberwuchs und Sie sich Klarheit darüber bekamen, was Sie tun?
A.G.: Man kann doch nicht…
G.G.: Bis zu welchem Moment überwog das Unbekannte?
A.G.: Man kann doch nicht alles sozusagen in Schwarz und Weiß färben. Ich würde nicht sagen, dass ich nichts wusste. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt viel mehr als meine Kollegen verstand.
G.G.: Warum?
A.G.: Warum? Viele Sachen wurden mir vom allerersten Augenblick an klar. Wir wurden am 4. Mai einberufen. Informationen gab es damals fast keine, es gab tatsächlich keine Informationen. In meinen Lebenserinnerungen steht, dass ich dazu, was geschehen war, am 28. oder am 29. Mai (an ein genaueres Datum kann ich mich nicht mehr erinnern) in der Zeitung „Komsomolskaja Prawda“[3] tatsächlich zwei oder drei Zeilen auf Seite 3 (normalerweise wurden die TASS[4]-Meldungen auf der ersten Seite veröffentlicht, diese Meldung stand aber auf Seite 3) fand: „Im Atomkraftwerk von Tschernobyl werden die Folgen der Havarie beseitigt“. Niemand wusste, was Tschernobyl ist; niemand verstand, um was für eine Havarie es geht; niemand begriff das Ausmaß dieser Havarie. Denn, wie wir alle wissen, sprach der damalige Präsident der Sowjetunion Michail Sergejewitsch Gorbatschow das Volk erst am 7. Mai an. Am 7. Mai. Vorher gab es lauter Gerüchte. Es war schon Anfang Mai, und dazu noch kannte sich niemand mit der Situation aus. Trotzdem fällt mir noch eine ganz eindrucksvolle Episode ein. Mein Nachbar, ein ganz junger Mann, kehrte von der Armee zurück. Er kam nämlich am 30. April zurück.
G.G.: Aha.
A.G.: Es war also der 4. Mai, der fünfte Tag seiner Freiheit. Der junge Mann fing erst an, die Freiheit zu genießen, feierte die irgendwo (umso mehr, dass Ostern im Jahr 1986 auf den 4. Mai fiel). Als sich der Tag seinem Ende näherte, wurden wir einberufen. Ich kannte ihn noch vor seinem Wehrdienst. Wir spielten Volleyball zusammen. Obwohl er drei Jahre jünger war als ich, spielten wir jedes Wochenende in einer der Schulen, wo wir die Sporthalle für die Fälle, da das Wetter schlecht war, mieteten. Oder, wenn das Wetter gut war, spielten wir im Schulhof. Die Schule lag an der Slinko Straße, wir trafen uns jedes Wochenende zum Volleyball- und Tennisspielen. Ich hatte ihn also noch 6 Jahre vor den Ereignissen kennen gelernt. Und plötzlich sah ich ihn, den Oleg Malyschew, in den Palast der Pioniere des Rayons Ordschonikidzewskij gehen, wo wir versammelt wurden. Ich hatte mich schon angemeldet, und als ich ihn sah, kam ich zu ihm und sagte: „Oleg, weg von hier!“ „Wieso denn? Was ist los?“ frage er mich. Dazu war er, wie wir schon wissen, etwas beschwipst. „Lass mich in Ruhe, ich gehe nicht weg!“ „Los, das ist doch Tschernobyl, du hast dort nichts zu suchen!“ Also, ich war mir der Sache irgendwie bewusst, ich verstand alles, obwohl ich nichts dazu sagte. Das nächste Moment, da ich anfing, etwas zu verstehen, kam, als wir um drei Uhr nachts nach Sawintzy kamen und uns umziehen mussten. Es fiel mir auf, dass wir komplett neue Militäruniformen bekamen, obwohl es uns ursprünglich gesagt worden war, wir gingen zur Reservistenausbildung. Doch wenn man zu Zeiten der Sowjetunion zur Reservistenausbildung musste, erhielt man normalerweise gebrauchte Uniformen. Und da begriff ich, dass es sich um etwas Ernsthaftes handelt. Als wir zur neuen Uniform noch Gasmasken erhielten, wurde es mir endgültig klar, dass meine Vermutungen durchaus richtig waren. Von der Schule her wusste ich, was radioaktive Strahlung bedeutet. Von der Schule her kannte ich mich in dem Bereich aus, deshalb bin ich nicht der Meinung, dass ich überhaupt nichts wusste. Als wir ins Truppenlager kamen, fingen wir an, Zelte aufzustellen. Als wir begannen, Zelte aufzustellen, wurden uns ungeschliffene Kieferholzplatten geliefert. Es waren absolut rohe, frisch abgesägte, ein wenig nasse Holzplatten, aus denen wir uns Pritschen basteln sollten. So. Und da kam es zu meiner ersten Konfrontation mit der Leitung. Weswegen? Vorschriftsmäßig sollte man die Höhe der Pritschen… Für je eine 40 Mann starke Truppe war ein Zelt bestimmt. Und in so einem riesigen Zelt mussten die Pritschen in einer maximalen Höhe 40 cm liegen. Ich sagte aber, wir werden die Pritschen machen, die einen Meter vom Boden entfernt sein werden. Viele lachten mich damals aus.
G.G.: Aha.
A.G.: Da blieb mir nichts anderes übrig, als denen zu erklären, warum ich so denke. […] Deshalb sagte ich, dass die Pritschen möglichst hoch liegen müssten. Das würde uns retten. So würden wir weniger bestrahlt. Es gab also einen Streit. „Ihr… Du willst keine Pritschen, sondern Tische bauen,“ wurde mir gesagt. Trotzdem folgte man meinem Rat. Ich weiß nicht warum, aber ich schaffte es damals, die zu überzeugen. Unser Zelt war das einzige Zelt, wo die Pritschen in einer Höhe von 90 cm lagen. Zuerst gab es, gelinde gesagt, Ärger. Weil man auf die Pritschen hoch springen musste. Die Möglichkeit, auf die Pritsche einfach zu fallen, war ausgeschlossen. Wodurch unterschied sich außerdem der Mai von 1986? Die Tage waren damals sehr heiß, wie heute, da die Temperatur bei 30 liegt, aber nachts fröstelte es. Das Zelt hatte abfallende und ziemlich niedrige Ränder. Wären die Pritschen 40 cm hoch gewesen, hätten wir an der Wand gelegen, denn die Wand war ein Meter hoch. Aber da unsere Pritschen in etwa 90 Meter Höhe lagen, können Sie sich wohl vorstellen: Da 40 Männer atmen, bildet sich das Kondenswasser. Nachts wachten wir auf und entdeckten, das unsere Haare ans Zelt kleben geblieben waren (A.G. lacht). Und es war also nicht leicht, sich abzulösen. So. Solche Momente gab es auch. Es waren trotzdem gute 15 Jahre vergangen, als ich meinem Kompaniechef begegnete und der sich bei mir bedankte. Auf meine Frage, wofür er mir dankt, sagte er: „Erinnerst du dich an die Pritschen, die wir damals gebaut haben?“ „Ach so, haben wir damals die Pritschen gebaut…“ sagte ich. „Und erinnerst du dich, wie du damals geschrien hast, man sollte das lieber nicht tun?“ Tja, so was gab es wirklich. Da wir damals auf eigene Faust die Pritschen höher als vorgeschrieben bauten, wurden wir, glaube ich, doppelt oder dreimal so wenig bestrahlt, auch wenn es mindestens um die Background-Strahlung geht, die uns umgab.
G.G.: Aha.
A.G.: Es war im Mai. Deshalb sage ich Ihnen nochmals: Ich glaube, dass ich damals etwas schon verstand.
G.G: OK. Nun erklären Sie mir Folgendes: Wie reagierten Ihre Verwandten, wie reagierte Ihre Familie auf Ihre Reise nach Tschernobyl, umso mehr, dass Sie gestehen, dass Sie damals schon etwas verstanden?
A.G.: Tja, es war ein kaum zu unterschätzendes Problem. Ein Problem, dass mir vielleicht den Rest meines Lebens auf den Fersen folgt und das wie ein Stein auf meinem Herzen liegt. Die Sache ist die, dass ich hier in der Stadt wohnte. Meine Mutter und meine Schwester wohnten im Rayon Tschuhujiw. Ich besuchte sie zu Ostern und ging am 4. Mai schon nach Hause. Als ich nach Hause kam, wurde ich einberufen, ehe ich die Schwelle meines Hauses betrat. Als ich den Einberufungsbescheid erhielt, musste ich mich gleich auf den Weg machen. Eine Telefonverbindung gab es natürlich nicht, ich konnte die Meinen also nicht anrufen. Natürlich sagte ich niemand, wo ich hingehe. Natürlich wusste niemand was. Erst Mitte Mai schrieb ich von dort einen Brief an meine Mutter.
G.G.: An Ihre Mutter.
A.G.: Ich schrieb, wo ich bin. Und erst als ich zurückkehrte, erfuhr ich, dass meine Mutter wegen eines Herzanfalls im Krankenhaus ist.
G.G.: Und Sie wussten nichts davon?
A.G.: Ich weiß nicht, vielleicht fiel alles so verhängnisvoll zusammen… Aber ich bereue, dass ich ihr diesen Brief schrieb. Vielleicht fiel mit diesem Brief eine letzte Barriere, und meine Mutter fing an, an Herzbeschwerden zu leiden. So. Leider ist meine Mutter vor einigen Jahren gestorben. Ich versuchte unzählige Male sie zu überzeugen, sich operieren zu lassen, sich einen Bypass legen zu lassen, sie wagte es aber nicht. Deshalb bleibt das immer bei mir. Ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass ich daran schuld war, dass ich meiner Mutter über Tschernobyl schrieb und das wahrscheinlich der Grund war, warum sie im Krankenhaus landete.
G.G.: Hatten Sie damals selber noch keine Familie?
A.G.: Nein, ich hatte damals keine Familie. Genauer gesagt, hatte ich schon eine Ehe hinter mir… Aber ich war schon längst geschieden und wohnte allein. So. Meine zweite Ehe schloss ich 1987.
G.G.: Es gab also bei Ihnen zu Hause gar kein Abschiedsfest?
A.G.: Nein, keins, absolut keins. Ich kann Ihnen dazu eine ganz andere Geschichte erzählen. Die ist aber keine Abschiedsgeschichte, sondern die Geschichte einer Begegnung. Vielleicht tanzt die aus der Reihe, aber… Am 22. Juni – das Datum behielt ich im Gedächtnis, weil gerade an dem Tag der Große Vaterländische Krieg in unserem Land ausbrach – wurde ich direkt am Arbeitsplatz ohnmächtig. Man holte mich also gleich ins Institut für medizinische Radiologie. Man wusste damals noch nicht, wo Patienten wie ich hingehörten. So. Aber der Name des Institutes stimmte mit der Sache einerseits überein.
G.G.: Na ja.
A.G.: Andererseits hatte das Institut für medizinische Radiologie schon angefangen, die Menschen aus der Zone aufzunehmen. So. Wahrscheinlich landete ich deswegen eben dort. Dort begegnete ich einem Mädchen. Letztes Jahr feierten wir unser Ehejubiläum: 25 Jahre zusammen. Wir haben eine Tochter, die 24 ist. Es geht uns wunderbar. Das ist übrigens meine Ehefrau (A.G. lacht).
G.G.: Klar. (G.G. lacht). Arbeitete sie dort?
A.G.: Ja, sie arbeitete beim Institut für medizinische Radiologie. So ist das.
G.G.: Kein Leid ohne Freud’, nicht wahr?
A.G.: Ja. Genau.
G.G.: Klar. Sagen Sie bitte, ob Sie sich unterwegs nach Tschernobyl mit Ihren Mitreisenden unterhielten?
A.G.: Aber sicher. Sicher.
G.G.: Worüber?
A.G.: Wissen Sie, vielleicht hatte ich wie schon gesagt ein gewisses Beängstigungsgefühl und das Gefühl des Unbek… des Ungewissen.
G.G.: Des Ungewissen?
A.G.: Ja, eher des Ungewissen. Ich hatte keine Angst. Das kann ich Ihnen absolut genau sagen, ich hatte keine Angst. Nur einer von denen, die mit mir im Bus fuhren, war beängstigt. Aber der war und ist sein ganzes Lebens lang beängstigt. Er wagte es nicht, in die Sperrzone zu gehen, und suchte, allen gefährlichen Momenten zu entkommen. Aber solche Menschen bemerkt man gleich. Doch im Grunde genommen wurde die Zeit während der Busreise nicht mit Gesprächen, sondern von Possenreißern ausgefüllt. Mit ihren Streichen schafften sie es, die Leere auszufüllen. Man musste über etwas sprechen, man wollte seine Beängstigung, sein Gefühl des Ungewissen, seine Angst vor Unbekanntem nicht zum Vorschein bringen, deshalb wurden Witze erzählt und es wurde zu allen möglichen Themen gesprochen. Jemand erinnerte sich an sein Mädchen und so weiter und so fort. Ganz normale, übliche Gespräche. Dazu muss man sagen, dass eine Gesellschaft aus 40 Männer (lauter Männer!) zusammen kam. Die Atmosphäre war ganz üblich. Man bemühte sich allerdings, möglichst eine ausgelassene Atmosphäre zu schaffen. Es gab keine…
G.G.: Wurde im Bus getratscht? Wurden vielleicht Gerüchte besprochen?
A.G.: Nein. Nein.
G.G.: So etwas gab es also nicht?
A.G.: Nein. Weil ganz wenig Zeit seit dem, was sich dort ereignete, verging, und wir wenig davon wussten. Ich meine, davon, was da los war. Es gab keinen Klatsch, keine Gerüchte… Es gab eher… Na ja, ehrlich gesagt, neige ich nicht dazu, unser Volk zu lobpreisen, weil wir ganz oft irgendwie unlogisch handeln. Andererseits ist mir im Gedächtnis geblieben, dass… wenn die Menschen vom Atomkraftwerk zurückzukehren, gab es einerseits keine Angst, andererseits keine Panibratstwo[5] und keine Schapkosakidatelstwo[6]. Wir fragten die, wie es dort sei. „Geht schon. Alles OK. Geht ihr dorthin, werdet ihr alles selber sehen“, war normalerweise die Antwort. So war es. Das Einzige, was daran störte, war, dass die Meisten, die von drüben kamen, tatsächlich am nächsten Tag oder in ein paar Tagen in Krankenhäusern landeten und nicht zurückkamen. Das war das, was störte. Wir wussten nämlich nicht, was mit denen los war. Normalerweise besuchte uns ein mobiles Laboratorium und uns wurden Blutproben entnommen. Klar, dass die Erythrozytenwerte rasant stiegen. Vorher, ich hatte keine blasse Ahnung gehabt, was das ist. Aber wiederum: Der Körper leistete bestimmten Sachen wesentlichen Widerstand. Die Jungs wurden ins Krankenhaus des Ministeriums für innere Angelegenheiten gebracht, weil die Feuerwehrkräfte damals diesem Ministerium angehörten. Die Jungs wurden also weggeholt, und wir hatten mit denen keine Verbindung. Deshalb waren wir nicht im Klaren, was mit ihnen los war: Ob es ihnen schlechter geht, ob sie zu Vorsorgezwecken ins Krankenhaus gebracht wurden. Das war also das größte Problem. Die Menschen, die von drüben kamen, kamen mit dem Gefühl, nicht ihre Pflicht getan zu haben, sondern ihre Arbeit ausgeführt zu haben, und hielten es für eine ganz normale Sache. Deshalb meinten auch wir, als wir von da drüben kamen, dass wir unsere Arbeit machen. Das war überhaupt kein Thema.
G.G.: War das Gefühl, die Pflicht getan zu haben und eine wichtige Arbeit für Ihre Heimat ausgeführt zu haben, das Kernelement? Oder war es die Rechtfertigung dieser Reise vor sich selbst? Worin konnte man den Sinn finden?
A.G.: Ich bin sozusagen von Natur, weiß ich nicht… Also, damals wurde mir ziemlich oft angeboten, Mitglied der leitenden, der einzigen, der unersetzbaren Partei[7] zu werden. Aber ich hatte einen tadellosen Algorithmus für mich selber erfunden. Ich sagte: „Ich werde erst dann Parteimitglied, wenn ich es verdient habe.“ Genauso war es hier. Wahrscheinlich habe ich mir selbst keine pathetischen Worte gesagt und mir nie zu hochtönenden Themen Gedanken gemacht. Ich meinte nicht, dass ich eine wichtige Pflicht für meine Heimat tue. Ich war mir einerseits der Sache bewusst, dass es sich um die radioaktive Strahlung handelt. Und dass diese Strahlung abnimmt, wenn ich, mein Nachbar, unsere Truppe und unser Bataillon je eine Kleinigkeit machen. Wenn wir etwas vergraben, etwas schließen, etwas löschen, etwas irgendwie örtlich begrenzen, kriegen die Menschen weniger davon. Ich würde sagen, es war ein Gefühl, eine wichtige Pflicht nicht für die Heimat, sondern für die Menschen getan zu haben. Für die konkreten Menschen, die hier geblieben waren. Wir sprachen von meiner Mutter, meiner Schwester, die damals 15 Jahre alt war. Also… Also jeder hatte hier jemand, um den er sich kümmerte. Deshalb machte jeder von uns je ein Stückchen Arbeit und verringerte somit für die Menschen, die hier blieben, die Wahrscheinlichkeit, verstrahlt oder krank zu werden.
G.G.: Klar. Wie war der offizielle Name Ihrer Einheit?
A.G.: Offiziell hieß sie das Erste Charkiwer Feuerwehrbataillon.
G.G.: Wie meinen Sie, warum waren Sie im Ersten Charkiwer Feuerwehrbataillon gelandet?
A.G.: Weil ich so ein Glückspilz bin. Im direkten wie übertragenen Sinne. Soviel ich später erfuhr, erhielt die Verwaltung für Brandschutz in der Nacht vom ersten auf den zweiten Mai die Unterlagen, nach denen ein Bataillon bei der Verwaltung für Brandschutz beim Exekutivkomitee der Oblast Charkiw gelbildet werden sollte. Das Offizierskorps des Bataillons wurde natürlich sehr schnell gebildet, später musste der Personalbestand genauso schnell gesammelt werden. Deshalb sage ich, dass ich „Glück“ hatte. Als ich einberufen wurde, fiel mir auf, dass der Mann, der die Einberufungsbescheide erteilte, einen schön großen Stoß Einberufungsbescheide in der Hand hielt und noch viele in seiner Tasche hatte. Also, alle, die auffielen, wurden sozusagen eingeladen. Alle durch die Bank.
G.G.: Also Ihre Kenntnisse, die Sie vorher erworben hatten, Ihre Kompetenzen, Ihr Fach…
A.G.: Die hatten mit der Sache gar nicht zu tun. Meinen Wehrdienst leistete ich beim Zentrum für ferne Weltraumkommunikation. In der Sowjetunion gab es damals nur zwei solcher Zentren. Ich bediente also dieses Zentrum. Später wurde ich Leiter der geheimen Stababteilung. Die sogenannte WUS, Ausbildungs- und Tätigkeitsbezeichnung, hatte mit der Feuerwehr gar nicht zu tun. Zum Zeitpunkt, da ich einberufen wurde, war ich bei der Werkzeugmaschinenfabrik als Ökonom tätig. Versorgungsabteilung, NE-Metallengruppe, - wie bezieht sich das alles auf die Sache… Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass die Kenntnisse, die wir während der ersten Tage drüben erwarben, leisteten uns später gute Dienste. Wie dem auch sein mag, mochten die jungen Menschen dabei gelacht haben, mögen sie die Sache ziemlich leichtsinnig wahrnehmen, lernten alle Feuerwehrschläuche und Feuerleitern benutzen. Innerhalb 4 oder 5 Tage erwarben wir den minimalen Umfang der Kompetenzen, die jeder Feuerwehrmann beherrschen muss.
G.G.: Wer brachten Ihnen das alles bei, wer waren diese Menschen?
A.G.: Es waren…
G.G.: Wie verlief die Ausbildung?
A.G.: Das Feuerwehrbataillon war, wenn ich mich nicht irre, 360… 356 Mann stark. 356 Mann stark war das Feuerwehrbataillon. Von denen waren ungefähr 70 Männer Offiziere. Diejenigen, die unser Bataillon bildeten, wurden ihr Gerippe, ihr Stab. Sie waren bei der Verwaltung für Brandschutz fest angestellt. Um dieses Gerippe herum wurden aus Reserveoffizieren die Zugkommandanten rekrutiert. Genauso wurde auch ein Sergeantenbestand gebildet. Ich frage mich natürlich, wie man es schaffte, die Menschen innerhalb so einer kurzen Zeitspanne auszubilden, kann Ihnen aber sagen, dass etwa 40 oder vielleicht 50 fest angestellte Feuerwehrleute aus Charkiw bald nach unserer Ankunft dorthin kamen. Es waren also die Menschen, die bei den Feuerwachen tätig waren, von einfachen Soldaten bis hin zu Majoren. Andererseits muss ich nach 27 Jahren gestehen, dass alle Ernstfälle von „Partisanen“, wie ich war, gelöst wurden, denjenigen die aus der Reserve einberufen wurden. Die fest angestellten Mitarbeiter wurden aus den mir unbekannten Gründen geschont. Zum Feuerlöschen gingen die Festangestellten zum ersten Mal ins Kraftwerk in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai, und dann am 29. oder am 30. Mai, um nicht zu lügen. In den übrigen Fällen gingen sogenannte Partisanen dorthin.
G.G.: So nennen Sie sich jetzt oder gab es damals eine solche Bezeichnung?
A.G.: Genauso wurden Menschen wie ich damals genannt. Die Sache ist die, dass man in der Sowjetunion zur Reservistenausbildung einberufen wurde, die Einberufenen wurden also Partisanen genannt.
G.G.: Klar. Sie waren also unter den Ersten, die nach drüben kamen?
A.G.: Genau.
G.G.: Nun erzählen Sie bitte, wie war Ihr erster Eindruck, als Sie da drüben waren? Fühlte es sich dort gut, schlecht, irgendwie anders an?
A.G.: Was die organisatorische Seite der Sache angeht, habe ich Ihnen schon beispielsweise erzählt, wie wir die Pritschen bastelten. Wir kamen am Abend des 9. Mai an. Es war schon dunkel geworden, und wir sahen also nicht, wo wir hingekommen waren. Wir spürten nur, dass es dort ziemlich feucht war. Es war eine flache Platte, und es war ziemlich feucht. Aber, wenn es dunkel wurde… Tja, da wurde uns befohlen, die Zelte aufzuschlagen. Wir stellten die einreihig, und in der ersten Nacht schliefen wir ohne Pritschen. Natürlich legten wir allerlei Sachen drunter, um nicht auf der bloßen Erde zu schlafen. Erst am nächsten Tag wurden die Pritschen gebastelt. So. Aber als wir am nächsten Morgen aufwachten und prüften, wie einreihig die Zelte stehen, die wir bei voller Dunkelheit aufgestellt hatten, mussten wir die natürlich aufs Neue aufstellen. Es waren in der Wirklichkeit zwei Reihen. Es standen je 6 Zelte einander gegenüber. An der Stirnseite stand der sogenannte Leninsche Raum[8], wo ein Fernseher später hingestellt wurde. Die Fußballweltmeisterschaft erlebten wir also von dort mit. Also, am Morgen wachten wir auf und entdeckten, dass wir auf einer Wiese sind.
G.G.: Aha.
A.G.: Auf einer schönen, flachen Wiese. Neben uns wurde noch ein Bataillon unterbracht – eins aus Winnytzja. Es war eigentlich 180 Mann stark, es gab darin also weniger Feuerwehrleute als bei uns. Noch einige Tage später wurde neben uns noch ein Bataillon aus Chmelnyzkyj unterbracht. Es stellte sich heraus, dass wir in der Nähe des Dorfes Iwankowo wohnen, also nicht weit von der Grenze zur Sperrzone. Man hielt diese Fläche für fast nicht radioaktiv belastet. Von der Wiese aus öffnete sich ein Blick auf den Vorort des Dorfes, ihm gegenüber waren auf der einen Seite der Fluss Teterew und auf der anderen Seite Fischzuchtteiche zu sehen. Es eröffneten sich uns also märchenhafte Landschaften. Am nächsten Morgen fingen wir wie schon gesagt an, unsere Zelte einzurichten und bastelten die Pritschen. In erster Linie mussten wir die WCs anlegen und Waschräume für gute dreihundert Menschen bauen. So. Irgendwo musste auch die Küche gebaut und eingerichtet werden. Ein paar Tage waren wir damit beschäftigt. Die Technik stand irgendwie abseits. Ein wenig später wurden die Grenzen meiner „Domäne“ bestimmt. Ich war Hauptmechaniker des Bataillons und hatte rund 67 spezialtechnische Einheiten in meinem Befehlsbereich. So. Holzpflöcke und Aluminiumdraht, der auch beim Anlegen der Übertragungsleitung verwendet wurde, dienten als Mauern. Dann wurde eine selbstgefertigte Sperre hergebracht und ein Häuschen gebaut. Und danach wurden auch die Fahrzeuge unterbracht. Die ganze Gestaltung nahm einige Tage in Anspruch.
G.G.: Während dieser Zeit wurden Sie also nicht eingesetzt?
A.G.: Nein, natürlich nicht.
G.G.: Mussten nur Sie sich einrichten?
A.G.: Tja, wir waren es, die uns einrichten mussten, aber ich muss Ihnen sagen, dass ich wegen dortiger Strahlungswerte irgendwie überrascht war. Auch wenn wir außerhalb der Sperrzone waren, wurden wir in der Zeitspanne vom 10. bis zum 15. Mai mit je 1 Röntgen täglich bestrahlt. Es wurde damals behauptet, der Mensch könne jährlich mit höchstens 2 Röntgen bestrahlt werden. Handele es sich um einen Militärangehörigen, dann könne er höchstens 25 Röntgen akkumulieren und gelte dann als untauglich. Aber Sie verstehen wohl, wie die Militärangehörigen zu sowjetischen Zeiten behandelt wurden. Für die Regierung des Landes waren sie nichts mehr als Kanonenfutter. Also, wenn jeder von uns in sich innerhalb eines Tages 1 Röntgen akkumulierte, ohne in die Zone zu gehen, dann waren es am nächsten Tag schon über 2 Röntgen. Als wir im Kraftwerk eingesetzt wurden, wurden wir mit ganz anderen Strahlungswerten bestrahlt.
G.G.: Wie waren die?
A.G.: Wie die Strahlungswerte waren? Das beschrieb ich in meinen Erinnerungen. Vielleicht, war das mir im Gedächtnis geblieben ist. Eines Nachts wurden wir alarmiert. Wenn man alarmiert wurde, hieß es sicher, dass etwas im Kraftwerk brennt. Es wurden uns aber keine genauen Informationen erteilt. „Bataillon, aufstehen, Alarm. In die Wagen schnell einsteigen und los geht es!“ Es wurden aber abends 8 bis 10 Personen gewählt, die am nächsten Tag ins Kraftwerk mussten. Die 8 bis 10 Personen mussten also am Morgen in die Wagen einsteigen und hinfahren. Am nächsten Tag waren es schon andere 8 bis 10 Personen. Aber in der Nacht wurde das ganze Bataillon alarmiert. Und da kam die ganze Organisation zur Geltung. Genauer gesagt das ganze Fehlen der Organisation.
G.G.: Aha (G.G. lacht).
A.G.: Das Wort „Organisation“ nehmen wir in die Gänsefüßchen. Wir liefen auf die sogenannte Sperre zu. Dort standen die Offiziere und bildeten die Teams. Es gehörten je 6 Personen jeder Besatzung an. Das heißt, es stiegen je 6 Personen in jedes Fahrzeug ein. Als ich dran war, entdeckte ich, dass die 5 Männer aus meiner Besatzung in den Wagen schon eingestiegen waren und da saßen. Nur ein Platz war nicht besetzt: der am Steuer. Ich begriff, dass ich eben diesen Platz nehmen muss. Eigentlich war ich damals kein Autofahrer, ausgeschlossen bei den Fällen, da ich manchmal nach Iwankowo ging, wobei ich die Ordnung frech übertrat. Was ich eigentlich tat? Die Wagen standen vollgetankt und einsatzbereit, so ergriff ich ab und zu die Möglichkeit, ins nahe liegende Dorf zu fahren, um dort einzukaufen. So. Ich nahm heimlich einen dieser Wagen und fuhr. Und damals… Damals fragte ich: „Hat jemand je am Steuer gesessen?“ „Nein“, war die Antwort. So musste ich mich ans Steuer setzen und wir fuhren innerhalb der Kolonne. Ich weiß nicht, wie… vielleicht wendete Herr Gott ein Unglück von mir ab… Aber bei einer der Kurven… Die Kolonne bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 oder 80 Stundenkilometer. Mir kam es allerdings vor, dass wir mit solcher Geschwindigkeit rasten. Wir schafften es, eine der Steilkurven zu erwischen. Plötzlich neigte sich unser Wagen und tat so ein Ding auf nur zwei Rädern. Ich weiß nicht, wie ich ihn aufrechterhielt und ausglich. Später erfuhren wir, dass der Wagen, in den wir „landeten“, einen halben Behälter Wasser hatte.
G.G.: Ach so.
A.G.: Das war das Schrecklichste, was einem Fahrzeug mit einem Behälter passieren kann. In Kurven fängt es an zu schleudern und kann sich schließlich überschlagen. So kann es sein. Diese kleine Episode zeigt, was für hervorragende Fachleute wir waren. Aus Iwankowo nach Tschernobyl fuhren wir etwa 40 Minuten, um nicht zu lügen. Aber sehen Sie, für junge Menschen ist es sehr lang. Während der ersten 5 Minuten, als man sich umsah, waren alle irgendwie beschäftigt. Aber plötzlich stellte es sich heraus, dass sie gekommen sind, aber nichts zu tun haben. Jemand schaltete in einem der Wagen die Alarmsirene an. „Was wäre, wenn wir die Sirene auch einschalten?“ fiel uns ein. (A.G. und G.G. lachen) Die Kollegen waren schon tapfer. So. Aber niemand wusste, wie man die Sache einschaltet. Die Kollegen versuchten, unmittelbar während der Fahrt alle Hebel zu drücken. Halt großartige Fachleute… Also, mit einem der Hebel funktionierte es und die Sirene fing an, zu heulen. So fuhren wir von selber stolz mit der Sirene weiter, fuhren über den Checkpoint und erreichten dort drüben. Innerhalb der 30-Kilometer-Zone hielt uns niemand an: Es rasten dorthin viele Feuerwehrwagen mit Sirenen und Blitzlichtern. Als wir Tschernobyl erreichten, sagte ich: „Nun können wir die Sirene abstellen.“ Wie? Genauso wie wir die eingeschaltet haben! Man zog den Hebel rückwärts, doch die Sirene heulte weiter. Man zog den Hebel kräftiger – doch es war wiederum vergebens. Es kamen die Kollegen aus den hinteren Reihen zu Hilfe und versuchten, das Problem irgendwie zu lösen. (A.G. lacht) Am Ende mussten wir den Hebel einfach abbrechen.
G.G.: (G.G. lacht) Und was machte die Sirene?
A.G.: Die heulte ununterbrochen. Mit diesem wilden Heulen fuhren wir durch das ganze Tschernobyl und erreichten die Feuerwache, die am Stadtrand stationiert war. Man zeigte uns, wo wir den Wagen zum Halten bringen müssen. Wir hielten. Ich nahm den Fuß vom Fußhebel, und entdeckte, dass das die Sirene abstellte. Hätte ich also während der Fahrt meinen Fuß vom Gaspedal genommen, so hätte das die Sirene abgeschaltet. Aber da wir zu schnell fuhren… Na ja, solch herausragenden Fachleute waren wir.
G.G.: Kriegten Sie was auf die Mütze?
A.G.: Nein, so komisch es auch kommen kann… In der Hektik, die dabei herrschte, merkte niemand, dass etwas nicht in Ordnung war. Niemand machte sich andererseits Gedanken, dass man während des Vorfalls eins auf die Mütze kriegen kann. In Tschernobyl waren wir etwa 20 Minuten. Uns wurde dort eine bestimmte Aufgabe gegeben und es wurde schon klar, wo und wofür wir hingehen. Die Kabelschächte waren in Feuer geraten. In meinen Lebenserinnerungen habe ich erwähnt, dass die Kabelschächte zwischen den Reaktorblöcken 3 und 4 in Feuer gerieten.
[…] Es war nicht der Rauch, der uns bei diesem Glimmbrand störte, sondern ein bissiger chemischer Geruch, den die Dichtung verbreitete. Hier wurden wir also eingesetzt. In meinen Lebenserinnerungen habe ich eine Episode mit der Laterne beschrieben. Eine Episode, die sich in mein Gedächtnis einprägte. Niemand verriet uns, wo das Ende der Linie ist. Wir mussten die Feuerlöschhauptleitungen selbstständig finden, die zur Brandquelle führen sollten. Aber es ging schon nicht mehr ums Feuer, sondern auch ums Glimmen. Und es war zwischen den Reaktorblöcken 3 und 4. Als wir dorthin kamen, sahen wir dort eine Laterne. Die Lampen waren schon nicht mehr an. Wir suchten mit unseren Füßen nach den Rändern und entdeckten an der Stelle die Laterne. Wir wickelten sie ab und holten sie weiter. Was mir damals, als ich dort mit meinem Kollegen war, in der allgemeinen Hektik auffiel und im Gedächtnis blieb, war, dass die Sichtverhältnisse wegen der großen Rauchentwicklung und einem dicken Dampf (der Feuchtigkeitsgrad war dort nämlich ziemlich hoch) nicht besonders gut waren. So dachte ich, dass ich vorne Lichter sehe. Dann begriff ich, dass diese Lichter erstens ziemlich trübe und zweitens ungeordnet sind. Als ich sie mir dann aufmerksamer ansah, kapierte ich, dass das Sterne am Himmel waren, und es etwa 50 bis 60 Meter bis zum Reaktorblock waren. Davon liefen wir natürlich so schnell wir nur konnten, denn wir verstanden, was für eine Gefährlichkeit die Sache in sich barg. Aber Sie haben mich ursprünglich gefragt… Sehen Sie, wie mir die Gedanken springen? Nie halte ich mich ans eigentliche Thema der Frage. Sie haben also die Strahlungsdosen erfragt, mit denen man dort belastet wurde. Als wir ins Gelände des Kraftwerks kamen, mussten wir bei der sogenannten Verwaltungs- und Sozialanlage aussteigen… Moment mal, der Verwaltungs- und Sozial…
G.G.: Wahrscheinlich, war es die Verwaltungs- und Sozialanlage.
A.G.: Tja, wahrscheinlich haben Sie Recht. […] Was mir auffiel, als wir die Verwaltungs- und Sozialanlage erreichten? Vor der Pforte stand eine riesige Mulde… tja, eine schön riesige… Ungefähr so breit und etwa 2 Meter lang und – Sie erinnern sich wohl an die Kleidungsbürsten, die es zu sowjetischen Zeiten bei uns gab?
G.G.: Aber sicher.
A.G.: Es waren ganz übliche Bürsten. Sie lagen in der Mulde. Dazu noch war die Mulde mit Jod gefüllt.
G.G.: So…
A.G.: Wenn wir ins Kraftwerk gingen, mussten wir unbedingt an dieser Mulde vorbeigehen. So wischten wir einerseits den Staub ab, den wir schon gesammelt hatten, und bekamen andererseits Jod, um das nicht zu speisen, das noch aktiv war. Wahrscheinlich kam noch eine Reihe anderer Faktoren zur Geltung. Aber wir mussten allerdings an dieser Mulde vorbeigehen. Viele meiner Kollegen sagten: „Schaut man hinauf, sieht man unumstritten die Havarie und die ganze Situation, dabei funktioniert aber die Ausleuchtung und sind alle Lichter an. Das heißt, das Atomkraftwerk von Tschernobyl funktioniert für den Kommunismus!“ Wir betraten also die Verwaltungs- und Sozialanlage. Heute sind wir schon daran gewöhnt, dass sogar Inkassobeauftragte mit Waffen herumlaufen. Aber in der Sowjetunion waren nicht einmal bewaffnete Militärangehörige oft zu sehen (ausgeschlossen auf militärischem Übungsgelände). Als wir die Verwaltungs- und Sozialanlage betraten, sah ich einen Soldaten mit einem Sturmgewehr sitzen. Von seinen Augen ließ sich die Angst ablesen, sein Blick war total entrückt. Allem Anschein nach verstand er gar nicht, wen er anhalten und wen er durch lassen sollte. Die Menschen trieben sich herum, und ich fragte mich, was dieser junge Soldat dort tat.
G.G.: Aha.
A.G.: „Richten Sie sich hier ein“. Uns wurde ein Raum zur Verfügung gestellt. Wir richteten uns ein. Es kam die Nacht. Man versuchte sich der Situation irgendwie anzupassen. Jemand ließ sich zum Beispiel auf das Fensterbrett nieder. Da stürzte ein Offizier in den Raum und schrie (seine Sprache mit groben russischen Schimpfwörtern würzend): „Weg von den Fensterbrettern und zwar schnell!“ „Was wäre damit nicht in Ordnung?“ „Dass hier der Wand gegenüber die Strahlenbelastung 2 Röntgen pro Stunde beträgt. Ihr müsst doch verstehen, wo ihr seid! Auf dem Fensterbrett bekommt man gute 6 Röntgen pro Stunde. Und dahinter wird’s noch spannender! Deshalb springt schnell von den Fensterbrettern weg und lauft in diesen Raum.“ Noch ein Moment fällt mir ein. Im Jahr 1937[9] würde jemand wegen der Sabotage vor Gericht gehen. Andererseits glaube ich, dass das nicht böse gemeint war, sondern nicht gut genug durchdacht war. Es gab damals Fahrzeuge mit Kabinen. […] Eine ganze Kabine war voll von Feuerwehrschläuchen. Sie lagen dicht aneinander gepresst. Mein Kollege und ich fingen an, diese Feuerwehrschläuche herauszuziehen, sahen aber, dass sie alle schon verbrannt waren.
G.G.: Aha.
A.G.: Sie taugten also ganz und gar nicht. Wir zogen sie hintereinander, die waren aber alle unbrauchbar. Allem Ansehen nach wurde der Wagen nach dem Prinzip „Wir verschenken das, was wir selber nicht brauchen“ beladen. Für sich behielt man normale Feuerwehrschläuche, nach drüben wurden verbrannte Feuerwehrschläuche geschickt. Einen halben Wagen solcher Schläuche musste in die Mülltonne gehen. „Lassen wir es“, sagte ich. Da liefen wir zu den anderen Wagen, und erst im dritten oder vierten Wagen entdeckten wir normale Feuerwehrschläuche. Aber das waren Fahrzeuge mit Behältern und in den Hinterteilen lagen einige Feuerwehrschläuche verborgen. Wir griffen die und liefen… Wohin? Da holte uns ein Kapitän in den ersten Stock, dann gingen wir nach unten, dann wieder nach oben… Ich kam langsam durcheinander und konnte nicht mehr kapieren, wo wir waren. Umso mehr, dass es Nacht war und die Flure halbdunkel waren. Bald kamen wir in einen hellen Raum, bald mussten wir wieder einen dunklen Flur entlang laufen oder eine Treppe hinauf- oder hinabsteigen. Dann wurde mir eine Aufgabe erteilt. Hinter einer der Türen gab es zwei Magistralen, die wir ziehen mussten. Was die Strahlung anging, war ein Messtechniker auch dabei, der sagte, vor Ort betrügen die Strahlungswerte 2 Röntgen, hinter der eisernen Tür aber waren es schon 60 Röntgen. Die Strahlungswerte seien also ganz unterschiedlich und wir sollten die Treppe…
G.G.: Aha.
A.G.: …möglichst schnell hochlaufen, weil es dort Stellen gäbe, wo die Radioaktivitätswerte 200 bis 40 Röntgen betrügen, im Brandherd betrüge die Strahlungsbelastung 600 bis 800 Röntgen. So war es. Ich erinnere mich ganz gut an den Kapitän, der uns Anweisungen erteilte. Vielleicht war er damals ein bisschen jünger als ich heute, doch jedenfalls war er alt genug, um unser Vater zu sein. Ein weiser Mann mit ganz grauen Haaren. Woher er kam und wer und was er war, weiß ich natürlich nicht. „Jungs, ich verstehe, dass man dort höchstens anderthalb Minuten bleiben kann. Ihr werdet aber die Sache in wenigstens fünf Minuten erledigen. Ihre Aufgabe besteht also darin, alles schnell zu machen und im Laufschritt zurückzukehren. Je schneller ihr rauskommt, desto schneller ist alles vorbei“, sagte er. Also wie schon gesagt, liefen wir und ich weiß nicht, wie ich die Treppe hochlief. Dabei sollte man die Tatsache in Erwägung ziehen, dass wir die Schutzanzüge anhatten. Während wir zum Wagen und zurückliefen, füllte sich mein Schutzanzug mit Wasser, und es wurde unmöglich, darin zu laufen, die Treppe hochzugehen; ich konnte nicht einmal die Beine anwinkeln, weil alles klebte. Das war doch Gummi. Als wir die Schläuche anschlossen und sie nach vorne zogen, kapierten wir, wo wir waren. Als wir zurücklaufen mussten, bekamen wir den Eindruck, dass der Weg zurück zehnmal länger war als der Weg dorthin. Es kam mir vor, als ob dieser Weg kein Ende hat und dass mein Atem mir nicht mehr ausreicht. Es ist mir entfallen, ob ich die Episode beschrieben habe, die ich eben erzähle. Mein Kollege Boris Morgun war festangestellter Feuerwehrmann. Während der Explosion barsten? sich einige Platten, zwei Platten, um genau zu sein. Und da diese Platten zerstört? auf unserem Weg lagen, mussten wir über die springen. Sie lagen meinetwegen nur 60 cm voneinander entfernt. Erstens wurde uns gleich gesagt, dass es dort eine 4 Meter tiefe Kluft gäbe…
G.G.: Aha.
A.G.: …und einer schon gefallen sei. Es war offen gesagt ganz schön unbehaglich, in der Schutzbekleidung und mit Schläuchen zu springen, denn man konnte sich der Sache nicht sicher sein, ob man es schafft oder nicht. Dazu stellte es sich heraus, dass es leichter war, die Grube auf dem Hinweg zu überspringen, denn auf dem Zurückweg lag eine Platte höher als die andere. Also in der Nacht holte der Boris Morgun noch einen Kollegen (der übrigens auch Partisan wie ich war) heraus. Der Familienname dieses Kollegen ist Gretschka und er ist schon längst verschieden, Gott hab ihn selig! Als er hinlief, fiel durch und geriet in die Kluft zwischen den beiden Platten. Boris und noch ein Mann halfen ihm heraus und bekamen sehr hohe Strahlungsdosen. Boris wurde dafür mit dem Orden des Roten Sterns ausgezeichnet. Für die Nacht, da wir im Einsatz waren. Auch mir wurde für den Einsatz jener Nacht die Auszeichnung verliehen. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis ich endlich im November 1986 die Medaille „Für die Auszeichnung während des Wehrdienstes“ Grad 1 erhielt. Diese Medaille galt in der Sowjetunion als die höchste Auszeichnung für Militärangehörige in der Friedenszeit. Die erhielt ich also. Unmittelbar für den Einsatz in jener Nacht.
G.G.: Sagen Sie nun bitte, man sollte also hinlaufen – und was dann? Was sollte man weiter tun?
A.G.: Erst mal hinlaufen…
G.G.: Und dann weglaufen?
A.G.: Aha, ich bitte um Entschuldigung, ich dachte, dass Sie im Bilde sind.
G.G.: (G.G. lacht) Nein, bin ich nicht.
A.G.: Sie wissen also nicht. Wir liefen hin, jeder von uns lief hin, und nahm je zwei Feuerwehrschläuche mit. Unsere Aufgabe bestand darin, die Ränder der Magistralen zu finden. Die führten zur Rauchbildungsstelle. So. Unser Bataillon musste die Schläuche zu den Rauchbildungsstellen ziehen. Bevor wir also die Feuerquelle fanden, mussten wir den Rand der Magistrale finden, die Feuerwehrschläuche abrollen und prüfen, ob es sogenannte Verflechtungen gibt. Ist ein Feuerwehrschlauch verflochten, so kann er höchstwahrscheinlich explodieren, wenn der Wasserhahn aufgedreht wird. Deshalb muss er gerade liegen. Als wir den Feuerwehrschlauch anschlossen, das Fehlen von Verflechtungen feststellten und die Laternen holten, wurde uns gesagt, wir sollten den Feuerlöschhydrant aufdrehen, wenn wir die Brandquelle erreichen.
G.G.: Ach so.
A.G.: Vorher gab es dort einen Feuerlöschhydrant. Unsere Aufgabe war es, den aufzudrehen. Aber was das Wasser angeht… Als wir hinliefen, den Schlauch anschlossen, alles prüften und die Laterne holten, blieben wir stehen. Ich hörte nur mein Herz klopfen, mehr nicht. Wegen des bissigen Rauchs, der von der Dichtung ausging, musste man den Atem anhalten. Es war wahnsinnig feucht, wegen des beißenden Rauchschleiers war kaum etwas zu sehen. Von den Geräuschen, die ich dort vernahm, war das Geräusch des nicht fallenden, sondern raschelnden Wassers. Das Wasser floss von der Wand runter… Dann zogen wir die Schläuche. Das Wasser floss schon. So. Aber wir erreichten den Ort noch nicht. Unsere Kollegen waren schon dort; sie senkten die Schläuche und drehten den Hydrant auf. Wir mussten den Ort erreichen, die Schläuche anschließen, wenn die Brandquelle dort war – den Hydrant aufdrehen, wenn nicht – das ganze Zeug weiter holen und die Stelle markieren, wo wir Schluss machten, und zurückkehren. So war es diesmal.
G.G.: Wollen Sie etwa sagen, dass jene Erfahrung mit dem Kraftwerk nicht die einzige war?
A.G.: Es war das erste Mal, da ich im Kraftwerk arbeiten musste. Davon erzähle ich eben. Die grausamsten Erinnerungen meines Lebens sind aber nicht mit der Zeit, die wir im Kraftwerk verbrachten, sondern mit den ersten Augenblicken nach unserer Rückkehr verbunden. Und nun versuche ich zu erklären, worauf das zurückzuführen ist. Wir liefen zur Tür und klopften daran. Jene 15 Sekunden, die wir abwarten mussten, bis jemand an die Tür kommt und die aufmacht, schienen mir, eine Ewigkeit zu dauern, denn ich dachte die ganze Zeit daran, dass wir abseits sind, dort, wo die Strahlungsbelastung 60 [Röntgen pro Stunde] beträgt, während sie hinter der Tür 2 [Röntgen pro Stunde] ausmacht. Als man uns die Tür öffnete, stürzten wir tatsächlich heraus. Da standen schon unsere Kollegen, die nach uns dorthin gehen sollten. Als wir Luft holten, fragte ich den Kapitän: „Wie viel?“ Ich wollte fragen, mit wie viel Röntgen wir belastet wurden. Der dachte aber, dass ich nach der Zeit frage, die wir dort verbrachten, und antwortete: „Etwa 15 Minuten.“ Ein wenig später fiel mir ein, dass er so über unsere Strahlungsbelastung keine Ahnung hat. Eines steht fest: Wir waren dort 15 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, während man dort höchstens zehnmal weniger Zeit verbringen durfte.
G.G.: Ach so.
A.G.: Höchstens anderthalb Minuten. Als wir rauskamen, holten wir Luft und schnappten ungefähr drei Minuten nach Luft. Dann wurden wir weggetrieben. Wir sollten in der Begleitung eines Oberleutnanten irgendwohin duschen gehen, uns umziehen und so weiter und so fort. Und gleich verließen uns die Kräfte. Ich konnte gar nicht kapieren. Am peinlichsten war, dass ich den an mir kleben gebliebenen Schutzanzug nicht ausziehen konnte, und hatte das Gefühl, dass ich in diesem Schutzanzug sterben werde. Denn ich war nicht in der Lage, ihn abzunehmen. Erstens bin ich 1,90 m groß. Zweitens war das der Schutzanzug in maximaler Größe, den ich gefunden hatte, als wir eingesetzt wurden, die aber für 1,80 Meter – 1,82 Meter vorgesehen war. Es kostete mich schon viel Mühe, sogar den trockenen Schutzanzug anzuziehen. Aber da blieb er an mir kleben, ich aber war so erschöpft, dass ich das Gefühl hatte, dass ich gleich sterben werde. Die Angst, dass ich diesen Schutzanzug nie wieder ausziehen werde, blieb für den Rest des Lebens in meinem Gedächtnis. Und nicht einmal heute weiß ich, wie ich ihn abnahm. Es kam mir vor, ich tue es stundenlang, aber in Wirklichkeit konnte nur eine Minute vergangen sein oder vielleicht ein wenig mehr …
G.G.: Aha.
A.G.: …bis ich ihn abnahm. So. Dann gingen wir duschen. Wir wuschen uns dabei nicht, sondern wir standen bloß einige Minuten unter dem Wasserstrom und erholten uns von dem, was wir eben erlebt hatten. Nach der Dusche zogen wir uns um. Die Kraftwerk-Uniform blieb damals noch erhalten. Wir wurden also „Schneewittchen“, denn die Uniform des Kraftwerks war völlig weiß: weiße Überziehschuhe, weiße Hose, weiße Jacke. Als wir uns umzogen, wurde uns gesagt: „Wartet mal, nun werdet ihr zurück in euer Truppenlager geschickt.“ Wir wurden irgendwohin gebracht. Unterwegs spürte ich aber, dass meine Kräfte nicht einmal für die übrig gebliebenen 15 oder 20 Meter ausreichen, und fiel. Ich schlief im Gehen tatsächlich ein. Ich verstand immer Bahnhof. Ich hatte den Eindruck, dass ich so erschöpft war, weil man uns mitten in der Nacht alarmierte. Und ich sah meine Kollegen, genauso wie ich im Gehen schlafen. Das war das Letzte, was mir damals im Gedächtnis blieb.
G.G.: Klar.
A.G.: Nach der Dusche bemerkte ich, dass diejenigen Kollegen, die ein bisschen früher eingesetzt worden waren, in beliebigen Körperpositionen schliefen: jemand war im Sitzen eingeschlafen, jemand lag… Man war kurz gesagt dort eingeschlafen, wo man einen freien Platz gefunden hatte. Ich weiß nicht, wie lange wir schliefen. Es hätten eine Minute, 10 Minuten oder eine Stunde sein können. Da kam wiederum ein Offizier und wies uns (aber auf etwas höflichere Weise) hinaus. „Weg von hier, hier ist der Strahlungshintergrund sehr hoch!“ Und wir gingen zurück. So witzig es auch einem vorkommt, gingen wir mit dem Feuerwehrwagen, worin die verbrannten Schläuche lagen. Er stand außerhalb des Kraftwerks geparkt und war deshalb nicht so sehr radioaktiv belastet. Man ließ einige Fahrzeuge dort geparkt stehen, denn man musste doch zurückgehen. Etwa 60 Schläuche lagen drinnen, darauf saßen wir (etwa 15-20 Personen). Es war drinnen so drückend heiß, dass wir sogar das Schiebedach öffnen mussten. Eigentlich wussten wir nicht, wo wir hinfahren, denn ins Truppenlager wurden wir nicht gebracht. Wir fuhren über hinaus Tschernobyl und hielten 3 oder 4 Kilometer von Tschernobyl entfernt in Salissja[10] an. Wir wurden in der Sporthalle einer Schule unterbracht. Erschöpft schliefen wir sofort ein. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Schlaf erwachte. Es war eigentlich Oleg Malyschew (den ich schon früher erwähnt habe), der mich weckte. Er war nach drüben etwa eine halbe Stunde oder eine Stunde früher als ich gekommen. „Hilf mir“, bat er mich. Ich ging mit ihm nach draußen. Es war ihm kotzübel. Ich sagte: „Mehr kann ich nicht mehr aushalten, mein Kopf tut mir furchtbar weh.“ Erst später begriffen wir, dass dieser Zusammenbruch zu den allerersten Merkmalen der Einwirkung großer Strahlungsdosen gehört.
G.G.: Ach so.
A.G.: Das kapierten wir aber später. Damals dachte ich, dass wir so erschöpft waren, weil wir uns im Kraftwerk bloß kaputt gearbeitet hatten. Aber in Wirklichkeit schliefen wir wegen der hohen Strahlungsdosen im Gehen ein. Kopfschmerzen und tiefer Schlaf sind Merkmale der Überbestrahlung des menschlichen Körpers, der vielfachen Überschreitung aller möglichen Normen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. So. Er sagte mir also: „Hilf mir“. Wir gingen nach draußen. Er erbrach sich so stark, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Ich umarmte ihn von hinten und hielt ihn. Er wurde grün vor Übelkeit, stützte sich an Bäume und Pfähle, kotzte ununterbrochen, obwohl er nichts mehr zum Auskotzen hatte. Armer Kerl. Entschuldigen Sie mir diese Einzelheiten, doch die gehören doch auch zur Lebenswirklichkeit. Ich hatte ein Gefühl, ihn eine Ewigkeit lang herumzuschleppen. In Wirklichkeit vergingen etwa anderthalb bis zwei Stunden. Es kamen einige Notarztwagen. Später stellte sich heraus, dass wir nicht in unser Truppenlager, sondern in diese Schule zuerst gebracht wurden, weil die Leitung es nicht wollte, dass andere sehen, wie uns geht.
G.G.: Ach so.
A.G.: Manche verstanden schon damals, worin es resultieren wird, dass wir da drüben waren. Deshalb musste man uns für eine bestimmte Zeit isolieren und über uns an einem bestimmten Ort eine Quarantäne verhängen. So wurden wir in der Schule unterbracht. Der Oleg wurde mit einem Notarztwagen nach Kyjiw gebracht, wo er im Krankenhaus des Ministeriums für innere Angelegenheiten landete. Ich blieb dort und schlief, glaube ich, noch einen Tag lang (zu diesem Schluss bin ich nach den Gesprächen mit meinen Kollegen gekommen). Man schlief dort tagelang ohne aufzustehen, ohne zu essen. Es sah so aus, als habe der Körper das Bedürfnis gehabt, abzuschalten und sich wieder einzukriegen, und der Schlaf das beste Mittel dafür gewesen sei. Erst nach einem Tag oder sogar anderthalb Tagen fing ich an, Stimmen zu hören. Vorher existierte für mich die Welt nicht. Ich musste bloß abschalten. Und ich wurde mir dann der Sache bewusst, dass ein normaler und gesunder Mensch im Nu sein Leben verlieren kann.
G.G.: Sagen Sie bitte, war das das einzige Mal, da Sie eben solche Aufgabe erfüllen sollten?
A.G.: Nein.
G.G.: Also, wie viele Male sollten Sie nach drüben noch fahren?
A.G.: Ich musste noch einige Male ins Kraftwerk. Um genau zu sein… Nachdem wir noch anderthalb oder zwei Tage hier in Salissja verbracht hatten, blieb nur etwa eine Hälfte unserer Gruppe übrig. Viele gingen nach Kyjiw ins Krankenhaus. Wir wurden nach Iwankowo in unser Truppenlager gebracht. Diejenigen, die ins Krankenhaus nicht gingen, wurden als noch einsatztauglich betrachtet. Aber diejenigen, die es nicht durchstanden…
G.G.: Die sind schon…
A.G.: …die sind schon weg. Also, als wir ins Truppenlager zurückkehrten, fand ich heraus, dass etwa 70 Personen aus unserem Bataillon fehlen. „Wo sind die?“ – „Im Krankenhaus, wo denn sonst.“ Wie sich zeigte, landeten sie alle in verschiedenen Krankenhäusern und Militärspitalen. In einigen Tagen wiederholte sich die Situation. Der einzige Unterschied bestand darin, dass wir schon gegen 6 alarmiert wurden. „Bataillon, Alarm! In Feuerwehrwagen bitte einsteigen!“ Und wir gingen wieder nach drüben. In Tschernobyl wurde uns wiederum eine Aufgabe gestellt… Wieso wir gerufen wurden? Es kamen diejenige, die vor etwa 4-6 Tagen im Einsatz gewesen waren. So.
G.G.: Aha, klar.
A.G.: Es wurden wieder die 20-25 von uns gesammelt. 23, um genau zu sein. So. „Ihr wisst schon alles, ihr wart schon hier“, wurde uns gesagt. „Eure Aufgabe ist dieselbe. Wo die Feuerwehrschläuche und die Löschbrunnen sind, wisst ihr auch.“ Die Sache war, dass in den vorangehenden Tagen zu viel Wasser vergossen worden war. Die Regierungskommission meinte, das Wasser fließe schon unter den Reaktor. Da im Reaktor ein nicht steuerbarer Vorgang laufe, könne es bei der Wassermenge zu einer Kernexplosion… einer Wasserstoffexplosion kommen. Da die Bergarbeiter noch nicht angefangen hatten, Tunnel nach unten zu graben, mussten wir das Wasser aus allen Höhlen abzapfen. Dazu wussten wir, wo die Kabelbrunnen sind. Wir wussten, wo in diesen Kabelbrunnen Höhlen sind, wo das Wasser auch sein konnte. Ich war für die Motorpompe verantwortlich und leitete eine Gruppe, die aus 4 Personen bestand. Das bedeutete, dass 4 Schläuche an die Motorpumpe angeschlossen waren und es Schlauchnippel gab. Der Durchmesser jedes Schlauchnippels bildete ungefähr 40 cm. Ein bestimmter circa einen Meter großer Filter. Es wird der Schlauchnippel angesetzt und in den Behälter gesenkt. Man ruft dann: „Der Erste, der Zweite, der Dritter, der Vierte, die Ordnungsnummern bitte merken!“ Wir gingen also hin, aber diesmal war ich schon erfahren und wusste, was man tun sollte. Ich suchte nach Schutz, denn es gab keinen und den Schutzanzug hätte ich um keinen Preis anziehen wollen. Ich hätte meine persönliche Kleidung lieber nach dem Einsatz in den Mülleimer geworfen, weil das alles für die Katze war …
G.G.: Gewährte der Schutzanzug keinen Schutz?
A.G.: Die Angst, im Schutzanzug auch die letzten Augenblicke meines Lebens verbringen zu müssen, prägte sich mir für den Rest des Lebens ins Gedächtnis (A.G. lacht).
G.G.: (G.G. lacht) Schützte der Schutzanzug Sie gar nicht?
A.G.: Er bot gar keinen Schutz. Er war gummiert, doch das Wasser würde er durchlassen. Vor der Strahlung hätte er gar nicht retten können. So. Wir gingen also hin. Die Motorpumpe war im Betrieb. Vorher hatte ich in einem der Räume Bleiplatten gefunden. Das Blei ist aber sehr weich und sehr schwer. Ich schaffte es, gleich vier Blatten zu greifen, kapierte aber, dass ich sie kaum halten kann. Sie waren 60 cm breit und ungefähr 80 cm hoch und 2 - 2,5 mm dick. Sie waren also so dünn, dass sie beinahe zerrissen wären.
G.G.: Aha.
A.G.: Aber sie waren sehr schwer. Trotzdem griff ich diese Platten. Die Jungs schleppten die Motorpumpe mit, ich – jene Platten. Wir kamen an die Stelle. Jeder zog je einen Schlauch. Die Jungs brauchten bloß zu rufen: „Der Erste, bitte einschalten“, „Der Erste bitte ausschalten“, „Der Zweite, der Vierte bitte ausschalten“. Damit sie voneinander ziehen, schlossen wir hier an und zapften das Wasser außerhalb des Geländes in die Kühlteiche ab, wohin das radioaktive Wasser abgeleitet wurde. Die haben aber auch einen geschlossenen Kreislauf, und das Wasser floss von dort nicht in Flüsse. Weder in den Prypjat, noch in den Teterew. Zumindest wurde das Wasser während unserer Arbeit ganz normal in diese Teiche abgeleitet. So zapften wir das radioaktive Wasser ab, mit dem wir vor ein paar Tagen das Feuer löschten. Aus den Bleiplatten, die ich mitgeschleppt hatte, machte ich mir den Schutz. Ich brach diese Ränder um, versuchte die hinten am Rücken zu halten, kann die aber nicht kleben. Die Sache rutschte mir ab, sobald ich mich umdrehte, und es war total unbequem. Das Einzige, was mir dann einfiel, war es, mich an die Motorpumpe tatsächlich zu kleben. Sie war heiß, weil sie im Betrieb war, aber was tun… Ich lehnte mich an, hielt von hinten so und hier hielt ich dank der Motorpumpe. So hielt ich mit einer Hand… mit zwei Händen… Wenn er rief, schaltete ich diesen oder jenen um… Also, solange ich da saß, war ich mit diesen Platten bedeckt. Das war der ganze Schutz. Das war also das zweite Mal, dass wir im Kraftwerk arbeiten mussten.
G.G.: Wie lange blieben Sie also dort?
A.G.: Wir arbeiteten dort ungefähr 20-25 Minuten. Für unseren ersten Einsatz wurden uns, wenn ich mich nicht irre, je 7,5 Röntgen zuerkannt, für den zweiten waren es schon 6 Röntgen, weil alles schon besser organisiert worden war? Aber von welchen 6 Röntgen kann hier die Rede sein?
G.G.: Ging es Ihnen auch das zweite Mal so schlecht wie damals nach dem ersten Einsatz?
A.G.: So schlecht ging uns nach dem zweiten Einsatz nicht. Vielleicht hatte der Körper beim ersten Einsatz die größte Belastung ertragen. Oder es gab andere Gründe… Weiß ich nicht genau. Es gab allerdings furchtbare Kopfschmerzen, aber ich weiß mindestens, dass nicht so viele Menschen nach dem zweiten Einsatz… Jenes Mal waren nicht so viele Leute eingesetzt. Etwa 23 Personen wussten schon davon… Also, waren, glaube ich, 50 Personen im Einsatz.
G.G.: Aha.
A.G.: Von den 50 Personen landeten etwa 10-12 Personen in Krankenhäusern. Also, aus bestimmten, mir unbekannten Gründen gerieten nicht so viele Menschen in Krankenhäuser.
G.G.: So.
[…] Und einmal erlebten wir etwas, was uns aufs Tiefste beeindruckte. Als wir über einen Ort fuhren, sahen wir eine große Staubwolke vor uns. Eigentlich verstanden wir, woher der Staub stammte. „Lasst uns abwarten“, sagte ich meinen Kollegen. „Hoffentlich wird man was tun, damit sich dieser Staub löst, und wir werden dann ruhig weiter fahren“. Als wir näher kamen, stellte sich heraus, dass wir in ein Dorf gerieten, wo man mit der Wehrtechnik breite Gruben aushob, in die ganze Straßen mit Häusern (es waren meist Blockhäuser) weggeschaufelt wurden. Bisher hatte ich ganz ruhig das Geräusch des zerbrechenden Glases oder das Kratzgeräusch des Metalls wahrgenommen. Nun aber sind diese Geräusche für mich mit der Erinnerung an riesige Bulldozer, die Häuser wegschaufelten, verbunden.
G.G.: Aha.
A.G.: Zum Beispiel siehst du in einem der Höfe eine Wäscheleine, auf der Wäsche hängt, und begreifst, dass das Haus und der Hof noch vor einigen Tagen bewohnt waren und das nun alles weggeschaufelt wird. Es wurde alles in Gruben geschaufelt, auch Kräne geworfen… Es wurde also alles ausradiert, obwohl wir vor einer Woche versuchten, diese Häuser zu waschen. Tja, solche Arbeit gab es auch. Was musste man noch machen? Jeder hatte im Lager ab und zu Bereitschaftsdienst. Und was spannende Aktivitäten angeht, so ist hier natürlich das Angeln zu erwähnen. Den größten Fisch in meinem Leben fing ich eben da drüben, denn es lagen Fischzuchtteiche in der Nähe. Was noch? Na ja, mehr fällt mir momentan nicht ein. Werde ich mich an noch etwas erinnern, werde ich Ihnen das erzählen. (A.G. lacht).
[…] G.G.: Ihre Freizeit. Ok, es wurde geangelt. Was noch? Wie war Ihre Freizeit?
A.G.: Es gibt hier eigentlich nicht so viel zu erzählen. Obwohl sich die Leitung darum bemühte. Aber man sollte sich Klarheit verschaffen, zu welcher Zeit wir da drüben waren. Es war die Zeit einer totalen Desorganisation. Wir kamen also am 9. Mai nach drüben. Im Zeitraum vom neunten bis zum neunzehnten Mai wurden etwa 10 Personen in Krankenhäuser oder nach Hause geschickt, weil das Bataillon zwar gebildet und abkommandiert wurde, doch das alles nicht funktionierte. Warum? Unsere tägliche Verpflegung kostete damals je 90 Kopeken pro Person. So. Wie konnte man sich für dieses Geld ernähren? Man bekam immer Gerstengrütze zum Essen.
G.G.: Der Soldatenbrei also?
A.G.: Genau. Dazu gab es noch Knochenfett… Dabei waren unter uns Vertreter verschiedener Altersgruppen. Es gab zum Beispiel einen 23-jährigen Mann, der an einem Magengeschwür litt und, da er ein bisschen Brei mit diesem Knochenfett gegessen hatte, eine Woche lang tatsächlich im Sterben lag, bis er nach Krankenhaus gebracht wurde. So. Dazu gab es noch ältere Menschen. Der Älteste von uns stand an der Schwelle zu seinem 60. Lebensjahr.
G.G.: Was Sie nicht sagen!
A.G.: Wie er nach drüben geriet, ist auch eine großartige Geschichte. Es war ein ganz normaler Opa; etwa 1 Meter 70 – 1 Meter 75 groß mit 150 kg Gewicht. Ein ziemlich großer Mann. Natürlich konnte er die Einberufung ganz ruhig vermeiden. Wieso hatte er das nicht gemacht? Als sich das Bataillon bildete, kam in eines der Dörfer vom Rayon Isjum[11] ein Befehl, laut dessen der dortige Sowchos[12] der Armee einige Fahrzeuge zur Verfügung stellen sollte, sowie den UAZ-469[13], mit dem der Direktor des Sowchos fuhr… Oder war es der Vorsitzende des Kolchos? Egal. Da sagte jener Opa: „Ich habe 10 Jahre gewartet[14], bis ich diesen Wagen bekomme, und ihn erst vor zwei Monaten erhalten. Und nun soll ich den einfach weggeben! Von wegen! Wolltet ihr mir meinen Wagen wegnehmen, nehmt ihn mit mir weg!“
(A.G. lacht) So kam dieser Opa nach Tschernobyl. In Sawintzy wurde ihm die Militäruniform gegeben. Was konnte er aber damit anfangen? In die Stiefelhose konnte er überhaupt nicht schlüpfen und musste die aufschneiden lassen. In die hohen Stiefel passten die Beine nicht hinein. Die wurden auch aufgeschnitten, so dass die am Ende den Kanonenstiefeln ähnlich sahen und er – dem gestiefelten Kater (A.G. und G.G. lachen). Ihm wurde alles nachgeschnitten. Es gab also Vertreter verschiedener Altersgruppen, zwanzigjährige wie sechzigjährige. Dasselbe betrifft den sozialen Aspekt. Es gab Bettler wie Hochschullehrer. Manche hatten mit der Sache gar nichts zu tun. Trotzdem gab es ein ziemlich weites Spektrum.
G.G.: Und wie verstanden Sie sich miteinander?
A.G.: Na… wie die Leitung sich bemühte, unsere Freizeit zu gestalten. Gegen den 19. Mai brach in unserem Bataillon eine Revolte aus. Das habe ich nicht beschrieben, doch meine Kollegen werden davon viel erzählen. Wir stellten unsere Leitung vor der Tatsache, dass wir nirgendwohin gehen, bis die uns wie normale Menschen behandelt oder uns mindestens eine normale Verpflegung zusichert. Es resultierte alles darin, dass der stellvertretende Minister für innere Angelegenheiten in unsere Einheit kam und uns sein Ohr lieh, denn selbstverständlich bekam er alles auf den Hals. Er sagte, alles werde ab dem nächsten Tag ordentlich gestaltet. Und ich muss gestehen, ihm gebührt mein tiefster Respekt. Ab dem nächsten Tag ernährten wir uns täglich für je 3 Rubel 50 Kopeken pro Person. Wir sind das Volk der Extreme. Noch vor ein paar Tagen wurde wegen der 90 Kopeken pro Person gemeckert, nach zwei oder drei Tagen spielen diejenigen, die damals behaupteten vor Hunger zu sterben, mit Kondensmilchbüchsen Fußball. Wir sind schon satt, lasst uns also damit, was wir nicht mehr essen können, Fußball spielen. So sah unsere Freizeit also aus. Gegen den 20. Mai, am 23. oder dem 25. Mai, um genauer zu sein, kam schon die erste Agitationsgruppe[15], die allem Anschein nach vom einheimischen Kulturhaus[16] in unsere Einheit geschickt wurde …
G.G.: Ach so.
A.G.: … hinter unseren Zelten legten wir unseren Klub an: Es wurde ein Grundstück abgegrenzt und mit Pflöcken markiert.
G.G.: Aha. Und was lief über die Bühne? (G.G. lacht)
A.G.: Patriotische Lieder, was sich von selbst versteht, von der „Katjuscha“[17] und sonstigen Kriegesliedern bis hin zu populären Songs. Die Agitationsgruppe bestand aus etwa 5 Personen, die das Kulturhaus eines Dorfes vertraten. Es kam außerdem ein paarmal eine transportable Kinomaschine und uns wurden dann abends Spielfilme gezeigt. Wir spannten damals Betttücher auf, und sie dienten uns als Bildschirme. Was noch… Nach der Revolte erhielten wir Ende Mai etwa drei Fernseher, was damals als undenkbarer Luxus galt. Der eine Farbfernseher ging in den Leninschen Raum, noch einer in den Stab, wo der dritte Fernseher hinging, ist mir entfallen. Also, wie schon gesagt hatten wir Ende Mai die Möglichkeit bekommen, uns manche Spiele der Fußballweltmeisterschaft anzusehen, die 1986 in Mexiko stattfand.
[…] Eines Morgens kam es zu einem witzigen Vorfall. Es war gegen fünf und noch ganz still. Nur der Morgengesang der Vögel war zu hören. Wir schliefen. Plötzlich durchbrach ein wilder Schrei die Stille, als werde jemand erstochen oder passiere sonst etwas Unheimliches. Natürlich wachten alle auf, und zwar schneller, als wenn wir alarmiert wurden. Wir stürzten nach draußen. Es war eigentlich Folgendes passiert. Ein Kollege hatte irgendwo einen Verkaufswagen entdeckt, der etwa ein Kilometer von unserem Truppenlager entfernt stand. Manche von uns wussten von diesem Verkaufswagen und kauften heimlich dort ein. Alkoholgetränke gab es bei uns nicht, in der Anfangszeit sowie später. Nichtsdestotrotz wussten es unsere Jungs, Alkohol irgendwo zu finden. Am Anfang war es aber natürlich kompliziert damit. Was war also an dem Morgen los… Der Kollege entdeckte also diesen Verkaufswagen und kaufte dort ein. Was hielt er in der Hand? Na selbstverständlich! Die alte gute sowjetische Awosjka!
G.G.: (G.G. lacht)
A.G.: Die enthielt, glaube ich, 50 Flaschen Kölnisch Wasser „Sascha“[18]. Er hatte so viel getrunken, wie er nur konnte, und ging ins Truppenlager zurück, ohne die Ordnung zu zerstören. Hinter dem Lager gab es eine Grube. Jemand hatte sie vorher ausgehoben, und sie war schon längst mit Gras bewachsen. Die war weder weit, noch tief; genauer gesagt, etwa 60-70 cm breit und gegen 40 cm tief. Trotzdem konnte unser Kollege diese Grube nicht überwinden, stürzte darin ab und schlief ein. Weiter erzähle ich nach seinen Worten. Er träumte eben davon, etwas zu trinken, weil er Durst bekam. „Und plötzlich spürte ich etwas Nasses mich küssen“, sagte er. „Und es war mir sehr angenehm. Doch weiter fing es an, mich irgendwohin zu ziehen! Ich öffnete die Augen und sah riesige Teufel. Natürlich fing ich vor Schreck an, lauthals zu schreien“. Es grasten auf der naheliegenden Wiese Pferde, wie es sich später herausstellte (A.G. und G.G. lachen).
G.G.: Ach so, Pferde! (G.G. lacht).
A.G.: Ein Pferd kam zu dem armen Kerl (A.G. lacht) und fing an, an ihm zu lecken. (A.G. und G.G. lachen) Das ganze Bataillon lachte sich einen Ast. Ein paar Tage war dieser Zwischenfall das beliebteste Thema aller Gespräche. Und das total ernst gemeint! Unser Volk ist halt schlau. Es fiel mir einmal auf, dass viele in unserem Bataillon abends und manchmal auch morgens beschwipst waren. Das war merkwürdig, denn die Zone, wo wir stationiert waren, war gesperrt und niemand lieferte uns Alkoholgetränke. Es war also unklar, warum die Menschen betrunken waren, bis eines Abends einer ertappt wurde. „Was trägst du?“ – „Kwas[19]“ Dabei waren in seiner Awosjka drei Dreiliterflaschen zu sehen.
G.G.: Aha.
A.G.: Es kapierten alle gleich, dass es wohl keinem einfallen wird, so viel Kwas mitzuschleppen. „Komm mal her!“ Mensch, es war der Wein drinnen! Wie schon gesagt, gab es in unserem Bataillon Menschen Vertreter aller sozialen Gruppen und Schichten. Jemand hockte ständig im Lager und es reichte ihm aus, ins naheliegende Lebensmittelgeschäft zu fahren, um sich dort Gebäck zu kaufen. Jemand nahm in verschiedenen Aktivitäten Zuflucht, jemand jagte nach Abenteuern. Ein Kollege von uns (erst später fanden wir heraus, dass er schon vorher ein paarmal gesessen hatte) brach ins Gelände eines Molkereibetriebes ein und fand dort einen Behälter, den er sofort öffnete (man muss, glaube ich, einen bestimmten Charaktertyp besitzen, damit einem so etwas einfällt!). In der allgemeinen Hektik waren in diesen Behälter 64 Tonnen Obstbranntwein eingegossen. „Während ich durch diesen Betrieb wanderte, vernahm ich einen Geruch“, erzählte er. Das Getränk gärte, der Behälter stand unter freiem Himmel. „Ich spürte deutlich den Hefeweingeruch. Ich ging und ging, konnte den aber lange nichts finden“. Schließlich fand er, was er suchte.
[…] G.G.: Wie war Ihre Abreise organisiert? Wann erfuhren Sie, dass Sie nach Hause gehen, wie bereiteten Sie sich darauf vor?
A.G.: Gegen den 1. Juni begriffen wir alle plötzlich, dass unsere Strahlungsbelastung die zulässige Maximaldosis überschritten hat. Und das, obwohl unsere Strahlungsbelastung erst ab dem 18. oder dem 19. Mai regelmäßig erfasst und eingetragen wurde.
G.G.: Ach so.
A.G.: Vorher gab es kein Strahlungserfassungsbuch.
G.G.: Also keins.
A.G.: Wie schon gesagt war die Anfangsperiode die Zeit totaler Desorganisation. Auch wenn damals die Hälfte der Einberufenen nach Hause gegangen wäre, hätte niemand genau sagen können, ob diese Menschen überhaupt da waren oder nicht, und sie wären dann gar nicht bestraft worden. Nichtsdestotrotz fiel niemanden ein, zu flüchten. Dasselbe gilt dem Strahlungserfassungsbuch. Jeder von uns wurde schon ein paarmal im Kraftwerk eingesetzt, erst dann erschien das Strahlungserfassungsbuch. Dabei bekam das ganze Bataillon während der Zeit, da es noch kein Strahlungserfassungsbuch gab, die maximal zulässige Strahlungsdosen sowie die Strahlungsdosen, die die maximal zulässige Strahlungsbelastung überschritten. Natürlich wurde schon gegen den 1. Juni im Bataillon gemurrt: „Wann werden wir ersetzt?“ Es war nicht mehr möglich, sich im Kraftwerk zu betätigen. Andererseits wurde es verlangt. Es bestand eine bestimmte Aufgabe, und wenn unser Bataillon Bereitschaftsdienst hatte, musste es diese leisten, in die Zone, unmittelbar nach Tschernobyl und ins Kraftwerk fahren, durch die Zone cruisen und beobachten. […]
Gegen den ersten Juni begriffen wir letztendlich, dass unsere Strahlungsbelastung alle zulässigen Dosen überschritt, und es wurde im Bataillon gemurrt. Wir gingen dem Kommandanten tagtäglich mit unseren Vorwürfen auf die Nerven. „Ich rufe dort ständig an, ich rufe ständig in Charkiw an, das neue Bataillon wird gerade gebildet“, war seine Antwort. Es kam der 6. Juni. […] Gegen 5 abends kamen jene Jungs. Die Armen wurden aus den Bussen nicht ausgelassen, wahrscheinlich wollte man es verhindern, dass wir denen viele „interessante“ Einzelheiten verraten. Es war etwa genauso heiß wie heute, die Temperatur betrug ungefähr 30 Grad. Letztendlich wurden wir auf eine Seite getrieben, die Neuangekommenen wurden irgendwo abseits ausgeladen. Wir stiegen in den Bus ein und, als wir Kyjiw hinter uns ließen, hielten wir irgendwo an, um zu übernachten. Um 12 Uhr des 7. Juni waren wir schon in Charkiw. Niemand wusste was von unserer Ankunft, niemand organisierte was im Voraus. Man erfuhr, dass wir ankommen, einen halben Tag vor unserer Ankunft.
[…] Leider geschah es. Am 7. Juni kehrten wir also zurück, und am 22. passierte es. Zuerst konnte ich nichts verstehen. Wie schon erwähnt hatte ich vorher ziemlich aktiv Volleyball gespielt. So. Meine Patientenakte hatte nur einen Eintrag enthalten. Mir war nämlich einmal eine Zahnfüllung eingesetzt worden. Im Übrigen war ich gesund. So. Und plötzlich wurde ich gerade auf dem Arbeitsplatz ohnmächtig. Na ja, am Vortag hatte ich Kopfschmerzen, und an dem Tag tat mir der Kopf weh… Und dann geschah es. Es wurde der Notarzt gerufen und ich wurde ins Institut für medizinische Radiologie geholt.
G.G.: Klar.
A.G.: So. Seit dem Tag fing meine Patientenakte an zuzunehmen. Dazu muss man noch sagen, dass es im Zeitraum von 1986 bis 1990 keine Erkrankungen, die mit Tschernobyl verbunden sein konnten, in Frage kamen.
[…]
[1] Max Otto von Stierlitz ist Protagonist einer Bücher-Reihe des sowjetischen Schriftstellers Julian Semenov, die später verfilmt wurde, unter dem Namen „Siebzehn Augenblicke des Frühlings“ im sowjetischen Fernsehen erschien und bis auf den heutigen Tag in den Ländern der GUS eine große Beliebtheit genießt.
[2] So wurde in der Sowjetunion eine Netztasche genannt, mit der man normalerweise einkaufen ging.
[3] Die „Komsomolskaja Prawda“ gehörte in der Sowjetunion zu den meist verkauften und beliebtesten Zeitungen. Auch nach dem Zerfall der Sowjetunion erscheint sie unter ihrem ursprünglichen Namen in Russland und anderen Ländern der GUS.
[4] TASS ist der Name von der größten und der wichtigsten Nachrichtenagentur der Sowjetunion und – nachdem die UdSSR zerfallen ist – Russlands.
[5] Kameraderie
[6] Leichtsinniges und oft unbegründetes Selbstbewusstsein vor der Ausführung einer schwierigen Arbeit.
[7] Damit wird die Kommunistische Partei der Sowjetunion gemeint.
[8] So wurden zu sowjetischen Zeiten Freizeiträume genannt, die es bei jedem Betrieb, jeder Kaserne und jeder Bildungseinrichtung gab.
[9] Andeutung an die Zeit des Großen Terrors, der im Jahr 1937 in der Sowjetunion ausbrach.
[10] Ein Dorf im Rayon Iwankiw (Oblast Kyjiw)
[11] Eines der Rayone von der Oblast Charkiw
[12] Sowjetischer landwirtschaftlicher Betrieb.
[13] Geländewagen des sowjetischen und später des russischen Herstellers „Uljanowskij Automobilnyj Sawod“.
[14] In der Sowjetunion bestanden für Kraftfahrzeuge, Wohnungen und Haushaltsgeräte Wartelisten. Diejenigen, die sich in solche Wartelisten eingetragen wurden, konnten auf die Erfüllung ihres Lebenswunsches gute 10 oder sogar 20 Jahre warten, die aber garantiert und gratis (oder zu einem sehr billigen Preis) letztendlich bekommen.
[15] Eine Künstlergruppe, die zur Unterhaltung und Aufklärung verschiedene Dörfer und Militäreinheiten besuchte.
[16] So hießen zu sowjetischen Zeiten Kulturzentren in Dörfern und Kleinstädten.
[17] Eines der beliebtesten sowjetischen Lieder aus den Zeiten des Großen Vaterländischen Krieges (1941 - 1945).
[18] In der Sowjetunion diente das Kölnisch Wasser ziemlich oft als Ersatz alkoholhaltiger Getränke.
[19] Ein in der Ukraine, in Russland und Weißrussland beliebtes alkoholfreies Getränk, das durch Gärung vom Brot hergestellt wird.