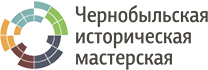Aleksandr
Aleksandr
- Liquidator
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Wohnort:
Die Zeit, in der Tschernobyl-Zone:
Natalia Koslowa (nachstehend kurz N.K. genannt): Also, heute ist der 14. Mai 2013, und wir sind gerade im „Verband Tschernobyl“. So. Ich glaube, wir können schon anfangen. Also, meine erste Frage an Sie, die ist eigentlich ziemlich umfangreich: Erzählen Sie bitte die Geschichte Ihres Lebens.
A.G.: (lacht) Ja. Also, geboren bin ich in der Ukraine. Was meine Eltern anbetrifft, so stammt mein Vater aus der Baikalregion. Er war Transbaikalkosake.
N.K.: Toll!
A.G.: Ja.
N.K.: Was Sie nicht sagen.
A.G.: So. Er war Offizier, hatte fast den ganzen Großen Vaterländischen Krieg hinter sich, nahm daran von 1942 bis 1945 teil. Nach dem Kriegsende wurden ihm hohe staatliche Auszeichnungen verliehen. 1964 starb mein Vater an den Kosequenzen der erlittener Wunden.
N.K.: Oh…
A.G.: Ja. Meine Mutter war Ukrainerin. Sie nahm auch an dem Großen Vaterländischen Krieg teil und war von 1943 bis 1944 an der Front. Sie war erbliche Saporoger Kosakin.
N.K.: Sie stammen also aus einer Kosakenfamilie.
A.G.: Genau. Wir sind eine herausragende Dynastie. Natürlich legen wir jetzt darauf keinen großen Wert, doch im Tiefsten des Herzens sind wir Kosaken.
N.K.: Sicher.
A.G.: Denn wie kann man seiner Ahnen abschwören? Ich erinnere mich gut an meine Opas. Der Opa vä… mütterlichseits trug immer einen Bryl[1] und eine Wyschiwanka[2]. Die Verwandten väterlichseits trugen dagegen die Lampassen, die Türkenhosen. So. Was kann man noch sagen? Wie meine Eltern einander kennengelernt und sich in einander verliebt haben, ist eine spannende Geschichte. Zuerst lernte mein Vater, als er bei Stalingrad[3] war, den Bruder meiner Mutter Wladimir Aleksandrowitsch Starostenko kennen, der genauso wie mein Vater Offizier war. Er zeigte meinem Vater das Foto seiner Schwester, meiner zukünftigen Mutter, und mein Vater verliebte sich, wie man sagt, auf den ersten Blick.
N.K.: In das Foto?
A.G.: Genau. Aber ehrlich gesagt war meine Mutter wirklich sehr hübsch… Das können Sie mir glauben. Und da kam es später zu so einem Zwischenfall. Ein Granatsplitter traf in seinen Orden des Roten Sterns[4].
N.K.: Genau in den Orden?
A.G.: In den Orden des Roten Sterns.
N.K.: Oh du meine Güte.
A.G.: Dieser Orden war bei uns daheim aufbewahrt und wir konnten uns alle selber von der Wahrheit dieser Geschichte überzeugen. Der Splitter traf also in die linke Zacke… und eckte sie ein bisschen ab. Sie wissen wohl, dass die Zacken des Ordens mit Emaille beschichtet ist.
N.K.: Ja.
A.G.: Der Splitter traf also in den Orden, rutschte ab, durchbrach den Brustkorb, ging am Herzen vorüber und blieb im Rücken stecken.
N.K.: Im Rücken.
A.G.: Ja. Einige Minuten zuvor, hatte er aber das Foto meiner Mutter in die Tasche gesteckt. Bei der Verletzung wurde sie mit Blut überströmt, und so meinte mein Vater bis zu seinem letzten Atemzug, dass dieses Foto ihn und meine Mutter zu einer Familie verband und dass sie von dem Moment an durch Blut verwandt waren. Und das die Liebe meiner Mutter seinen Tod abwendete. 1945 wurde er wieder verwundet. Das passierte schon irgendwo an der Grenze zwischen Polen und Deutschland, als sie schon über die Neiße gegangen waren. Es handelte sich um eine leichte Verletzung, und wieder landete mein Vater in einem Spital. Dort traf er Onkel Wolodja, der auch verwundet war. Wiederum führte sie das Schicksal zusammen.
N.K.: Na ja.
A.G.: Nach dem Spital wurde mein Vater im April 1945 beurlaubt und durfte nach Hause, also an den Baikalsee, gehen. Stattdessen ging er aber nach Charkiw und hielt um meine Mutter an. Und stellen sich ihr vor: Sie heirateten am 9. Mai 1945.
N.K.: Was Sie nicht sagen.
A.G.: Es war doch der Tag des Sieges.
N.K.: …und ihrer Hochzeit.
A.G.: Tja, und ihrer Hochzeit. Früher war es viel einfacher als jetzt: Man kam einfach ins Standesamt und ließ sich gleich trauen. Im Zivilleben war mein Vater Maschinenbautechniker; meine Mutter leitete ein Lebensmittelgeschäft. Außerdem war sie eine leidenschaftliche Laienkünstlerin und war Regisseurin, genauer gesagt, Assistentin des Regisseurs.
N.K.: Regisseurassistentin.
A.G.: Ja, bei einer Laienkünstlergruppe. So. Hätte ich gewusst, dass ich davon erzählen werde, so hätte ich das Prospekt über das Stück mitgenommen, das sie auf die Bühne brachten. Das Stück hieß „Ljubow Jarowaja“[5]. In jenem Prospekt gibt es alle Informationen dazu. Ich wusste doch aber nicht Bescheid.
N.K.: Aha.
A.G.: So. Soll ich auch über meine Brüder erzählen? Meine Eltern bekamen vier Söhne. Und die kamen in Liebe zur Welt.
N.K.: Aha.
A.G.: Vier Söhne. Stellen Sie sich so was vor? Als mein Vater 1964 starb, blieb meine Mutter bis zu ihrem letzten Atemzug Witwe. So. Das wäre es was meine Eltern angeht. So. Dazu muss ich sagen, dass sie uns alle groß gezogen haben. So. Sie ließen fast alle von uns ausbilden und schickten uns zum Pflichtwehrdienst. Wir alle leisteten den Wehrdienst. So. Wir dienten in verschiedenen Orten. Der älteste Bruder diente in Kyjiw, bei einer Fernmeldetruppe. Wladimir, der mittlere Bruder, leistete den Wehrdienst teilweise in der Tschechoslowakei. Es war im Jahr 1967 oder 1968. So. Was den Jünstgen von uns angeht… ich bin doch auch der Mittlere… Ich landete also 1986 in Tschernobyl, wo ich an der Beseitigung der Folgen der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl teilnahm. Georgij, der jüngste Bruder, der nach unserem Vater benannt worden war, war Scharfschützentrainer. Als Trainer für diesen angewandten Fallschirmsport bildete er unsere Fallschirmspringer aus, die dann später nach Afganistan geschickt wurden[6].
N.K.: Aha.
A.G.: So. Übrigens war er da drüben auch. Er schickte die nach drüben als Begleiter mit einem Flugzeug. Was mich aber angeht, so landete ich, wie schon gesagt, 1986 in Tschernobyl, wo ich im Reaktorblock eingesetzt wurde. Hier habe ich alles ausführlich beschrieben.
N.K.: Und wie gerieten Sie nach drüben? Wussten Sie, wo Sie hingehen? Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie nach drüben mussten?
A.G.: Nein, davon wusste ich gar nicht Bescheid. Damals arbeitete ich bei der Charkiwer mobilen mechanisierten Bau- und Montagekolonne. Kurz gesagt errichteten wir in der ganzen Oblast Charkiw Wohnhäuser wie agrarindustrielle Komplexe und bauten die Infrastruktur aus. Als sich die Havarie in Tschernobyl ereignete… Also in der Gesellschaft wurde über die Ereignisse in Tschernobyl nicht gesprochen, die Menschen waren darüber nicht informiert. In den Zeitungen wurde darüber kaum was geschrieben und im Fernsehen – kaum was gezeigt. Deshalb ahnten die meisten Menschen, dass es sich um ein großes Unheil handelte, das aber ziemlich fern zu sein schien. So. Der erste Einberufungsbefehl kam im Juni 1986.
N.K.: Aha.
A.G.: Damals war ich aber in einer Klinik… Genauer gesagt, war ich schon in der ambulanten Behandlung. 1985 war ich wegen der Varikose operiert worden. Mir wurden unter örtlicher Betäubung betroffene Gefäße hinausoperiert. So. Und danach war ich eine gewisse Zeit lang in der ambulanten Behandlung, denn es gab postoperative Folgen. So. Deshalb ließ man mich damals in Ruhe. Der zweite Einberufungsbefehl kam im August. Aber damals landete ich zum Unglück (oder ganz im Gegenteil, zum Glück) wegen akuter Blinddarmentzündung im Krankenhaus.
N.K.: Oh…
A.G.: Ja.
N.K.: Au Backe.
A.G.: Ich wartete schon auf eine Operation, die gab es aber zum Glück (oder ganz im Gegenteil, zum Unglück) nicht. So. Die Diagnose, die mir damals gestellt wurde, prägte sich mir für den Rest des Lebens ins Gedächtnis ein. Die war ziemlich burschikos und witzig, diese Diagnose: Appendikuläres Infiltrat.
N.K.: Auweh!
A.G.: Ja. Eine interessante Diagnose. Allerdings setzte sie den Einberufungsbefehl außer Kraft. Ich dachte, ich habe schon den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber ich irrte mich. Damals arbeiteten wir beim Hauptpostamt. Eines Tages, als wir beim Hauptpostamt arbeiteten, kam ein Woronok[7] mit Offizieren.
N.K.: Aha.
A.G.: So. Sie gingen zu unserem Baubetreuer und sprachen mit ihm kurz. Dann kamen sie zu uns und fragten nach meinem Namen. „Garmanow, Aleksandr Georgiewitsch“, stellte ich mich vor. So. Sie reichten mir den Einberufungsbefehl und ließen in einem Erfassungsheft meine Unterschrift setzen. Und gleich wurde ich ins Militärkommissariat geholt.
N.K.: Direkt vom Arbeitsplatz?
A.G.: Genau. Diese Offiziere ließen mich in den Woronok einsteigen und holten mich ins Militärkommissariat.
N.K.: Ohne persönliche Gegenstände?
A.G.: Genau. Ich wurde ins Militärkommissariat direkt von meinem Arbeitsplatz geholt. Dort ließ der Militärkommissar uns (etwa 20 Personen) in einem kleinen Raum versammeln. So. „Also, Jungs, der Reaktor lässt sich immer noch nicht beruhigen. Diejenigen, die dort jetzt eingesetzt sind, haben schon höchst zulässige Strahlungsdosen bekommen und müssen ersetzt werden. Jetzt sind sie dran, ihrer Heimat zu dienen“. Es konnte niemand was einwenden. Denn wenn du alle Dokumente unterschieben hast…
N.K.: … kannst du schon nicht hinausschwindeln.
A.G.: … bist du schon wehrpflichtig und musst den Eid ablegen. Hast du den Eid abgelegt, bist du Militärangehöriger.
N.K.: Aha.
A.G.: So. Danach gab es eine Ärztekommission. Obwohl ich operiert worden war und ich dann später wegen der Blinddarmentzüdung ins Krankenhaus wieder aufgenommen wurde, stand im Befund „Gesund“ geschrieben. So. Dieses Dokument wurde mir aber nicht ausgehändigt, der Militärkommissar nahm es weg. So. Im September ließ das Militärkommissariat der Oblast Charkiw uns alle an der Kozarka[8] zusammentreffen.
N.K.: Uhu.
A.G.: So. Es kamen unheimlich viele Menschen. So. Es wurden Listen zusammengestellt. Wir warteten. Plötzlich wurde uns bekannt gegeben, wir dürfen nach Hause gehen. Warum? Wie sich später erwies, war der Mangel an Personal behoben, dank der Freiwilligen wurden dort sogar zu viele Arbeitskräft eingesetzt. Damals gab es doch Freiwillige, die nach drüben aus eigenem Wunsch und eigener Initiative gingen. Später aber, als die ein paarmal im Reaktor eingesetzt wurden und ziemliche Strahlungsdosen bekamen, wollten viele von ihnen schnell nach Hause – ich sah und hörte es selber.
N.K.: Aha.
A.G.: So. Das durften wir aber nicht tun. Da wir wehrpflichtig waren und den Eid abgelegt hatten, kam so was nicht in Frage. So. Nach jenem Befehl gingen wir alle ruhig nach Hause und dachten schon, dass man uns für längere Zeit in Ruhe ließ. Pustekuchen. Am vierten Oktober wurden wir wieder an der Kozarka versammelt. Den ganzen Morgen wurden neue Listen zusammengestellt. Vor Langweile verschwanden manche von uns hinter den Zaun. Erst später kapierte ich, wo sie hingingen und wozu. Sobald alle Formalitäten erledigt wurden, stiegen wir gegen Mittag in die Busse ein und gingen in Richtung Tschuhujiw[9].
N.K.: Aha.
A.G.: So. Wenn man durch diese Gegend fährt, kommt einem gleich der Name Repins[10] in den Sinn. So. Schließlich kamen wir zum Fluhafen und stiegen aus den Bussen aus, die aber nicht wegfuhren, sondern stehen blieben – ob gezielt oder vorsichtshalber, weiß ich nicht. So. Es war zwei oder drei Uhr nachmittags. Das Wetter war schön und warm. Wir warteten auf das Flugzeug. Das stand aber schon auf der Startbahn, ein großes Militärtransportflugzeug, eine Antei[11].
N.K.: Aha.
A.G.: So. Wir standen also und warteten, es wurde doch lange kein Startbefehl erteilt. Deshalb gönnten sich einige von uns eine Entspannung. Und es stellte sich da heraus, dass diejenigen, die hinter den Zaun liefen (A.G. lacht), ordentlich eingekauft hatten.
N.K.: Ach so, sie gingen also Alkohol kaufen (gleichzeitig).
A.G.: Genau. Ich wurde zum Obmann ernannt. Es waren dort etwa 100 oder 120 Personen. Und wäre ich kein Obmann gewesen, so hätte ich auch mit allen getrunken. Aber da ich Obmann war…
N.K.: … wäre es nicht erwünscht, so etwas zu tun.
A.G.: Na ja. Wir mussten auf die Jungs aufpassen. Uns wurde befohlen, wir sollten auf die Jungs aufpassen, damit sie nicht auseinanderlaufen. So. Sie sollten alle in Sichtweite bleiben. Als die sich die Gurgeln schmierten, fingen sie an zu kämpfen, was aber seltsam war, es gab dabei keinen ernsten Streit, keinen Ärger, keine Prügeleien. So.
N.K.: Man trieb also einfach Possen?
A.G.: Na ja, einigermaßen. Man heiterte sich auf solche Weise ein bisschen auf. Denn wir mussten gute drei Stunden warten und es war schön langweilig. Gegen Abend kam der Befehl. Aha, Moment mal! Es fing doch an zu regnen. Uns wurde befohlen, trotzdem einzusteigen. Mit Mühe und Not nahmen wir unsere Plätze im Flugzeug (A.G. lacht). Na ja. Die Piloten warfen die Motoren an, und die Jungs sprangen dabei von ihren Plätzen und fingen an zu singen und zu tanzen..
N.K.: Echt?
A.G.: Ja.
N.K.: Klar.
A.G.: Es gab dabei ein kaum zu ertragendes Getöse, denn das Flugzeug war doch leer. Und stellen Sie sich vor, wie es war, als etwa einhundert Personen mit ihren Füßen auf den Boden stampfen? (A.G. lacht).
N.K.: Ach du meine Güte.
A.G.: Alle sangen und tanzten, und da kam plötzlich ein Entwarnungssignal. Das Flugzeug fliege wegen der schlechten Wetterverhältnisse nirgendwohin (wir sollten nämlich in die Stadt Bila Zerkwa, Oblast Kyjiw, fliegen), der dortige Flughafen sei nicht bereit, uns zu empfangen. Ich glaube, es war eher ein Trick von Seiten der Piloten und der Kommandanten, die uns begleiteten. So. Uns blieb also nichts Anderes übrig als auszusteigen. Mit den Bussen wurden wir in die Tschuhujiwer Kasernen gebracht, wo eine Militäreinheit stationiert war. Dort wurden wir unterbracht. Den Besoffenen gab man Matratzen und schickte sie in die Sporthalle schlafen (A.G. lacht), die Normalen…
N.K.: Die waren doch verrückt.
A.G.: Sie waren doch besoffen. Sie wollten nicht schlafen. Die dortigen Offiziere holten sie in die Sporthalle und ließen sie dort auf Matratzen schlafen. Wir schliefen auf Pritschen. Am frühen Morgen standen wir auf, frühstückten, stiegen reibungslos in die Busse und dann in die Antei wieder ein und flogen nach Bila Zerkwa. Dort kamen wir ziemlich schnell an, stiegen aus und gingen in die Militäreinheit zu Fuß.
N.K.: Aha.
A.G.: Dort ließ man uns die Zivilkleidung ausziehen. Wir bekamen Unterwäsche und die Sommeruniform. Nach dem Mittagessen stiegen wir gleich in die URALe[12] ein und gingen in Richtung Tschernobyl.
N.K.: Aha.
A.G.: So. Wie lange wir unterwegs waren, ist mir ehrlich gesagt entfallen. Aber gegen Abend waren wir schon in der Militäreinheit. Sie lag im Dorf Orane. Dort war Brigade 25 stationiert.
N.K.: Aha.
A.G.: Und da landete ich. Genauer gesagt gingen wir sofort zum Stabchef. Es herrschte ein gewisses Ducheinander, man wusste nicht, was man mit wem anfangen soll. Ich bin Militärfeuerwehrmann, weil ich beim Pflichtwehrdienst… Apropos, als ich damals ins Militärkommissariat an die Kozarka kam, überfielen mich die Gedanken, wie ich als 18-jähriger junger Mann zum Pflichtwehrdienst einberufen wurde. Wissen Sie, ich wollte damals zur Marineinfanterie.
N.K.: Aha.
A.G.: Es war mein Kindertraum. Als Kind hatte ich darüber viele Bücher gelesen.
N.K.: Na klar.
A.G.: So. Ich hoffte also, in die Marineinfanterie zu geraten. Ich bat die Führung, mich den „Käufern“, die ins Militärkommissariat aus dem Baubataillons aus dem Geschwader und so weiter kamen, mich ihnen nicht zu überlassen. So. Wir warteten zwei Tage und zwei Nächte, endlich sind wir in den Wagen eingestiegen und ausgerechnet damals, als wir das Militärkommissariat verließen, kam die Marineinfanterie.
N.K.: Kann ich mir vorstellen, wie Sie sich dabei fühlten!
A.G.: Genau. Es war entsetzlich. Aber wir wurden alle trotzdem nach Moskau geholt. Auch in Moskau blieben wir nicht lange, sondern wurden in die Umgebung Moskaus gefahren, wo sich die erste Luftverteidigungslinie der Stadt Moskau befand, der ehemaligen Hauptstadt der UdSSR.
N.K.: Also, damals erinnerten Sie sich daran.
A.G.: Ich war sehr unzufrieden, dort gelandet zu sein. Aber da nahm man mich unter die Lupe – und ich muss sagen, ich trieb damals Sport und sah sportlich aus – und so geriet ich in die Sonderabteilung. Ich meine, während des Pflichtwehrdienstes.
N.K.: Ach so, Sie erzählen immer noch über den Pflichtwehrdienst.
A.G.: Na ja. So geriet ich also in die Sonderabteilung, und zwar in die Feuerwehrkompanie, ließ mich ausbilden und wurde nach einiger Zeit Oberfeldwebel. Es war, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 1972… genauer gesagt 1974… als der Torfboden in der Umgebung Moskaus brannten. Deshalb hatten wir sehr viel zu tun, wofür ich dann für 10 Tage beurlaubt wurde. Apropos unsere Garnison war in dem Ort stationiert, wo sich das Hauptquartier des stellvertretenden Verteidigungsministers der UdSSR Pawel Fjodorowitsch Batizki befand. Im Brandfall sollten wir alle Menschen, die es dort gab, und insbesondere ihn retten. Am wichtigsten waren für uns aber die 180 Meter tiefen Schächte, wo die Raketen lagen. Wir sollten also alle Bunker und alle Etagen dieser Schächte sowie alle Ein- und Ausgänge kennen. Wir wurden darin ausgebildet und wussten, wie man die Menschen retten sollte.
N.K.: Aha.
A.G.: Auch im Fall eines eventuellen Aufflammens in einem oder in mehreren Schächten waren wir einzusetzen. Außer uns gab es dort noch Topographen und andere Fachleute. Alle diese Dienste waren für die Evakuierung von Menschen durch die Ausgänge zuständig. Übrigens leisteten mir die Kompetenzen, die ich dort erwarb, in Tschernobyl einen guten Dienst.
N.K.: In Tschernobyl.
A.G.: Denn es gab dort dasselbe System: Etagen, Bunker und so weiter. Und so führten wir die Menschen durch die Gänge des Kraftwerks, die eigentlich Labyrinthen sehr ähnlich waren.
N.K.: Achtete man auf Ihre kompetente Meinung?
A.G.: Gewiss. Denn wir waren darin ausgebildet, wie man die kompliziertesten und gefährlichsten Aufgaben anpackt. Deshalb wurden wir Feuerwehrleute in den Reaktor ständig geschickt. In dem Monat, den ich da drüben verbrachte, war ich 17 Tage im Reaktor eingesetzt, genauer gesagt im 4… ne, im 3. Reaktorblock… im 4. Reaktorblock beschäftigten wir uns mit der Dekontamination.
N.K.: Was machten Sie also im Reaktor?
A.G.: Gleich erzähle ich darüber.
N.K.: Entschuldigung.
A.G.: Ich will bloß über meinen Pflichtwehrdienst noch ein paar Worte fallen lassen.
N.K.: Wie Sie meinen.
A.G.: Diese Erfahrung kam mir also bei der Bewältigung der Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl zugute. Denn als wir beim Pflichtwehrdienst ausgebildet wurden, brachte man uns bei, keine Angst bei Brandfällen zu haben. Wir hatten stets Probealarme und Trainings, während deren man explosive Pakete explodieren ließ und uns als Feuerwehrleute durch das Feuer durcharbeiten ließ. So wurden wir scharf gemacht.
N.K.: Es wurde Ihnen also beigebracht, keine Angst zu haben?
A.G.: Genau.
N.K.: Toll.
A.G.: Stellen Sie sich vor, Sie gehen eine Nahkampfbahn entlang und es explodiert ein explosives Paket irgendwo in der Nähe. Nun heißt es für Sie nicht vom Balken zu fallen. Und so müssen Sie weiter laufen.
N.K.: Was Sie nicht sagen.
A.G.: Sie haben eine Gasmaske an, hier steckt ein Maschinenpistolenlauf, dazu noch schleppen Sie den Wasserschlauch. Wenn etwas in der Nähe explodiert, müssen Sie auch durch das Feuer weiterlaufen und dürfen keinesfalls vom Balken fallen. Oder…
N.K.: Verbrannte man sich dort nicht?
A.G.: Nein. So was kam erst dann vor, wenn man Maulaffen feilhielt. Sonst gab es so was nicht, dank des Windes und so weiter und so fort.
N.K.: Sonst war alles nicht so schlimm?
A.G.: Na ja. Es gab natürlich manchmal Fälle, da Jungs rausflogen.
N.K.: Aha.
A.G.: Es gibt verschiedene Menschen. Der Mensch ist doch ein Lebewesen, das sich immer um sich selbst kümmern muss. Manche übertrieben aber damit, weil sie Angst hatten. Dann wurden sie in Einheiten wie Baubataillone geschickt, wo es viel ruhiger war. Was mich eigentlich angeht, so kam mir diese Erfahrung, wie schon gesagt, später in Tschernobyl zugute.
N.K.: Aha.
A.G.: Das wäre es, was den Pflichtwehrdienst angeht. Am 4. kamen wir also nach drüben und meldeten uns an. Am Abend wurde ich in die Feuerwehrkompanie 137 als Kommandant von Zug 1 und später zum Kommandanten der Kompanie geschickt. Wir besprachen im Stab alle Details. Da es schon spät war, gab man uns eine kalte Verpflegung und bot uns an, vor der Nachtruhe einen Spielfilm anzusehen.
N.K.: War es unmittelbar in Tschernobyl?
A.G.: Nein, es war in der Einheit, die im Dorf Orane stationiert war.
N.K.: Ach so!
A.G.: Übrigens war unsere Einheit nicht unmittelbar im Dorf Orane, sondern in seiner nächsten Umgebung stationiert.
N.K.: Ach so.
A.G.: In der Einheit gab es ein eigenes Sommerfilmtheater, wenn man es so nennen darf.
N.K.: Ach so.
A.G.: Wir gingen hin und sahen uns einen Spielfilm an. Doch wie dieser Film hieß, ist mir schon entfallen. So. Danach gingen wir in unsere Zelte schlafen. Es waren nämlich Militärzelte, die für Kompanien bestimmt waren. Links und rechts standen je zwei Reihen von zweistöckigen Pritschen. Und die waren ziemlich lang, diese Reihen. In der Mitte stand eine Burschujka[13], die aber damals nicht benutzt wurde.
N.K.: Aha.
A.G.: Denn im Oktober 1986 war es ziemlich warm. Am Morgen standen wir auf, machten Morgentoilette und gingen in die Kantine. Die lag unter freiem Himmel. So. Danach gab es einen Apell, während dessen ich mich mit dem Personenbestand kurz bekannt machte. Ich wurde als Zugkommandant vorgestellt.
N.K.: Aha.
A.G.: Genauer gesagt, als Gehilfe des Zugkommandanten. Wir stellten uns gegenseitig also kurz vor. Denn es war schon ein Befehl erteilt worden, und wir wussten, dass wir gleich nach Tschernobyl müssen.
N.K.: Aha.
A.G.: Wir wurden bloß darüber unterrichtet, wie man sich unterwegs benehmen soll und dass man die Blütenblätter keinesfalls absetzen darf. Wissen Sie, was Blütenblätter waren?
N.K.: Nein, was heißt eigentlich „Blütenblätter“?
A.G.: Ein Blütenblatt ist so ein Mullverband. Man bindet es am Hinterkopf fest. Im Großen und Ganzen hatten wir sonst keinen weiteren Schutz. Nur diesen Mullverband. Wozu? Damit man zumindest diesen Staub nicht einatmet, der kontaminiert war.
N.K.: Den radioaktiven Staub.
A.G.: Ja, genau, den radioaktiven Staub, der ringsum war. Auch innerhalb der Einheit zeigten die Messgeräte hohe Strahlungswerte. Unsere stündliche Strahlungsbelastung betrug, so die Einträge, 0,02 Röntgen pro Stunde. Hier, in der Einheit. Aber selbst in der Einheit war die Strahlungsbelastung viel höher!
N.K.: Die Strahlungsbelastung war sehr hoch.
A.G.: Ja. Das wurde eingetragen, verstehen Sie? Wenn sich jemand von Tschernobyl erholte, ließ man ihn eine gewisse Zeit lang „im Hintergrund sitzen“, das heißt, er durfte einige Tage in der Einheit bleiben. Auch hier betrug die Strahlungsbelastung laut der Einträge 0,02 Röntgen pro Stunde. Normalerweise verließen wir unsere Einheit um neun oder zehn vormittags. Wir stiegen in die SILe ein und setzten die Blütenblätter an. Man klappte den Mattenüberzug herunter. Die Fahrzeuge waren alle gedeckt, damit möglichst wenig Staub nach innen gerät.
N.K.: Na ja.
A.G.: Der Mattenüberzug wurde also heruntergeklappt und wir fuhren los. Mein erster Einsatz entfiel auf den vierten oder den fünften… oder den sechsten…
N.K.: … Oktober.
A.G.: Tja, Oktober… Auf den sechsten Oktober also. Natürlich waren wir halt neugierig, die Gegend zu sehen, durch die wir fuhren, und so guckten wir durch Schlitze und kleine Löcher, die der Mattenüberzug hatte, hinaus. Wir sahen verschiedene Dörfer. Dann erreichten wir den Fluss Usch und die 30-km-Zone, die von Milizisten bewacht wurde. An der Grenze gab es eine Sperre, an einem Schild stand geschrieben: „Vorsicht! Sie betreten jetzt die Zone der gefährlichen radioaktiven Kontamination“. Dabei konnte nicht jeder rein. Um in die 30-km-Zone zu gelangen, brauchte man einen Spezialpassierschein. Dasselbe galt für die Militärangehörigen. Wir wurden angehalten, unsere Passierscheine wurden geprüft, dann salutierten uns die Milizisten, wünschten uns eine gute Reise und ließen uns rein. Sie respektierten uns, weil wir tatsächlich in Teufels Küche gingen, ich meine, in den Expolsionsherd.
N.K.: Na klar.
A.G.: Aber da sie in der 30-km-Zone eingesetzt wurden, mussten sie das alles auch einatmen…
N.K.: Die ganze Radioaktivität.
A.G.: Ja. Die Milizisten. Die verstanden, dass wir in den Explosionsherd gingen und die erwiesen uns Ehrenbezeugung.
N.K.: Sie drückten ihre Hochachtung aus.
A.G.: Ja. Unterwegs hielten wir nirgendwo an. Die Namen der Dörfer, durch die wir fuhren, sind mir entfallen, die kann ich aber nachschlagen.
N.K.: Macht nichts.
A.G.: Soll ich mir also keine Sorgen machen?
N.K.: Nein, erzählen Sie bloß weiter.
A.G.: Aber natürlich fuhren wir durch Dörfer und wir guckten durch die Schlitze hinaus.
N.K.: Na ja.
A.G.: Und davon, was wir sahen, wurde uns unbehaglich zumute. Innerhalb der ganzen Strecke, die wir zurücklegten, waren keine Leute zu sehen. So. Wir sahen weder Vögel noch so was… Und was die Dörfer angeht…
N.K.: Also, weder Menschen, noch Tiere?
A.G.: Na ja, ich meine, unterwegs. Die Dörfer, durch die wir kamen, waren schon mit Unkraut, Brennesseln und Gras bewachsen. Und dazu war dieses Dickicht schön hoch. Dahinter waren schon die Fensterläden fast nicht zu sehen. Die Straßen waren noch zu sehen. Aber es gab weder Menschen, noch Haustiere und Vögel… Keine Seele… Und so wurde uns unbehaglich zumute. Als ob ein Nachkomme Dschingis Khans durch diese Dörfer gegangen wäre …
N.K.: Oder nicht?
A.G.: … und alle Dorfbewohner in die Sklaverei verschleppt hätte. Es lagen allerlei Gegenstände herum – Kram, Papiere, Klamotten… Manche Haustüren waren weit aufgeschlagen. Denn die Menschen ließen während der Evakuierung alles so, wie es war. Es fiel ihnen nicht einmal ein, die Haustüren zu verschließen. Im bestimmten Sinne flüchteten sie aus ihren Dörfern. Die Milizisten, die am Checkpoint standen, halfen übrigens, sie zu evakuieren.
N.K.: Aha.
A.G.: Wir fuhren über fünf Dörfer, bis wir das Kraftwerk erreichten.
N.K.: Aha.
A.G.: Was erstaunte mich in erster Linie, als wir ins Kraftwerk kamen? Als wir ankamen, fiel uns vor allem auf, wie riesig und majestätisch das Gebäude des Kraftwerks aussah. Erstaunt wurden wir aber nicht dadurch. Ich sah einen ganz jungen, bartlosen Soldaten in einem speziellen Häuschen stehen. Ich glaube, er war höchstens 18 Jahre alt und war frisch einberufen. Und so stand er in diesem Häuschen und verrichtete seinen Dienst. „Lauf weg von hier so schnell, wie du kannst“, fiel mir gleich ein. „Wieso stehst du hier, atmest die Radioaktivität ein und lässt sie dich durchleuchten?!“ Wer hätte auf so eine Idee kommen können, diesen Soldaten dort zu lassen?
N.K.: Na ja.
A.G.: Wem fiel ein, dort den Wachdienst ausüben zu lassen? Was hatte jener Soldat dort zu bewachen? Durchaus unklar. Sobald wir ankamen, kam der Befehl „Im Laufschritt Marsch!“. Übrigens bewegten wir uns während des Einsatzes im Kraftwerk ausschließlich im Laufschritt…
N.K.: Nur im Laufschritt.
A.G.: …ja, ausschließlich im Laufschritt. Mindestens damals, im Jahr 1986.
N.K.: Aha.
A.G.: So. So stürzten wir in ein Gebäude. Liefen die Gänge entlang. Dabei bemerkte ich, dass alle Fenster mit Mattenüberzug oder einem ähnlichen Stoff verhängt waren. Manche Fensterscheiben waren zerschlagen. So liefen wir einen Gang entlang, bis wir zu einer Stelle kamen, wo ein Mitarbeiter des Kraftwerks schon auf uns wartete. So. Er erteilte unserem Oberleutnant Grinenko eine Leitungseinlage, erklärte, wo sich Ausgänge befinden, und beschrieb unseren Arbeitsbereich. Er gab mir einen Befehl und ich gab meinerseits den Übrigen den Befehl.
N.K.: Den Übrigen.
A.G.: Zusammen mit diesem Mitarbeiter des Kraftwerks liefen wir davon. Und da wir ursprünglich in den dritten Reaktorblock geholt worden waren, liefen wir nun in Richtung Reaktorblocks 4. Als wir schon vor Ort waren, wurden wir in einen Raum geschickt, der angeblich nicht gefährlich war. Aber Sie verstehen wohl, dass…
N.K.: Na ja, klar.
A.G.: Wir wurden in diesen Raum geholt und beauftragt, dort zu arbeiten. Sie können sich wohl vorstellen, dass ein Reaktorblock von allerlei Versorgungslinien, Mechanismen und Automatik voll ist. Dort gab es eine Spalte, durch den der Reaktorblock 4 schon zu sehen war. Und Sie verstehen wohl, dass die ganze…
N.K.: Aber sicher.
A.G.: Wir mussten also von der Seite alle diese Mechanismen, die unglaublich hohe Strahlungswerte aufwiesen, abbauen. Wir sollten sie alle demontieren und zu den Grabstätten bringen. So. Aber wir durften erst auf Kommando der Messtechniker arbeiten. Sie maßen den Strahlungsgrad auf den Stellen, wo wir zu arbeiten hatten, und teilten uns danach die Strahlungswerte mit. Und die waren immer sehr hoch.
N.K.: Na ja.
A.G.: Etwa ab 200 Röntgen, soweit ich mich erinnern kann…
N.K.: Oho!
A.G.: …und bis über 1000 Röntgen pro Stunde. So. Als ein Messtechniker unserem Oberleutnant die Strahlungswerte mitteilte, ließ jener uns einziehen… Was den Kopf angeht, so sollten wir die Blütenblätter absetzen und Staubschutzmasken sowie Bauhelme und Brillen anziehen. Die Brust wurde durch eine spezielle Schürze aus einer Blei-Gummi-Mischung geschützt. Vielleicht wurde auch Leder dazugegeben, damit die Schütze weich ist… Aber das weiß ich nicht genau. Allerdings war es eine Blei-Gummi-Mischung.
N.K.: Blei?
A.G.: Ja. Es war also eine Schürze aus einer Blei-Gummi-Mischung. Sie wurde wie eine normale Schürze angezogen, schütze vorne das Weiche und reichte hinten bis zu Gesäßbacken. Sie können sich aber doch vorstellen, dass alle oben genannten Stellen bei großen Männern nicht bedeckt werden konnten. Natürlich waren die meisten mittelgroß… Also, die Schürze schützte wie schon gesagt die Weiche und die Gesäßbacken, die Seiten blieben aber nicht bedeckt…
N.K.: Also ganz offen.
A.G.: Arme und Beine waren unbedeckt. Es halfen jedem zwei Personen die Schürze anziehen. Ich möchte Ihnen ein Foto dazu zeigen, damit Sie davon eine Vorstellung bekommen. So zogen wir uns an
N.K.: Fotografierten Sie es?
A.G.: Auf diesem Foto ziehen wir uns an und gehen auf das gefährliche Objekt.
N.K.: Klasse.
A.G.: Hier sehen Sie, dass der Mensch eine Brille, eine Staubschutzmaske und eine Schürze anhatte. So ist es viel anschaulicher.
N.K.: Tja, toll.
A.G.: So wurde es seitlich gebunden, und nun durfte man auf das Objekt gehen. Es wurde auf Pfeifsignal gearbeitet, und eigentlich nahm die Arbeit nur einige Minuten in Anspruch. Denn wenn der Messtechniker sagte, die Strahlungswerte seien sehr hoch, hieß es, dass jeder von uns nur ein paar Minuten hatte. Waren die Strahlungswerte zu hoch, verbrachten wir dort noch weniger Zeit.
N.K.: Und arbeiteten also noch weniger und schneller.
A.G.: Genau. Natürlich konnte man nicht arbeiten, wenn… Ürigens registrieten der Kommandant und ich als sein Gehilfe diejenigen, die eingesetzt wurden. Damit jemand…
N.K.: …nicht zu oft eingesetzt wird?
A.G.: …nicht einige Einsätze hintereinander hat, verstehen Sie? Damit denjenigen, die eingesetzt wurden, eine Möglichkeit gewährt wurde, sich vom Einsatz zu erholen. Dasselbe betraff eigentlich auch mich.
N.K.: Das finde ich fair.
A.G.: Denn ich musste mich genauso anziehen. Und ich war dort siebenmal eingesetzt.
N.K.: Und wie packten Sie damit? Wurden Ihnen Werkzeuge zur Verfügung gestellt?
A.G.: Die Werkzeuge fanden wir, wenn wir auf das Objekt kamen. Da lag ein riesiger Schraubenschlüssel.
N.K.: Aha.
A.G.: Ein riesiger, ein solider Schlüssel. Und damit musste man Schraubenmütter und Bolzen abschrauben. Die gaben nicht immer nach, und so musste man sich manchmal ordentlich abschwitzen, bis die losgeschraubt wurden. Und das, obwohl man über nur einige Minuten verfügte. Plötzlich kam ein Pfeifsignal, und man musste den Schraubenschlüssel fallen lassen und davon laufen.
N.K.: In diesem Fall ließ man alles wie es war?
A.G.: Ja. Oder wenn etwas geschoben oder getragen hatte, musste man es nach dem Pfeifsignal so lassen, wie es war und in den angeblich sicheren Raum zurücklaufen. Die Schutzkleidung wurde abgesetzt und dem Nächsten übergeben.
N.K.: Und so lief der Nächste hin?
A.G.: Ja, so lief der Nächste hin. So dauerte es, bis der ganze Zug oder die ganze Abteilung, die eingesetzt wurde, die Teufels Küche hinter sich hatte. Diejenigen, die schon mit ihrer Arbeit fertig waren, warteten im Raum. Als der letzte mit der Arbeit fertig war, kam das Kommando „Im Laufschritt – Marsch!“ und wir liefen zu den Messtechnikern.
N.K.: Damit Sie Ihre Strahlungsbelastung messen?
A.G.: Sie maßen uns und unsere Ausrüstung. Natürlich wies das alles sehr hohe Strahlungswerte auf. Wir zogen die Schutzkleidung und die Ausrüstung aus, warfen die in spezielle Container und gingen ins Dampfbad.
N.K.: Aha.
A.G.: So. Das Dampfbad war ein unentbehrliches Attribut. Wir wuschen uns und zogen neue Uniformen an. Und dann liefen wir zu den Wagen. So.
N.K.: Und dann wurden Sie mit den Wagen dorthin gebracht, wo Sie stationiert waren?
A.G.: Wir stiegen in die Wagen ein und fuhren in unsere Einheit zurück. Unterwegs hielten wir bei einer Wasch- und Entseuchungsstelle, wo alle Fahrzeuge, die von der Zone kamen, saniert werden mussten. Dabei wurden sie von einem Messtechniker gemessen. Waren die Strahlungswerte zu hoch, ging das Fahrzeug zur Wasch- und Entseuchungsstelle. Dabei wurde die Fahrzeuge meistens mit kaltem Wasser gewaschen, seltner – mit Schaum…
N.K.: Wurden sie mit fließendem Wasser gewaschen?
A.G.: Ja, mit fließendem Wasser wurden Staub und Kot abgewaschen. So.
N.K.: Ach so, na toll!
A.G.: Übrigens können Sie darüber hier lesen …
N.K.: Aha, sehr interessant.
A.G.: Das können Sie gerne behalten.
N.K.: Danke, großartige Fotos.
A.G.: Ja, und das müssen Sie in meiner Gegenwart gelesen haben.
N.K.: Ok, mache ich.
A.G.: In meiner Gegenwart.
N.K.: OK.
A.G.: Und dann werden Sie mir sagen, wie Sie es finden.
N.K.: Abgemacht.
A.G.: So. Nach einer Wäsche konnte es damals noch eine geben. Natürlich wurde das Fahrzeug auch vor Ort geprüft, aber während es durch die Zone fuhr, gab es ringsum Staub.
N.K.: Und so pappte der Staub sowieso an.
A.G.: In der 30-km-Zone gab es doch überall Radioaktivität. So kamen wir zu einer anderen Wasch- und Entseuchungsstelle, dort sagte man, das Fahrzeug sei stark radioaktiv belastet. Und so wurde es erneut eingeseift und gewaschen. Erst danach ging es in die Einheit. Am Usch begrüßten uns wieder die Milizisten. Ehrlich gesagt war der erste Einsatz für die Jungs und mich am schwierigsten. Wir kamen alle erschöpft zurück. Die ganze Kompanie fiel vor Erschöpfung beinahe tot hin. Manche erbrachen manche hatten Durchfall (für die unanständige Einzelheit bitte ich um Enschuldigung!)…
N.K.: Ich nehme an, es war vor allem psychologisch schwierig.
A.G.: Alle hatten furchtbare Kopfschmerzen. So. Unsere Einheit hatte ihre eigene Sanitätsstelle. Die Krankenschwester gab uns Pulver, vielleicht, war das ein Medikament gegen Kopfschmerzen. Niemand ging an dem Tag wegen der Übelkeit in die Kantine. Mit Mühe und Not hielten wir alle durch und gingen dann am Abend auf nüchternen Magen schlafen. Denn am Morgen mussten wir wieder in den Reaktor.
N.K.: Aha. Wurde es dann ein bissichen leichter? Ich meine, psychologisch leichter…
A.G.: Erstens bemühten wir uns, auf den krankhaften Zustand nicht zu achten. Wir waren doch Militärangehörige. Die Freiwilligen konnten sagen: „Mir reicht’s, ich gehe nach Hause“, wir aber nicht. Wir hatten doch unsere Soldatenpflicht bis zum Ende zu erfüllen, wir hatten doch den Eid abgelegt. Und übrigens gab es keine Drückebergerei, keine Prügeleien, keine Zechtouren. Stellen Sie sich vor: 1986, der Reaktor pufft weiter, emmitiert allerlei abscheuchliches Zeug… Bis zum 14. Dezember 1986, bis er bedeckt wurde, war er aktiv.
N.K.: Aha.
A.G.: Es war ziemlich kompliziert und durchaus gefährlich, sich innerhalb der 30-km-Zone zu bewegen und insbesondere sich dort in der Nähe des Explosionsherdes aufzuhalten. Viele Jungs hielten nicht durch und landeten mit hohen Strahlungsdosen in Kyjiwer und Moskauer Kliniken. Während ich da drüben war, wurden fünf Feuerwehrwagen, mit denen ich als Kommandant einer Gefechtsbesatzung fuhr, fünf Personalkraftwagen, fünf Tankwagen zur Grabstätte geschickt.
N.K.: Weil sie stark radioaktiv belastet waren.
A.G.: Genau. Wir fuhren damit, können Sie es sich vorstellen?
N.K.: Du meine Güte…
A.G.: Aber niemand trug diese Dosen in unsere Personalakten ein. Es wurde stattdessen immer eine Dosis von 1,61 Röntgen pro Stunde eingetragen. Und so musste man eine hohe Strahlungsdosis gespeichert haben. Paradoxerweise strebten viele Jungs trotz der Gefahr (Sie stellen sich wohl vor, wie die Radioaktivität den Körper zerfrisst, wenn sie darin gerät) ins Kraftwerk. Das klingt natürlich wild. Doch es erwies sich, dass je schneller man die höchst zulässige Strahlungsdosis abbekam…
N.K.: … desto schnller ging man nach Hause.
A.G.: Desto schneller und eher ging man nach Hause.
N.K.: Mein Gott, ein echtes Paradox. Klingt aber entsetzlich.
A.G.: Tja. Und es war undenkbar. Sehen Sie, die Menschen wagten es, ohne lange zu zögern, denn sie wollten da drüben keinen Tag, keine Stunde, keine Minute länger bleiben. Das war eben das Paradox.
N.K.: Wie schrecklich.
A.G.: Und wenn ich zurückblicke… Begreife ich viele Sachen. Warum es ausgerechnet so war… Warum wir außer unserer Uniform keine spezielle Schutzkleidung sowie keine Schutzmittel bekamen …
N.K.: Na ja.
A.G.: …und so weiter und so fort. Diese Fragen sind sehr kompliziert und lassen in die Sache immer tiefer eintauchen. Und das war eben der Grund, warum es in unserer Einheit nie Prügeleien, Sauf- wie Zechtouren gab. Wenn die Menschen nach dem Einsatz total erschöpft in die Einheit kamen, warfen sie sich auf ihre Pritschen und hatten auf nichts mehr Lust. Auf absolut nichts. Ich spreche natürlich von denjenigen, die ständig im Kraftwerk eingesetzt wurden.
N.K.: Na ja.
A.G.: Wir wurden doch ständig im Kraftwerk eingesetzt. Im Jahr 1986 wurde ich 17mal im Explosionsherd, also in Reaktorblöcken 3 und 4, eingesetzt. Und wenn ich als Gefechtsbesatzungskommandant mit PKWs und Tankwagen dorthin ging. Ja, bei der Feuerwehr gibt es auch den Begriff „Gefechtsbesatzung“, weil… Was ist eigentlich eine Gefechtsbesatzung? Was ist eigentlich ein Brand? Das ist beinahe ein Krieg.
N.K.: Na ja.
A.G.: Ein Feuer kann dich umbringen, wenn du darin gerätst. Deshalb sind die Feuerwehrleute daran gewöhnt, einander zu helfen. Noch beim Pflichwehrdienst wurde uns die Teamarbeit beigebracht, deshalb gab es keine Kameradenschinderei in den Ein…
N.K.: Einheiten.
A.G.: …in den Untereinheiten. Verstehen Sie? Angenommen Sie müssen das Feuer löschen und machen dabei etwas falsch. Und da gibt Ihr Kamerad Ihnen ruhig einen Schubs und lässt sie ins Feuer fallen… oder Sie fallen irgendwo oder es stürzen Balken und Stöcke auf Sie – und er lässt Sie im Stich, statt aus der Gefahr zu verhelfen.
N.K.: Deshalb…
A.G.: Deshalb hatten wir keine Kameradenschinderei. Unser Team war gut eingespielt. Und dieses Moment wurde bei uns groß geschrieben, denn es gab viele, die bei Feuerwachen und Feuerbataillons dienten. Also, wie gesagt, hatte man auf sonstige Aktivitäten keine Lust. Hin und wieder höre ich, dass man da drüben Samogon[14] trank. Bei uns aber gab es so was nicht. Das kann ich Ihnen schwören.
N.K.: Na klar.
A.G.: Sehen Sie, wenn man bloß daran denkt, wie viele Röntgen Strahlungsdosis wir während des ganzen Arbeitstages bekamen… Am Ende wussten wir nicht einmal, wo uns der Kopf steht und wollten nur …
N.K.: Na ja, von welchem Samogon konnte die Rede sein.
A.G.: So was wie Samogon, Zechtouren, Prügelein kam einfach nicht in die Tüte. Man warf sich aufs Bett und wollte sich bloß ausruhen. Wenn man bei der Sanitärstelle ein Medikament bekam, das Symptome mindern half, sollte man schon dankbar sein, verstehen Sie?
N.K.: Gab es während des Aufenthaltes da drüben vielleicht ganz besondere Situationen, die sich Ihnen ins Gedächtnis einprägten oder sie erstaunten?
A.G.: Es wäre der menschliche Faktor zu erwähnen. Wie ich schon gesagt habe, wurden viele Fahrzeuge für untauglich erklärt und zu Grabstätten geschickt. Doch die Jungs, die diese Fahrzeuge fuhren, nutzten die Möglichkeit aus, ein paar Ersatzteile von diesen Fahrzeugen abzuschrauben.
N.K.: Mein Gott.
A.G.: So. Aber natürlich war es strengstens verboten. Vielleicht waren sich die Menschen noch nicht bewusst, wie schädlich das, was sie taten, sein konnte. So versteckten sie die geklauten Ersatzteile unter ihren Betten. Natürlich war das höchst gefährlich und wirkte sich später auf ihre Gesundheit aus. Und allem Anschein nach bekamen sie hohe Strahlungsdosen, weil sie diese Dinge unter ihren Betten aufbewahrten. Dann wurden sie…
N.K.: Wie entsetzlich!
A.G.: Dann wurden sie nach Kyjiw geholt. Sie waren schon nicht mehr…
N.K.: Wie konnte einem so was einfallen?
A.G.: Tja, solche leichtsinnigen Menschen gab es da drüben auch.
N.K.: Was Sie nicht sagen.
A.G.: Sie meinten, ein eisernes Ersatzteil sei gar nicht schädlich. Und da irrten sie sich. So was sollten sie keineswegs tun. Ich erinnere mich an einen unangenehmen Zwischenfall. Den habe ich zwar schon beschrieben, kann aber jetzt darüber erzählen. Die Sache ist die, dass es nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch andere Dienste wie Köche, Friseure und so weiter gab. Wir hatten ein Kino, es gab immer einen Verkaufswagen. So. Ein Koch wollte sich was ancashen (was bedeutet das? Etwas stehlen?), was ihm nicht gehörte, war aber auf frischer Tat von den Angehörigen der Spezialformation ertappt und musste vor Gericht. Ich nehme an, er bereute das, was er getan hatte, denn somit verlor er seinen Liquidator-Status. Solche unangenehmen Zwischenfälle gab es leider auch, die geschahen aber nur selten.
N.K.: Aha.
A.G.: Einige Einzelfälle waren übrigens mit Briefen vom Zuhause verbunden. Gutmenschen, Missgönner oder manchmal auch selbst die Ehefrauen schrieben den Jungs, ihre Liebesverhältnis sei beendet.
N.K.: Oh...
A.G.: … dass die Ehe geschieden worden sei. Stellen Sie sich vor, in was für einen Zustand solche Briefe ihre Empfänger versetzten. Aber die gab es nicht viel. Vielleicht verstanden die Menshen nicht alles, man war doch sehr karg informiert. Manche meinten, dass sich die Radioaktivität auf alle Menschen auswirkt, die eine Strahlungsdosis bekamen… Erinnern Sie sich… (A.G. lacht) Na ja, Sie erinnern sich wohl nicht.
N.K.: Nein.
A.G.: Sie wissen vielleicht, dass es eine gewisse Zeit lang in den Massenmedien viele Artikel über Mutanten gab, und es wurde außerdem sehr viel und sehr ausführlich darüber geschrieben, dass die ganze Menschheit bald aussterben werde. So. Dieses Unglück war Gott sei Dank nicht passiert… aber dass es nicht zum Aussterben kam, ist eigentlich den Liquidatoren zu verdanken. Sie brachten mit ihrem eigenen Leibe die Verseuchung ins Stocken. Während der Zeit, da es heftige Emissionen gab, wuschen sie, reinigten sie, räumten sie auf, begruben sie, bewarfen sie den Reaktor. Auch Flugzeug- und Hubschrauberpiloten sind nicht zu vergessen, die Sand herunterwarfen… Hätten sie es nicht gemacht, hätte man den Reaktor dem Selbstlauf überlassen, so wäre nach einer bestimmten Zeitspanne auch der Reaktorblock 3 explodiert.
N.K.: Gott bewahre...
A.G.: Denn Sie alle sind in einer Kette verbunden. Reaktorblock 3 war von Reaktorblock 4 durch eine Wand getrennt. Ein bisschen weiter entfernt liegen Reaktorblock 2 und 1. Wissen Sie wohl, was eine Kettenreaktion ist?.. Allein die Explosion von Reaktorblock 3 würde die Ukraine, die Sowjetunion, Europa vom Antlitz der Erde auslöschen.
N.K.: Unumstritten.
A.G.: Die Länder Europas sowie Weißrussland und Russland spürten den Widerhall von der Explosion eines einzigen Reaktors; die radioaktive Wolke ging in Richtung Dänemark, Finnland und Norwegen… Denken Sie nur… Als wir vor kurzem in derselben Stelle eine deutsche Delegation empfingen, so sagten uns die Abgeordneten des Bundestages, die der Delegation auch angehörten, dass man auch in Deutschland 1986 die Konsequenzen der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl spürte… Was wäre gewesen, wenn es keine Liquidatoren gegeben hätte und alles im Stich gelassen worden wäre?
N.K.: Aber sicher. Wie entsetzlich…
A.G.: Die Folgen wären undenkbar. Apropos Reaktorblock 3 …
N.K.: Sie waren dort…
A.G.: Im Juni oder Juli (genauer kann ich es nicht sagen) brannten dort die Kabel auf. Und wieder kamen die Feuerwehrleute zu Hilfe… Und zwar die Helden der Sowjetunion wie Prawik und Titenok… Haben Sie diese Namen gehört?
N.K.: Ja.
A.G.: Tischura wurde der Grad „Held der Ukraine“ zuerkannt… Also den Jungs, die da drüben als Feuerwehrleute eingesetzt wurden, gebührt der Respekt. Es ist doch allgemein bekannt …
N.K.: Nein…
A.G.: …dass Feuerwehrleute eingesetzt wurden und dass sie Feuer löschten. Es ist doch das Schlimmste und das Schrecklichste, ein Feuer zu löschen. Und zwar ein radioaktives Feuer. Bei einer undenkbar hohen Strahlungsbelastung.
N.K.: Mein Gott, kann ich mir nicht vorstellen, wie sie damit packten...
A.G.:. Sie sind schon längst tot, diese Jungs. Sie brannten alle sozusagen ab. Außerdem sind noch 28 Personen zu erwähnen, die innerhalb der ersten paar Minuten von ihren Feuerwachen zum Feuerlöschen kamen. Es war schon ein wenig später, als ein Kabel brannte und das Feuer zu Reaktorblock 3 ging. Stellen Sie sich vor, was gewesen wäre, wenn auch Reaktorblock 3 explodiert wäre?
N.K.: Unbegreifbar.
A.G.: Also, Ukraine gäbe es jetzt längst nicht mehr, hier wären alle wie Fliegen ausgestorben. Eindeutig.
N.K.: Nun sagen Sie bitte, ob Sie, während Sie dort waren… Moment mal, ich schenke jetzt Ihnen ein.
A.G.: Danke.
N.K.: Gab es dort Arbeiten, die ausschließlich den Frauen anvertraut wurden? Also, rein „feminine“ Arbeiten sozusagen? Gab es dagegen Arbeiten, die rein „maskulin“ waren?
A.G.: Na ja, wie etwa unsere Krankenschwester?
N.K.: Ja, zum Beispiel.
A.G.: Also, dann – die Krankenschwester von unserer Sanitärstelle. Es gab einen Arzt, soweit ich mich erinnern kann. Aber wir ersuchten nur selten die ärztliche Hilfe, weil wir, wie schon gesagt, ziemlich jung waren und auf Symptome wie krankhaften Zustand, Kopfschmerzen oder Herzbeschwerden nicht achteten. Es ging mir aber eigentlich nicht immer gut, weil ich, wie schon gesagt, 1985 operiert worden war.
N.K.: Ach ja, Sie hatten doch eine Operation hinter sich, als Sie nach drüben gingen.
A.G.: Mir wurden Gefäße abgetragen. Und nach vielen Jahren erfuhr ich, dass ich mich wegen kranker Gefäße da drüben nicht aufzuhalten brauchte. Und wenn es eine Operation gegeben hatte und diese Gefäße hinausoperiert worden waren, war es mir ohnehin untersagt, da drüben zu sein.
N.K.: Mein Gott.
A.G.: Ich durfte also überhaupt nicht nach drüben. Aber trotzdem ging ich dorthin. Damals war ich jung und gesund, und wie hätte ich meinen Freunden und anderen Menschen in die Augen sehen können, wäre ich nach drüben nicht gegangen.
N.K.: Na ja.
A.G.: Nun stellen Sie sich wohl vor, woran wir damals in erster Linie dachten.
N.K.: Aha. Also, es gab eine Krankenschwester, was durchaus üblich war, und es gab wahrscheinlich auch eine Mitarbeiterin bei der Kantine?
A.G.: Bei der Offizierskantine schon, soweit ich mich erinnern kann. Bei der Kantine für den Personalbestand waren Soldaten tätig. Und in der Offizierskantine gab es, glaube ich, Mitarbeiterinnen, also die Frauen. Und natürlich sind die Frauen zu erwähnen, die beim Dampfbad- und Wäschereikombinat arbeiteten. Sie wuschen die Uniformen, die vielleicht nur gering kontaminiert waren. Es wurde doch nicht nur im Kraftwerk gearbeitet. Es wurde auch in der ersten… Also, der Explosionsherd befand sich in Zone 3. Die 15-km-Zone, die in der Mitte lag, hieß Zone 2. Das Stück Land dazwischen galt als Zone 1. Oder umkehrt: Zone 1, Zone 2 und Zone 3. Der Explosionsherd lag sowieso in Zone 3. Und ich kenne eine Köchin, die bei der Kantine arbeitete… Sie heißt Wera Adrianowna Iwanowa.
N.K.: Aha.
A.G.: Sie arbeitete also unmittelbar in Tschernobyl. Können Sie sich vorstellen, wie es damals war, dort zu arbeiten, wo alles stark kontaminiert war und wo alle Einwohner evakuiert wurden. Aber Frauen wie Wera Adrianowna Iwanowa arbeiteten dort. Später erhielt sie den Liquidator-Status. Genauso war es zu Zeiten des Krieges. Alle, die zu Militäreinheiten während des Krieges kommandiert waren, galten als Kampfteilnehmer. Sie gerieten doch auch unter Bombenangriffen und Beschüsse…
N.K.: Und waren unzählige Male unter Kugelregen.
A.G.: Genau. Deshalb halten wir unsere Frauen (damals waren sie allerdings noch junge Mädchen) für Liquidatorinnen. Insbesondere die Krankenschwester. Es wurden sehr viele Mitarbeiterinnen von Klinik Nr. 20[15] einberufen, sie arbeiteten alle bei den Sanitärstellen. Und die alle dienten bis zum Ende, wofür ihnen der Respekt gebührt. Frauen gab es also.
N.K.: Also es gab da drüben Männer wie Frauen.
A.G.: Tja, ich würde sagen, es gab sogar mehr Frauen als Männer. Während Krankenschwestern wehrpflichtig waren, kamen die Köchinnen und die Wäscherinnen nach drüben als Freiwillige. Deshalb verdienen sie das höchste Lob dieser Welt…
N.K.: Wirklich bewundernswert.
A.G.: …und die höchste Anerkennung. Viele von ihnen sind heute Mitgliederinnen unseres Verbandes, und wir lieben sie und halten sie in Ehren. Das versteht sich doch von selbst. Eine Frau an der Front und eine Frau in Tschernobyl Was bedeutet eine Frau an der Front oder in Tschrnobyl? Dasselbe.
N.K.: Sagen Sie bitte, wie nahm Ihre Familie wahr, dass Sie nach drüben müssen?
A.G.: Also, was die Familie angeht, so hatte sie, seitdem die ersten Einberufungsbefehle kamen, vielleicht etwas Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen, dass ich früher oder später nach Tschernobyl einberufen werde. Es gab aber, wie schon gesagt, in der Gesellschaft gar keine Panik, weil es fast keine Informationen dazu gab, was sich in Tschernobyl ereingnete. Jemand hörte etwas irgendwo mit halbem Ohr… und das wäre es. 1986. Später wurden wir alle schon clever. Doch nicht im Jahr 1986. Außerdem nahmen es viele Familien als einen Moment wahr, da der Familienvater oder umgekehrt die Ehefrau seine oder ihre Soldaten- oder Arbeitspflicht erfüllen gehen musste. Viele wurden nach drüben von ihren Betrieben geschickt. Und es galt als heilige Pflicht eines Patrioten oder eines Wehrpflichtigen.
N.K.: Es gab also keine Panik?
A.G.: Ne, von der Panik war keine Rede. Auch die Familie nahm die ganze Sache ganz ruhig wahr. Außerdem wurde uns im Militärkommissariat zuerst gesagt, wir seien zur Reservistenübung einberufen. Das sagten wir eben unseren Familien: Wir gingen angeblich zur Reservistenübung.
N.K.: Damit Sie keine Angst bekommen?
A.G.: Einigermaßen. Es wurde nichts direkt gesagt. Es wurde ein wenig gemogelt.
N.K.: Damit man sich gewöhnt?
A.G.: Na ja. Es kam der erste Einberufungsbefehl, dann kam der zweite, dann gab es die Ärztekommission mit allerlei medizinischen Untersuchungen…So hatte meine Familie ein bisschen Zeit, sich daran zu erholen, dass ich einberufen werde. Aber ich möchte nochmals sagen, dass man uns sagte, es handle sich bloß um eine Reservistenausbildung.
N.K.: Und wie wurden von Ihren Freunden und ihrer Familie wahrgenommen, als Sie zurückkehrten? Nahm man Sie als Helden wahr?
A.G.: Das ist halt interessant. Und nicht nur von Freunden… Aber davon erzähle ich ein bisschen später
N.K.: Abgemacht.
A.G.: Also, als sich mein Wehr- sowie Wachdienst in der Zone schon seinem Ende näherte, mussten wir zwei Tage „im Hintergrund“ sitzen. Was bedeutete eigentlich „im Hintergrund sitzen“? „Im Hintergrund sitzen“ hieß eigentlich in der Einheit Wirtschaftsarbeiten machen.
N.K.: Aha.
A.G.: So saßen wir „im Hintergrund“. Aber eigentlich saßen wir (im direkten Sinne des Wortes „sitzen“) erst gegen Ende des Wehrdienstes. Sonst sollten wir, während wir „im Hintergrund“ saßen, allerlei Wirtschaftsarbeiten innerhalb der Einheit ausführen: Pritschen und Nachttische reparieren …
N.K.: Na ja, jemand musste doch sowieso das tun.
A.G.: …unsere Kleidung und Zelte reparieren, das Gelände aufräumen. Dann gingen wir zum Lachsteig und schnitten dort schichtsweise die Rasendecke ab, brachte sie in die Einheit und schmückten damit die Wege, damit die Einheit schön und gepflegt aussah.
N.K.: Wie nett.
A.G.: Außerdem gab es den Küchendienst. In der Nähe des Waldes gab es ein Gemüselager. Wir mussten die Höhlen in den Wänden füllen. Die Wände waren nämlich hohl, wie mussten also die Höhlen mit Holzspäne füllen.
N.K.: Aha.
A.G.: Damit kein Kondenswasser entsteht und das Gemüse wegen der Feuchtigkeit nicht verfault. Das waren also die Wirtschaftsarbeiten. Was noch? Wir hatten außerdem ab und zu Bereitschaftsdienst am Checkpoint. Dort konnte man alle Fahrzeuge nur nach Spezialpassierscheinen auslassen und so weiter. Dort arbeitete man auch schichtweise, wobei jede Schicht 12 Stunden dauerte. Was unserer Arbeit als Feuerwehrleute angeht… Da unsere Einheit auch als Feuerwache diente, mussten wir auf jeden Alarm reagieren. Kommt ein Alarmsignal, musst du schnell aufstehen und sich auf den Weg nachen, egal ob du schläfst oder wach bist. Es hieß der Bereitschaftsalarm. Und so musste die ganze Gefechtsbesatzung, die Bereitschaftsdienst hatte, zum Feuerlöschen. Wir wurden auch in den Dörfern eingesetzt, die der 30-km-Zone angehörten.
N.K.: Es gab also Brandfälle?
A.G.: Wie bitte?
N.K.: Es gab also ab und zu Brandfälle.
A.G.: Ja, es gab hin und wieder Brandfälle. Damit hatte ich aber keine Erfahrungen. Ich wurde entweder bei Checkpoints, oder im Kraftwerk eingesetzt.
N.K.: Aha.
A.G.: Verstehen Sie? Was die Jungs angeht, die in die Dörfer zum Feuerlöschen gingen… Brandfälle gab es eigentlich nicht so oft wie im Sommer. Im Sommer – schon. Es war doch heiß und es bestand eine ziemlich hohe Brandgefahr. Im Oktober ließ diese Gefahr schon ein wenig nach. Also, beim Bereitschaftsalarm mussten wir zum Feuerlöschen. Bei uns war es also nicht wie in anderen Einheiten, wo man nach den Einsätzen schlief und aß. Neben den Einsätzen musste jeder von uns noch den Bereitschaftsdienst leisten. Somit führten wir eine doppelte Arbeit aus.
N.K.: So.
A.G.: Und zurück zu…
N.K.: …zu Ihren Freunden.
A.G.: Im Anschluss daran, worüber wir zu sprechen anfingen… Ich wurde 17mal im Reaktor eingesetzt. Bei jedem Einsatz arbeitete ich dort, wie schon gesagt. Dazu ging ich mit der Feuerwehr- und Gefechtsbesatzung zum... Dort dekontaminierten wir die Wände des Kraftwerks, die dazugehörigen Räume, die Dächer, indem wir sie aus Wasserschläuchen wuschen. Aber die Wache war schon zu Ende und wir saßen und warteten, bis man uns nach Hause schickt.
N.K.: Aha.
A.G.: Plötzlich wurde uns befohlen, bei der Finanzabteilung vorbeizuschauen. Dort erhielten wir je 70 „hölzerne“ Rubel[16](A.G. lacht). Und ich muss Ihnen sagen, es war gute Kohle. Die damaligen Löhne und Gehälter betrugen 70 bis 120 Rubel, wenn man 120 Rubel Lohn erhielt, war es schon Glück. Als wir das Geld erhielten ließ man uns uns umziehen und gab uns Wattejacken, obwohl es im Prinzip draußen warm war. Haben Sie die vielleicht irgendwo eventuell gesehen? Die sind dünn und reichten bis Hüften. So. Dann stiegen wir in die Wagen ein und fuhren bis Bila Zerkwa nach Charkiw über Kyjiw zurück. Als wir nach Kyjiw kamen und uns Fahrkarten nach Charkiw besorgten, blieb uns genug Zeit, um sich in Kyjiw umzusehen. Und so begaben wir uns natürlich zum Chreschtschatik[17]. Und so gingen wir in einer Kolonne die Straße entlang. So. Und die Miliz… A! Solange wir gingen, kamen ganz unbekannte Kyjiwer angelaufen und sagten „Danke, Jungs“. Das fing noch auf dem Bahnhof an.
N.K.: Oho, was Sie nicht sagen.
A.G.: Dann stiegen wir aus der U-Bahn aus und gingen in einer Kolonne die Straße entlang, genauer gesagt, die Fahrbahn entlang, warum – weiß ich nicht (A.G. lacht).
N.K.: Vielleicht weil Sie in einer Kolonne gingen?
A.G.: Eigentlich war es keine Kolonne mehr… Und die Miliz… Zuerst traten viele Menschen an uns heran: „Danke, Jungs!“ Sie kapierten alle, woher wir kamen und so bedankten sie sich herzlich bei uns. „Spasibo!“[18], „Hlopzi, djakujemo!“[19] Das mir heutzutage durchaus unklaren sprachnlichen Durcheinander gab es damals nicht. Man bedankte sich auf Ukrainisch und auf Russisch, alle verstanden einander. Es trat Jung wie Alt an uns heran und dankte uns. Wir gingen also weiter und begegneten der Miliz: „Guten Tag, Jungs, betreten Sie bitte den Fußsteig, stören Sie den Verkehr bitte nicht“. Und dann fragten Sie uns: „Kommt ihr bestimmt von drüben?“ - „Ja“. – „Danke, Jungs, macht es gut!“ Sie drückten uns die Hände und gingen weiter.
N.K.: Aha.
A.G.: Wir gingen den Fußsteig entlang und kamen schließlich auf den Chreschtschatik. Und solange wir den Chreschtschatik entlang bummelten, vernahmen wir von allen Seiten „Spasibo!“ und „Djakujemo!“. Natürlich war der Chreschtschatik damals nicht so schön und prächtig, wie er heute ist. Nachdem wir ihn besichtigt hatten, beschlossen wir, auf den Bahnhof zurückzukehren und dort im Restaurant zu Mittag zu essen. Auch im Restaurant wurden wir dadurch überrumpelt, wie freundlich uns die dortigen Mitarbeiter und die Besucher behandelten. Als wir das Restaurant betraten und ein paar Tische reservierten, traten die Kellner und die Büfettdame an uns heran. Und jeder holte uns was – Sekt, Kognak… Die Damen brachten Pralinen, Blumen, Obst… Alles geriet gleich auf die Tische. „Danke““, „Djakujemo!“. Für das Mittagessen zahlten wir übrigens keinen einzigen Rubel… Und wenn ich mich an diese Szene erinnere, ist mir…
N.K.: …wohl zumute?
A.G.: Schön zumute. Ich denke dabei daran, wie freundlich uns alle diese Leute behandelten, und verstehe, dass ich mein Leben nicht umsonst aufs Spiel setzte. Stellen Sie sich das vor. Wenn sich jemand bei dir für deine Arbeit bedankt, ist es meinetwegen am wichtigsten.
N.K.: Genau.
A.G.: Ja. So. Dann reisten wir alle ab. Manche verreisten früher, manche – später. Und ich ging ruhig nach Hause.
N.K.: Lief in Charkiw niemand hinterher?
A.G.: Zum Unterschied von Kyjiw, tat es niemand.
N.K.: Alles war in Charkiw also anders?
A.G.: Ganz anders. Eitel Wonne, Ruhe und Eintracht. Verstehen Sie, was ich meine?
N.K.: Niemand sagte Ihnen was, stimmt?
A.G.: Nur einer fragte mich einmal, ob ich von drüben komme. Sonst gab es zum Unterschied von Kyjiw keine Euphorie.
N.K.: Vielleicht war es darauf hinzuzuführen, dass Kyjiw ganz in der Nähe lag?
A.G.: Sicherlich. Kyjiw wäre beinahe…
N.K.: Vielleicht ließ sich alles dadurch erklären. Charkiw aber…
A.G.: Na ja. Kyjiw lag doch nur 70 km vom Explosionsherd entfernt. Stellen Sie es sich bloß vor… Natürlich standen dort die Menschen unter großem Stress. Es war doch Oktober, der Reaktor wurde erst im Dezember gestoppt. Deshalb wurden wir vielleicht so behandelt. Ich weiß nicht, wie man uns heute behandeln würde, wenn man erführe, dass wir da drüben waren. Damals aber tanzte man tatsächlich um uns herum.
N.K.: Und Ihre Umgebung – nahm sie Sie nach Tschernobyl anders wahr?
A.G.: Wissen Sie, da kommen wir zum traurigen Teil der Geschichte. Als unsere Dienstzeit im Kernkraftwerk Tschernobyl aus war und wir nach Hause gehen durften, dachten wir, das Schwierigste sei schon vorbei und nun werde alles so sein, wie es vorher war. Und da irrten wir uns, denn Tschernobyl spaltete unsere Leben auf Vorher und Nachher. Ich habe schon erzählt, was wir alles da drüben nach den Einsätzen erleben mussten. Da drüben ging es mir ab und zu so-so la-la. Als ich aber zurückkehrte, bekam ich Ende Oktober oder Anfang November ernste gesundheitliche Probleme. Ich stellte mich beim Bezirkskrankenhaus vor, mir wurde aber nur eine ambulante Behandlung angeboten. Man wusste nämlich noch nicht, was man mit denen, die von drüben kamen, anfangen sollte. Während der ambulanten Behandlung verschlechterte sich mein Gesundheitszustad. So wurde ich stationär aufgenommen. Auch bei der stationären Behandlung konnten die Ärzte mir nicht helfen, waren total ratlos. Dann wurde ich im November ins Institut für medizinische Radiologie geschickt.
N.K.: Aha.
A.G.: Es liegt an Puschkinskaja Straße, dieses Institut. Ich landete dort im November, und somit fing für mich - genauso wie für viele andere „Tschernobyler“, die da drüben waren, und zwar für Liquidatoren, - eine ganze Epopöe (das passt nicht hier.). Es kamen schwierige Zeiten, würde ich sagen. Innerhalb des Zeitraums von 1986 bis hin zum vorigen Jahr, hatte ich meiner eigenen Berechnung nach insgesamt 73 stationäre Aufnahmen und Sanatoriumbehandlungen hier in Charkiw, in Kyjiw, Slawjanogorsk und Odessa. Und jedes Mal innerhalb des Zeitraums von 1986 bis 2012 ging ich zur Behandlung in der Hoffnung, es wäre das letzte Mal.
N.K.: Sie hätten also nach drüben lieber nicht gehen sollen.
A.G.: Da haben Sie Recht. Und nun meldet sich das alles. Und was ich noch sagen will… Ich hatte für die Zeit nach Tschernobyl eine Menge Pläne. Sie haben doch nach den Plänen gefragt. Aber alle Pläne waren zerstört. Ab November 1986 (Oktober 1986 zählt nicht) steckte ich ein halbes Jahr lang in Krankenhäusern und Sanatorien. Dazu gehörte das Bezirkskrankenhaus, das Institut für medizinische Radiologie, das Intitut für Hygiene und Arbeit und das Sanatorim „Raj-Jelenowka“. Am 9. Mai 1987 bekam ich einen Krampf und wurde aus dem Sanatorium gleich ins Institut für Neurologie geholt. Dort blockierte man den Krampf und empfahl mir, die Behindertengruppe 3 zuerkennen zu lassen, ohne den Zusammenhang[20] zu bestätigen. Das bedeutete aber einen jämmerlichen Lohn.
N.K.: Na ja.
А.Г: Beim damaligen Durchschnittslohn von 90 bis 110 Rubel musste ich nun die Hälfte dieser Summen erhalten. Ich hatte aber Familie, deshalb arbeitete ich bis 1990, ohne auf meine Krankheiten zu achten, bis ich einmal auf dem Arbeitsplatz ohnmächtig wurde und meine Zehe brach. Dann ging ich schon zum medizinisch-arbeisrechtlichen Gutachterausschuss. Dort wurde mir gesagt: „Wirst du uns etwa verschiffen, Mann? Du bist doch nicht im Stand zu arbeiten, wir erkennen dir die Behindertengruppe 2 zu“. So. Was mir noch einfällt… 1986 glich das Institut für medizinische Radiologie, wo ich behandelt wurde, einem Militärspital aus den Zeiten des Großen Vaterländischen Krieges. Es gab dort viele Jungs, die da drüben im Mai, Juni und Juli eingesetzt worden waren, ab und zu änderte sich ihre Zahl, und es kamen Neue. Im Krankenzimmer gab es keinen Platz mehr. Überall standen die Betten.
N.K.: Wie viele Menschen waren im Krankenzimmer?
A.G.: Es waren dort etwa 12 Patienten und sogar mehr unterbracht. In den Gängen gab es auch Betten und Kufentische. Dem ärzlichen und nichtärztlichen Personal gebührt aber der Respekt. Die alle behandelten uns sehr freundlich. Marina Sergeewna Dynnik, die, wenn ich mich nicht irre, die Abteilung für Strahlungspathologie leitete, war zu uns besonders gut. Später aber machte die Regierung der Sowjetunion die Diagnose „Strahlenkrankheit“, die manchen Jungs nach Tschernobyl gestellt worden war, rückständig. Man begriff wohl, dass immer mehr Menschen erkranken und Behinderte werden …
N.K.: Wie zu Zeiten des Krieges?
A.G.: Genau. Irgendwann fiel ihnen ein, die Diagnose „Strahlenkrankheit“ aufzuheben. Und sie taten es. Die Strahlungsdosen, die wir bekamen, senkten wir auf das Vielfache. […]
N.K.: Und wie beeinflusste diese Havarie ihrer Meinung nach die ukrainische Gesellschaft? Was wäre gewesen, wenn es keine Havarie gegeben hätte?
A.G.: Was ich eben sagen will… Was meine Nachbarn angeht, so wurden wir gut behandelt, solange ich berufstätig war. Ich arbeitete damals bei der sekundären Schwarzmetallurgie. Der Direktor und seine Stellertrter gaben sich Mühe, uns materiell zu unterstützen. Es wurden mir ständig fünf oder zehn Rubel Beistandsgeld ausgezahlt. Wir wurden ans Festnetz angeschlossen. Denjenigen, deren Wohnverhältnisse schwierig waren, wurden neue Wohnungen gewährt. Das war alles lobenswert. So war es bei uns. Auch bei Fabriken und Industriebetrieben wurden die „Tschernobyler“ gut behandelt. Also im Großen und Ganzen nahm man uns in der Anfangszeit sehr positv wahr.
N.K.: Ernst und freundlich.
A.G.: Später wurden wir bloß positiv wahrgenommen. Und jetzt… Sie verstehen wohl: Die Zeiten sind schwierig, es gibt jetzt Krisen, alle wünschen sich eine gesicherte Existenz. Und wenn man heute hört, dass die „Tschernobyler“ ein ziemlich hohes Ruhegehalt beziehen, nimmt man uns schon eher negativ wahr. Alle müssen sich aber der Tatsache bewusst sein, dass es ohne uns Liquidatoren heutzutage kein Land gäbe …
[…]
A.G.: Man ging nach Kyjiw, man streikte neben dem Gosprom und so weiter und so fort. Verstehen Sie?
N.K.: Ja.
A.G.: Also, vom ruhigen Leben können wir jetzt nur träumen. Verstehen Sie? Was die Gesellschaft angeht, so nahm sie uns, wie schon gesagt, am Anfang sehr positiv wahr, später änderte sich ihre Einstellung wegen der Krise und schwieriger Lebensverhältnisse.
[…]
A.G.: Die Afghaner und die Tschernobyler sind sich noch deswegen einig, weil es ziemlich viele „Mischungen“ gab. Was war eigentlich eine „Mischung“? Wenn ein Mensch, der den Krieg in Afghanistan hinter sich hatte, später nach Tschernobyl einberufen wurde. Denken Sie nur, was für ein Explosionsgemisch es war.
N.K.: Furchtbar.
A.G.: Zuerst muss man Afghanistan…
N.K.: … und dann noch Tschernobyl erleben.
A.G.: …verwundet, körperlich und geistig verletzt zu sein und dann noch nach Tschernobyl einberufen zu werden. Diese Menschen genießen bei uns einen doppelten Respekt. In unserem Verband – sei es auf Rayon-, Oblast- und Staatsebene – sind sie doppelt verehrt. Sie verstehen wohl, dass diese Menschen…
N.K.: …. zwei Höllen hinter sich haben.
A.G.: Genau. Zwei Höllen. Erinnern Sie sich daran, was wir forderten, als wir die Werchowna Rada bestürmten. Das zeigt doch, dass wir gemeinsame Interessen haben. Wir beanspruchten nichts Überflüssiges, sondern das, was uns nach dem Gesetz zusteht.
N.K.: Das, was Sie verdient haben.
A.G.: Genau. Wir wollen bloß das behalten, was wir verdient haben. Denn unsere Privilegien werden stets verringert. Das Gesetz wird stets eigeschränkt. Es gibt jetzt so viele Nachtragsgesetze, dass es vom ursprünglichen Gesetz nicht besonders viel übrig bleibt. Deshalb müssen wir stets unsere Augen offen halten.
N.K.: Ist auch wahr.
[1] Strohhut, den früher ukrainische Bauern gern trugen
[2] Traditionelles besticktes Trachthemd.
[3] Das heutige Wolgograd (Russische Föderation). 1943 fand bei Stalingrad eine der bekanntesten und der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges statt.
[4] Hohe sowjetische auf der Brust zu tragende Kriegsauszeichnung in Form eines fünfzackigen Sterns
[5] Theaterstück des sowjetischen Autors Konstantin Trenjow. 1970 wurde „Ljubow Jarowaja“ verfilmt.
[6] Viele Militärangehörige waren im Zeitraum von 1979 bis 1989 beim militärischen Eingreifen der Sowjetunion in Afganistan eingesetzt.
[7] (rus.) So wurden zu sowjetischer Zeit umgangssprachlich Wagen für den Transport Inhaftierter genannt. Wortwörtlich übersetzt bedeutet Woronok eine Stadtschwalbe.
[8] So wird in der Stadt Charkiw umgangssprachlich Kozarskaja Straße genannt.
[9] Kleinstadt in der Oblast Charkiw
[10] Der berühmte ukrainische und russische Künstler Ilja Repin war in Tschuhujiw geboren.
[11] Marke eines sowjetischen Transportflugzeugs, das durch das wissenschaftlich-technische Komplex für Luftfahrt O.K. Antonow hergestellt wurde.
[12] URAL steht für die Marke sowjetischer Nutzfahrzeuge, die der Kraftwagenbetrieb „Uralski Awtomobilny Sawod“ hergestellte.
[13] (rus.) Kanonenofen, ein gusseiserner zylinderförmiger Ofen
[14] Ukrainischer hausgebrannter Schnaps
[15] Die Charkiwer Studentenklinik, die in Charkiw auch als Klinik Nummer 20 bekannt ist, betreut Studenten, Forschungs- und Lehrkräfte aller Universitäten und Hochschulen der Stadt.
[16] Rubel, die man in fremde Währung nicht wechseln konnte, wurden „hölzern“ genannt.
[17] Zentrale Straße von Kyjiw, eine der schönsten und bekanntesten Straßen der ukrainischen Hauptstadt
[18] (rus.) Danke
[19] (ukr.) Danke, Jungs!
[20] Die Verbindung zwischen der Erkrankung und der Strahlungsdosis, die der durch diese Erkrankung betroffene Mensch in Tschernobyl bekam.