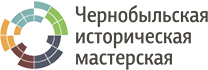Mykola
Mykola
- Liquidator
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Wohnort:
Die Zeit, in der Tschernobyl-Zone :
Mykola Fesenko (im Folgenden M.F.): Ich wurde am 6. August 1961 in Pisky Radkiwski geboren. Mein Vater stammt aus dem Kursker Oblast (Rylsker Rajon), aus dem Dorf Mychajliwka. 1932 ist seine Familie nach Iwaniwka (Dworitschanskyj Rajon) umgesiedelt worden. Und meine Mutter ist von hier. Sie heißt Marija Ilarioniwna Bojko. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg schwer verwundet worden.
Die Schule habe ich in Pisky Radkiwski beendet. Wir waren alle damals sehr romantisch veranlagt und wollten unsere Kräfte erproben: „Ob ich in der Lage bin, das zu schaffen?“ Und nachdem ich 1978 mit der Schule fertig war, überredete mich mein Cousin zum Studium in Saratow, wo er am Polytechnischen Institut studierte. Besonders gefiel es mir, dass es an diesem Institut einen Lehrstuhl für militärische Ausbildung gab. Ich hatte immer davon geträumt, beim Militär zu sein. Ich meinte, ich müsste weit weg von Zuhause leben, das fand ich romantisch, denn die Fahrt von meinem Dorf bis Saratow dauerte einen Tag.
Les Isajew (weiter L.I.): War Ihnen das Charkiwer Polytechnische Institut nicht recht?
M.F.: Ich weiß nicht warum, aber das Charkiwer Polytechnische Institut war mir nicht recht, das Institut in Saratow hingegen war genau das Richtige für mich. Wir alle waren damals so. Ich habe das Studium abgeschlossen und die Qualifikation des Maschineningenieurs erworben. Nach der militärischen Ausbildung habe ich eine zweimonatige Umschulung gemacht und wurde zum Leutnant befördert. Damals wurde man nach dem Studium in der Regel nicht einberufen, dennoch wurden von 150 Menschen meines Jahrgangs 25 einberufen. Zu dem Zeitpunkt, als per Los entschieden wurde, wer zur Armee gehen sollte, war ich krank. Mein Freund sagte mir: „Ich habe statt deiner gezogen. Du hattest Glück und musst nicht zur Armee gehen. Glückwünsch!“
Die ganze Nacht konnte ich nicht einschlafen. Ich habe mich schlaflos im Bett herumgewälzt. Ich dachte: „Wieso? Ich komme doch aus einem Dorf, warum gehe ich nicht zur Armee? Was werden die Mädels dazu sagen?“ Damals haben nur Kranke keinen Wehrdienst geleistet – das dachte ich. Mein Bruder hatte auch seinen Wehrdienst abgeleistet, trotz Plattfüße und Blutdruck. Mein Vater war der Meinung, mein Bruder müsse das tun.
Dort – ich meine in Saratow – ging ich zur Musterungsbehörde und erklärte, dass ich zum Militär einberufen werden wollte. „Wozu brauchst du das? –„Ich muss es tun. Ich stamme aus einem Dorf, ich muss es tun!“ – „Na, wir schicken dich in den Militärbezirk Transbaikalien.“ – Auch wenn es in den Fernosten geht, meinetwegen“.
Ich wurde also einberufen. Für zwei Jahre. Ich habe im Leningrader Militärbezirk meinen Wehrdienst leisten müssen. Ich wurde zum Assistenten des technischen Leiters ernannt worden. Ich verbrachte den ganzen Tag im Dienstzimmer und übersetze verschiedene Unterlagen. Ich protokollierte: „Der Kolben wurde abgegeben. Der Kolben wurde abgeholt. Die Gelenkwelle wurde gebracht. Die Gelenkwelle wurde weggenommen“. Mein Lohn betrug 120 Rubel für den Leutnantsrang und 120 für den Dienst. Das war nichts für mich. So ist meine Natur. So war ich eben schon als Schüler. Ich habe ziemlich gute Noten bekommen, aber ich war schon immer neugierig. Überall wollte ich mitmachen.
Und damals war es genauso. Zu dieser Zeit wurde die Stellvertreterstelle des Kompaniechefs für Schulmaschinen frei. Ich ging zum Bataillonskommandeur und bat ihn mich einzustellen. „Geht es dir hier nicht gut? Das ist doch das beste Amt, da ist nicht viel zu tun“. – „Nee, ich will mit Menschen arbeiten“. Also wurde ich versetzt. Erst dann machte mir mein Wehrdienst Spaß. Man musste um 6 Uhr aufstehen, Gymnastik… vorwärts, Marsch… Ich verbrachte die ganze Zeit mit anderen Soldaten, so wurde mein Wehrdienst spannend. Es machte mir Spaß.
Ich bekam das Angebot, in der Armee zu bleiben. Sie wollten mich lange nicht gehen lassen. In der Armee diente ich einen Monat länger als nötig. Ich wusste, dass die Gesundheit meines Vaters viel schlechter geworden war. Meine Mutter hatte Diabetes bekommen. Ich war der jüngste Sohn und musste mich um meine Eltern kümmern. Als Oberleutnant bin ich aus der Armee zurückgekommen.
Am 1. Oktober 1985 kam ich also zurück, und am 10. Oktober begann ich schon, an meiner Schule Werken zu unterrichten. Doch das Schuljahr beendete ich nicht als Lehrer, da ich nach Tschernobyl geschickt wurde. Meine zwei Onkel waren Militärleute, Oberste, und ich habe immer davon geträumt, auch beim Militär zu sein. Praktisch gesehen bin ich sowieso ein Militär geworden, sozusagen. Ich habe noch ein bisschen in Solona – einmal pro Woche, nämlich am Dienstag – gearbeitet. Dort gab es keinen Werklehrer, so bin ich auch dorthin gefahren.
Am 4. Mai wurde Ostern gefeiert. Ich war in Solona und musste nach Pisky zu Fuß gehen. Es gelangt mir nicht, per Anhalter zu fahren. Es regnete. Es wurde kalt. Ich ging zu Fuß in die Schule. Ich dachte, dass ich die Werkstatt in Ordnung bringen müsse. Ich sah einen UAZ (Automarke) vorbeifahren. Aus dem Wagen stieg Militärkommissar Budnik: „Heißen Sie so und so? – „Ja.“ – „Bereite dich vor, du wirst einberufen“. – „Aber ich bin doch erst vor sieben Monaten zurückgekommen. Werde ich wieder zum Wehrdienst einberufen?“ – „Ja. Du wirst aber ab dem nächsten Studienjahr als Lehrer für Militärerziehung in der Schule in Pisky tätig sein. Jetzt fährst du für drei Tage zur Umschulung für Zivilverteidigung.“ – „Aber ich muss wenigstens meine Sachen packen…“ – „Deine Eltern wissen schon Bescheid. Deine Sachen sind schon eingepackt.“ – „Ich muss aber nach Hause.“ – „Ich nehme dich mit.“
Er nahm mich mit. Als ich zu Hause angekommen war, war meine Tasche schon gepackt. Meine Mutter gab mir Buchweizenbrei zum Mitnehmen mit. Mein Vater war etwas aufgeregt. Vielleicht hat er das Unglück vorausgeahnt. Er war schon alt. Die Splitter in seinem Körper, die ihm im Krieg zugefügt worden waren, bereiteten ihm Schmerzen. Beim Abschied sagte ich: „Ich fahre wahrscheinlich nach Tschernobyl.“ Ich habe das einfach so gesagt. Aber ich habe gleich danach hinzugefügt: „Macht euch aber keine Sorgen. Es dauert ja nur drei Tage. Der Militärkommissar hat ja gesagt, dass ich als Lehrer für Militärerziehung tätig sein werde und zur Umschulung fahre“.
Ich kam in der Musterungsbehörde an. Es war 14 Uhr. Da sah ich drei Leute. Ich kannte sie nicht. Das waren Stefan Fedotowytsch Kaljuga aus Pidwysokyj, Wasyl Mychajlowytsch Scherstjuk und Oleksandr Hryhorowytsch Kaljuga (die beiden letzteren aus Gorohowatka). Ich war der Jüngste im Bataillon. Man nannte mich „Malysch“ (Kleiner). Rein zufällig war ich bei ihnen gelandet.
Ich kannte sie bis dahin nicht, denn ich hatte an der Schule gearbeitet. Den ganzen Tag verbrachte ich mit Kindern in der Schule, und zu Hause warteten auf mich Kühe, Schweine und Gänse. So sah mein Alltag aus. Wir gaben unsere Wehrpässe ab und bekamen Mobilmachungsverordnungen. Um 4 Uhr holte uns ein PAS (Automarke) ab.
L.I.: Gab es eine medizinische Untersuchung?
M.F.: Natürlich nicht! Wir stiegen in den Bus und fuhren zu viert nach Sawyntsi, ins Kulturhaus. Es war so riesig! Wir bekamen unsere Militäruniform. Wir nähten Schulterklappen, Kragenspiegel, Kragen an.
L.I.: Hat jemand etwas gesagt?
M.F.: Niemand!
L.I.: Gab es dort noch viele Leute?
M.F.: Ja, sehr viele! Und es wurden immer mehr gebracht. Und damals war gerade Osterzeit, deswegen gab es so viele Betrunkene. Etwa drei Menschen wurden nach Hause geschickt, denn sie waren besoffen und verhielten sich komisch. Sie rannten hin und her und machten das Licht aus. Wir bekamen auch Gasmasken.
L.I.: Waren diese Leute aus verschiedenen Regionen? Gab es dort nur Offiziere?
M.F.: Aus verschiedenen Regionen. Nicht nur Offiziere, sondern auch Soldaten. Eine Oma im weißen Arztkittel – sie sah nach einer Krankenschwester aus – kam zu mir und sagte: „Na, junger Mann, zieh dein Unterhemd aus!“. Was ich dann auch tat. Ich fragte erstaunt: „Was suchen Sie?“ – „Pickel.“ Das war die Untersuchung. Als wir bereits in Iwankiw waren, sah ich Wasyl Mychajlowytsch irgendwelche Pillen nehmen. „Koletschka (Diminutiv von Nikolaj), (er war viel älter als ich) ich leide an Diabetes“. Die Krankheit schritt fort, deshalb er musste ständig seine Pillen einnehmen.
Ich war erst 25 Jahre alt. Damals setzte ich mich mit diesen Fragen nicht auseinander. Ich hatte Hummeln im Hintern, wie man so sagt. Ich dachte: „Wie kann das sein? So ein kranker Mann soll nach Tschernobyl?!?“ Und er hatte einen veranwortungsvollen Posten innegehalten, denn er war Parteichef, Stellvertreter der Leitung der Kollektivwirtschaft. Stefan Fedotowytsch hütete zu Ostern Kühe zu Hause, als er abgeholt wurde. Er war Berufssoldat und wurde entlassen. Ende der 1950er Jahre, zu Chruschtschows Regierungszeiten, gab es Massenkündigungen.
Mein Vater gab mir einen guten Rat mit auf den Weg: „Du musst alles aufschreiben mein Sohn“. Er war sehr klug, und ich hörte immer auf ihn. Und als ich im September 1986, drei Monate nach der Tschernobyl-Katastrophe, im Trainingslager für Zivilverteidigung in Donezk war, machte ich mir unmittelbar Notizen. Und bis jetzt habe ich sie aufbewahrt. In Sawyntsi wachte ich am nächsten Tag früh auf, weil ich sehr fror. Wir schliefen im Kulturhaus auf der Bühne.
L.I.: Hat man euch Matratzen gegeben?
M.F.: Von wegen! Stiefel unter den Kopf, Jacke – das warʼs. Wehrdienst! Wenn man auf einer Seite liegt, dann rutscht man hinunter. Deswegen lag ich zwischen zwei Sesseln, so rutsche ich nicht hinunter. Wir waren etwa dreihundert Menschen.
Verpflegung war auch da. In die Kantine mussten wir etwa 2-3 km zu Fuß gehen. Die Stiefel waren neu. Bis man die Kantine erreichte, taten uns die Füße weh. Wir wurden ganz gut verpflegt.
Am 6. Mai begann man die Sachen aufzuladen, und wir ahnten, dass wir irgendwohin verschickt wurden. Man sagte uns zwar nichts, aber es gab schon Gerüchte, dass in der 30-km-Zone von Tschernobyl alles verbrannt und nichts Lebendiges geblieben sei. Es gebe dort nichts Lebendiges usw. Man erzählte verschiedene Horrorgeschichten, dass es dort Mutanten gebe. Vieles wurde erzählt. Man sagte oft: „Mein Bruder, mein Onkel und meine Tante wohnen dort. Und sie haben alles mit eigenen Augen gesehen.“
In meinem Tagebuch schrieb ich: „Am 6. Mai begriff ich, dass ich nicht für drei Tage hierhergekommen bin. Und ich bleibe wohl kaum hier, sondern ich werde irgendwohin weitergebracht.“
Ich wurde zum Oberfeuerwehrmann in der Feuerwehr-Kompanie ernannt. Aus meinem Tagebuch: „Wir lernten, wie ein Feuerwehrwagen aufgebaut ist“ Ich war damit nicht vertraut, denn in unserer Armee gab es nur Lkws wie KAMAS und SIL. „Diesen Tag schneite es, und es waren etwa 2 Grad unter Null. Dieses Jahr gefroren die Kartoffeln in Sawyntsi. 7. Mai. Wir setzten das Beladen fort. Wir beluden die Wägen mit Zelten, Kanonen-Ofen, Feldflaschen, Thermosflaschen, Tassen, Löffeln. Feldküchen wurden an die Wagen angehängt.“ Das ganze Zeug bekamen wir aus einem Lagerhaus von einem Militärstützpunkt, der früher errichtet worden war. „Oberst … berichtete, dass wir morgen nach Tschernobyl fahren sollen, um die Folgen der Havarie einzudämmen. Damals wurde uns im Kulturhaus ein Film über die Atomexplosion gezeigt. Und dann teilte man uns offiziell mit, wohin wir fahren sollten.“ Es hatte den Anschein, dass man uns psychisch darauf vorbereitete. In den Zelten wurden wir in Gasmasken ausgegast. Man gab Gas in die Zelte. Ich erinnerte mich gut an die Nummer meiner Gasmaske, und es war kein Problem für mich.
Am 8. Mai, am Nachmittag, standen schon die Ikarus-Busse im Stadion, und um 16:00 fuhren wir los nach Tschernobyl. In unserer Fahrzeugkolonne gab es ca. 120 Wagen: Einige UAS – vorne, „Ikarus“-Busse (sechs oder acht), Feuerwehrautos, Drehleitern, PNS-110-Feuerlösch-Wagen haben Feldküchen geschleppt. Alle diese Wägen wurden verschiedenen Unternehmen zu militärischen Zwecken abgenommen bzw. waren irgendwo aufbewahrt worden. Unser Feuerwehrbataillon machte sich auf den Weg. „Unterwegs waren wir bis 24:00, dann machten wir Halt. Wir bekamen kalte Verpflegung: Buchweizenbrei und Reis in Dosen, Wurstaufstrich, Brot und Zucker. Wir schliefen in den Bussen.“ Bevor wir zum Essen gingen, hatten wir Feuer gemacht und unsere Dosen mit Brei dorthin geworfen, um das Fett schmelzen zu lassen. Doch es war wirklich schrecklich, in den Bussen zu schlafen, denn alle schnarchten.
„Am frühen Morgen machten wir uns wieder auf den Weg. Ich gratulierte allen zum 9. Mai. Um etwa 18 Uhr waren wir in Kiew. Zwei Stunden schlenderten wir durch die Stadt.“ Charkiwer Polizisten begleiteten uns durch dem Territorium des Charkiwer Gebiets, dann waren es Poltawaer Polizisten, und danach – die Kiewer. „In Iwankow kamen wir um etwa 21 Uhr an. Unterwegs gab es an den Randstreifen verschiedene Schilder: „Abfahrt st verboten!“ und auch „Betreten und Nutzen des Waldes sind zeitweise verboten!“ Zuerst war es komisch, diese Schilder zu sehen. Nachdem wir angekommen waren, begannen wir die Zelte aufzustellen. Die Bettzeit begann um 1 Uhr. Ich schlief sofort ein, und ich wachte morgens vor Kälte auf.“ Wir standen auf der Wiese, unweit vom Fluss Teteriw (150 km). Der Nebel verzog sich, und wir wachten alle nass auf. Unsere Matratzen waren nass, in den Zelten war alles auch nass. Wir hatten ja unsere Matratzen einfach auf's Gras geworfen, und unsere Zelte für 40 Menschen waren noch nicht umgegraben. Am Morgen begannen wir unsere Matratzen zu trocknen.
„In der Nähe war das Tschernihiwer Bataillon. Sie sagten uns, dass die Strahlung hier etwas höher sei – etwa 0,12 Milliröntgen pro Stunde. Den ganzen Tag richteten wir alles ein: Wir stellten alle Zelte und die Küche auf, gruben alles um. Wir machten uns Tee, der für uns wie hausgemachter Borschtsch schmeckte, so hungrig waren wir. Vom 11. bis zum 20. Mai hatten wir alles eingerichtet. Am Fluss Teteriw wurde unser Training durchgeführt. Wir lernten das Wasser mit der PNS-110-Feuerlöschstation zu abzuleiten. Alle wollten arbeiten, denn uns wurde gesagt, dass bis zu 70 Prozent des Bataillons die Strahlungsdosis von 20 Röntgen bekämen, blieben wir hier und führen nicht nach Hause“. Aber niemand teilte uns das offiziell mit. Es waren nur Gerüchte.
„Wir waren hier, denn man sagte, dass wir Reservesoldaten waren. Wir wurden 'beruhigt', indem man uns sagte, dass wenn der vierte Block oder die anderen brennen würden, würden wir den Brand löschen fahren. Die erste Gruppe verließ am 16. Mai den Ort, und am 18. Mai fuhren bereits alle 58 Menschen weg, denn sie hatten schon eine zu hohe Strahlungsdosis abbekommen. An ihrer Stelle kam eine neue Gruppe an. Wie immer hielt man am Abend eine Bataillonsversammlung ab, wo man 5fünf Offiziere zur Inspektion aufforderte, und zwar für den Dienst in der Nähe des Atomkraftwerks, für die Überwachung der Stadt Prypjat. Ich wollte dorthin fahren, aber man ließ mich nicht fahren. Man sagte, dass ich noch zu jung sei. Ich bat meinen Bataillonskommandeur lange darum, dass er mich zum AKW schickte, denn ich hatte die ganze Zeit Dienst im Bataillon. Wäre ich nur damals so klug wie heute gewesen! Ich war jung und dumm. Der Bataillonskommandeur schickte mich zum Teufel. Ich schrieb im Brief an meine Eltern: „Ich bin hier der Jüngste.“.Beim nächsten Mal sagte ich meinem Bataillonsführer wieder: „Wenn Kaluga Stepan Fedotowytsch fährt, dann fahre ich auch mit.“ „Meine Güte! Wenn du willst, dann fahr schon!“ So stiegen wir am 21. Mai um 10 Uhr zu fünft in einen UAS ein und fuhren zum AKW. Die anderen waren zwischen 50 und 55 Jahre alt. Sie waren bereits alt und hatten Kinder, die ungefähr so alt wie ich waren.
„Wir kamen in Salissja (3 km von Tschernobyl) an. Wir wohnten in der Salissjaer Schule. Was fiel mir auf? Alle Hefte und Bücher lagen verlassen da. Es herrschte Arbeitsatmosphäre – kurz gesagt. Es gab aber keine Leute.“ Und ich hatte in der Schule gearbeitet, das war mein Thema.
„In erster Linie trugen wir alle Bänke aus den Klassenzimmern heraus. Wir wohnten im Klassenzimmer der Klasse 3b.“ Die Schule war groß. Mir gefiel die große Sporthalle. Sie war mit der Sporthalle in Pisky nicht zu vergleichen. Ich dachte: „Hätten wir bloß eine solche Sporthalle!“ Ich hatte immer gern Sport getrieben. Und leider gab es nie ausreichend Platz dafür. „Hier gab es paradiesische Bedingungen. Wir schliefen in Betten. Hier gab es Bettwäsche, doch es gab keine Kissen. Wir nutzten unsere Jacken und Rücksäcke. Kurz gesagt, es gefiel mir, ungeachtet dessen, dass die Verstrahlung hier viel stärker und gefährlicher für die Gesundheit war. Daran dachte ich gar nicht.“
Salissja lag schon in der Sperrzone. Als wir dorthin fuhren, wurden wir am Milizposten angehalten und erinnert: „Leute, vergesst die Tabletten nicht!“ Die waren aus dem AI-2-Verbandskasten, darin befand sich Strahlenschutzmittel Nr. 1 und Nr. 2, Syretten hatte man herausgenommen, denn das war ein stark betäubendes Schmerzmittel, damit man es also nicht einnehmen konnte. Das war ein Antischockmittel, das man nur bei der Schockwelle (Druckwelle) nutzte, man konnte sich selbst eine Spritze geben, um heftigen Schmerz aushalten zu können. Manche legten in diesen AI-2-Verbandskasten auch eine Zigarettenschachtel „Prima“.
Im Verbandskasten gab es sechs Pillen. Wenn man in die Sperrzone einfuhr, musste man sechs Tabletten einnehmen und in den Deckel eine dreiprozentige Jodlösung gießen. Die musste man auch nehmen, sie hatte einen seltsamen Beigeschmack. Wahrscheinlich sollte das die Schilddrüse schützen. Und wenn wir die Sperrzone verließen, sagte man: „Leute, vergesst eure Tabletten nicht!“
Im Zimmer des Schuldirektors richteten wir unseren Stab ein und bereiteten noch ein paar Räume für neue Gruppen. Das schafften wir schnell. Und 120 Leute wurden dort einquartiert und bekamen bestimmte Pflichten. Ich war für den Haushalt verantwortlich. Und Stepan Fedotowytsch Kaluga wurde zum Stabschef ernannt. Wir wurden zum Wehrdienst einberufen und dann dem Ministerium für innere Angelegenheiten überantwortet. Da war der Teufel los! Niemand wusste, was man machen sollte und wer uns entlassen sollte. Bis zum 7. Juni waren wir da. Außerdem wurde ich zum Vertreter des Besatzungskommandeurs ernannt. Wir hatten fünf Feuerwehrautos zur Verfügung. „Am 23. Mai wurden wir vom Alarm geweckt. Kapitän Borys Morgun teilte uns mit, dass die Kabel im dritten Block brannten. Und das hätte eine Explosion des Reaktors verursachen können. Unsere Gruppe arbeitete im Einklang. Aber ich hatte Angst, bis ich ins Auto stieg. Wir fuhren zur Feuerwehrstation in Tschernobyl. Dort öffneten wir alle Kisten und zogen L-1–Schutzanzüge an. Wir hatten keine Angst mehr. Uns war da alles egal. Erschrocken war ich, als wir in der Reihe standen, und unser Kapitän aufgeregt (seine Gasmaske hatte er nicht auf) und sagte: „Leute, jetzt ist es aus mit uns!“ Außer dem L-1 Anzughatten wir noch Strümpfe aus Zellophan angezogen. Sie sollten uns vor radioaktivem Staub schützen. In Wirklichkeit aber half es kaum. Sie wirkten eher psychologisch. Wir sind in die Autos gestiegen und weggefahren. „Auf dem halbem Weg sollten wir wieder zurück. Warum, wusste ich nicht. Als wir den Stab erreichten, mussten wir wieder zurück zum AKW. Dort habe ich zum ersten Mal den zerstörten Reaktor gesehen. Bei der Einfahrt gab es viel Staub.“
Wir betraten das Dienstgebäude (Verwaltungs- und Sozialgebäude Nr. 1), auf dem geschrieben stand: „Das W. I.-Lenin-Atomkraftwerk von Tschernobyl arbeitet für den Kommunismus!“ Und ich dachte: „Was hat das mit Kommunismus zu tun?“ Und weiter: „Es wäre besser, dieses Schild zu entfernen.“
Mykola Jedyment (weiter M.Je.): Mir ist dieses Schild auch aufgefallen. Als ich noch neben dem AKW stand, dachte ich: „So musste der Kommunismus hier sein.“ Es war nicht nur spöttisch, sondern einigermaßen provokativ für diese Zeit. Im Mai konnte man dieses Schild sehen. Und ich war dort schon im Herbst, und dieses Schild war noch da.
M.F.: Links gab es Kreuzbarrieren, und hier gab es große Fenster und breite Fensterbretter. Wir standen da und wussten nicht, was wir machen sollten. Wir setzten uns aufs Fensterbrett. Wer weiß, wie lange wir dort gesessen haben. Plötzlich sahen wir einen Dosimetristen (Fachleute mit Messgeräten) laufen: „Meine Güte! Was macht ihr! Wohin habt ihr euch gesetzt? Da ist alles stark verstrahlt!“ Und woher sollten wir das alles wissen? Wir traten zurück und setzten uns anderswo.
L.I.: Hatten Sie eine Schutzausrüstung?
M.F.: Wir nahmen nur Gasmasken mit. Wir zogen nichts an.
M.Je.: Ihr habt radioaktiven Staub eingeatmet. Ihr hättet Atemschutz-Masken tregen müssen.
L.I.: Und warum sagen Sie, dass es dort Staub gab?
M.F.: Um das Kraftwerk herum gab es dicken Staub. Damals war es sehr trocken. Hunderte von Wägen fuhren hin und zurück und wirbelten den Staub auf. Er war so dick wie zwei Finger. Und obwohl er mit Wasser begossen wurde, wurde er sofort wieder trocken. Am Eingang gab es große Tröge mit roter Flüssigkeit. Es muss Jod gewesen sein. „Ein Mann erschien und sagte: 'Geht nun zum Mittagessen. Der Brand ist schon gelöscht.' Ich denke, dass wir damals Glück hatten.“ Wir gingen nicht dorthin. Das machte eine andere Gruppe. Lange durften wir die Kantine nicht betreten, denn unsere Stiefel waren staubig. Schließlich fanden wir irgendwo eine Pfütze und wuschen unsere Stiefel. Wir betraten die Kantine. „Wir aßen sehr schnell, weil es schon 15:30 Uhr war, und wir waren sehr hungrig. Wir aßen Borschtsch. Zum ersten Mal in Tschernobyl. Dann aßen wir Buchweizenbrei und tranken Kompott (Getränk aus Früchten).“ Erstmals nach langer Zeit waren wir satt. Alles schmeckte wirklich gut. Ich war nie ein Feinschmecker gewesen, aber die Qualität vor Lebensmittel dort war wirklich schlecht. Kellner in Gasmasken sammelten das Geschirr und die Reste in Plastiktüten ein. Und ich fragte zuvor: „Und wo gehört das Geschirr hin? – Wieso? In die Endlagerung!“ Das Geschirr war aus Aluminium.
M.Je.: Das Geschirr gehörte also in die Endlagerung – und die Menschen?
M.F.: Wir kehrten zurück. Um 18 Uhr schlief ich ein und wachte um 7 Uhr auf. Ich wurde zum Abendessen geweckt. Aber ich ging nicht zum Abendessen, denn ich schlief wie ein Stein. „Vom 24. bis 30. Mai arbeitete man wie immer“. An diese Zeit habe ich folgende Erinnerungen: Zu viert spielten wir Domino. Ich sah meinen Nachbarn an, seine Gesichtsfarbe veränderte sich: Sie wurde mal gelb, mal grün. Dann sprang er auf und begann zu kotzen. Vielleicht hatte er eine zu hohe Strahlendosis empfangen. Was sollte ich tun? Ich rief nach meinem Freund: „Witjok, lass den Motor laufen! Wir führen nach Iwankow ins Krankenhaus“. Jemand gab mir eine Flasche Wasser, ich riss sie ihm aus den Händen, sprang ins Auto, und wir fuhren eilig davon. Der Verstrahlte fühlte sich immer schlechter. Ich versuchte ihn zu beruhigen und gab ihm ständig Wasser. Ich wusste nicht, was zu tun war. Unterwegs sahen wir einen Krankenwagen, der Schwerkranke nach Kiew transportierte und uns nicht helfen konnte. In Iwankow wurde der Verstrahlungsgrad unseres Freundes im Krankenhaus gemessen. Er war hoch. Er war vor kurzem zurückgekehrt. Man maß mit einem 5A-Strahlungsmessgerät den Verstrahlungsgrad seiner Leber, der Schilddrüse und seiner Beine. Die Ärzte befahlen: „Zieh dich schnell aus!“ Ich bat die Ärzte darum, meinen Verstrahlungsgrad auch zu messen. Und er war genauso hoch!
Im Jahre 1990 wurde es mir während der Musterungskommission gesagt, dass ich dank meiner Kindheit überlebt hätte: Die ganze Zeit war ich barfuß und halbnackt gelaufen, ich machte immer Sport, spielte Fußball und Hockey – dank dieser Abhärtung in meiner Kindheit hatte ich eine stabile Gesundheit.
Wir zogen ihn schnell aus, doch wir hatten keine andere Kleidung dabei. Ich fuhr sehr schnell nach Iwankow. Da kam gerade ein Wagen mit Lebensmitteln an. Alle waren sehr betrunken. Es roch nach Alkohol. Heimlich ging ich ins Zelt, wo es Militärkleidung gab. Ich öffnete die hintere Klappe und nahm Kleidung für meinen kranken Freund und für mich auch. Wir zogen uns um. Dann ist er verschwunden, keine Ahnung, wohin. Niemand hat ihn mehr gesehen.
Am 28. Mai hatte ich Dienst, alles war wie immer. Plötzlich sah ich etwa fünf „Wolga“-Autos kommen. Ich dachte, es sei jemand von der Leitung. Sie verließen ihre Autos, und ich erstattete Meldung. Der Älteste sagt: „Ich sehe, dass du vor kurzem deinen Wehrdienst gemacht hast. Ich will mit dem Personal sprechen.“ Ich wollte befehlen, „Stellt euch bereit!“. Er sagte aber: „Das ist nicht nötig. Ich sage es ihnen einfach so“. Die Mehrheit der Soldaten war über 40 Jahre alt. Sie hatten keine Angst, so begannen sie sich über die schlechte Verpflegung zu beschweren. Wir wurden damals für 93 Kopeken pro Tag verpflegt. Er ging sofort zu unserem Oberst: „Worauf kommt es an?“ Der versprach: „Wir werden entsprechende Maßnahmen treffen!“ Nach dem Besuch dieses Vertreters des Kabinetts der USSR wurden wir mehr als für vier Rubel ernährt. Wir bekamen Schokolade, Kondensmilch, Butter, Käse, Granatapfel- und Traubensaft usw.
Sechs Menschen arbeiteten drei oder vier Tage in „Silhsoptechnika“ in Tschernobyl. Wir packten und reparierten die Feuerwehrschläuche. Mit solchen Schläuchen, die bis zu 2 km lang waren, wurden alle Feuerwehrautos ausgerüstet. Wir reparierten auch technische Ausrüstungen und Einrichtungen aus dem AKW. „Am 30. Mai waren wir mit der Arbeit fertig und kehrten in die Schule zurück, wo wir wohnten. Einige Menschen fühlten sich nicht wohl. Nach dem Abendessen, nachdem wir schon ins Bett gegangen waren, hörten wir um 22:30 Uhr wieder Alarm. Der Wald neben dem Reaktor brannte wieder. Man brauchte zwei Offiziere.“ Damals hatte ich die zulässige Strahlendosis bereits empfangen, deswegen war es mir verboten, hinzufahren. Aber mehrere ältere Offiziere haben gesagt: „Du bist jung, und wir bleiben nicht mehr lange am Leben. Fahr du dorthin!“ Sie waren einfach über die Gefahr erschrocken. Außerdem hatten sie die entsprechende Strahlendosis noch nicht empfangen. Ich ärgerte mich sehr über sie und sagte, was ich meinte: „Ihr seid erwachsen und dazu noch Offiziere. Ihr versteckt euch aber hinter dem Rücken von Anderen wie kleine Kinder.“ Ich habe schnell den Raum verlassen und bin anstatt ihrer gefahren.
„Diese Nacht habe ich die Stadt Prypjat gesehen. Wir sind sehr schnell (etwa 100 km/h) durch die Stadt gefahren. Eine sehr schöne Stadt. Sie war fast leer, keiner war zu sehen. Wir erreichten endlich den Brandort im Wald. Es war ein Bodenfeuer, d.h. nur Nadeln, trockene Zweige, die auf dem Boden lagen, und brennender Torf. Als man durch den Wald ging, versank man im Boden…“
Als wir am 10. Mai Iwankow erreichten, gab es den Bataillonsappell. Während des Appels wurde mein Name nicht aufgerufen. Ich war erstaunt und sagte das auch. Sie fragten nach meinem Namen und antworteten, dass er nicht auf der Liste stünde. Sie fragten noch einmal nach meinem Bezirk. Ich antwortete, dass ich aus dem Boriwskyj-Bezirk war. Sie überprüften die Personalakten und fanden meine nicht, es gab aber die Personalakten von anderen Menschen. Meine Personalakte wurde erst am Abend des nächsten Tages mitgebracht. Es war sehr merkwürdig, warum ich überhaupt dort war. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Alle sahen mich an: „Warum bist du hier? Was machst du hier, Mensch? Bist du verheiratet?“ – „Nein.“ – „Du heilige Scheiße!“, sagten alle.
L.I.: Wurden die Ledigen nicht einberufen?
M.Je.: Nein. Als ich meine Militäreinheit erreicht hatte, gab ich dem Stabschef Major Sajets meine Personalakte. Er fragte: „Was ist das?“ – „Meine Personalakte.“ – „Ich muss dir sagen, dass ich sie nicht brauche. Dafür muss man Verantwortung tragen. Für mich ist wichtig, dass du hier bist. Und zweitens, bist du verheiratet?“ – „Nein.“ – „Du wirst nie heiraten.“ So war es!
M.F.: Ich wurde gefragt: „Wie alt bist du?“ – „25.“
L.I.: Wie können Sie sich das erklären?
M.F.: Ich weiß nicht. Als man in meinen Militärausweis den Rang „Oberst“ schrieb, war der Militärkommissar erstaunt und konnte nicht verstehen, wie man solch einen jungen Mann ohne medizinische Untersuchung überhaupt nach Tschernobyl schicken konnte. Damals habe ich zum ersten Mal einen Waldbrand gesehen, der durch den Wind verstärkt wurde. Womit konnte man ihn löschen? Mit einer Schaufel und einer Axt. Mit der Schaufel zog man einen Graben, damit sich der Brand nicht verbreiten konnte. Und mit der Axt fällte man die unteren Zweige. Der Wald wurde vor Kurzem mit einer Flüssigkeit begossen. Dieser war klebstoffähnlich, aber braun. Alles, was mit dieser Flüssigkeit begossen wurde, trocknete und verschleierte sich, damit sich der radioaktive Staub nicht aufwirbelte. Einige sagten, dass das vielleicht den Brand verursacht hatte. Niemand wusste das genau. Und etwas weiter von uns brannte der Wald oben. Ich dachte mir, dass wir dorthin fahren würden. Dort brannten die Bäume. Man erzählte, dass dort virtuose Feuerwehrleute arbeiteten. Wie Affen sprangen sie von einem Baum zum anderen und löschten den Brand oben.
L.I.: Und gab es keine technische Ausrüstungen und Ausstattungen?
M.F.: Nein! Wie hätte man sie dorthin transportieren können? Bis heute kann ich nicht verstehen, wieso es gebrannt hat. Die Flammen verbreitete sich am Boden wie eine Schlange. Wir liefen, zogen Graben, und die Flammen verbreitete sich immer weiter. Alle hatten Atemschutzmasken auf. Damals empfingen wir sehr eine hohe Strahlendosis. Ich fühlte, dass mein Gesicht brannte. Ich setzte meine Atemschutzmaske auf, berührte das Gesicht mit meinen Fingern. Oh Gott! Und jemand rief: „Deine Fresse ist rot und voller Pickel!“ Ich wechselte meine Atemschutzmaske, später machte ich das noch einige Male. Zu dieser Zeit hörten wir ein entferntes „Puh! Puh!“ Wir maßen die Strahlungsdosis, denn ein Dosimetrist mit einem 5A-Messgerät war auch unter uns. Und die Strahlung stieg blitzschnell. Wir waren unweit des Reaktors. Alle verstanden, dass diese Geräusche unkontrollierte radioaktive Emissionen aus dem vierten Reaktor waren. Der Dosimetrist rief: „Leute, die Strahlung steigt!“
Unsere Feuerwehrautos ließen wir auf der Autobahn. Plötzlich hörten wir jemanden mit dem Lautverstärker rufen: „Kehrt unverzüglich zurück! Schnell!“ Ich fühlte, dass ich mich nicht wohl fühlte, als ob sich mein Magen unter meinem Kinn befände. Mir war übel. Nie habe ich etwas Ähnliches erlebt. Ich fühlte, dass ich in Ohnmacht fiel. Mit Mühe und Not rief ich: „Mir ist ganz elend.“ Es gelang den anderen, mir unter die Arme zu greifen. Ich wurde bewusstlos. Alle rannten durch den Wald zu unseren Wägen. Man zog mich auch dorthin. Als ich mich wiederfand, fühlte ich mich etwas besser. Alle Wägen waren schon weg. Nur unserer war noch da, wegen mir. Plötzlich hörten wir einen Schrei. Das war ein Offizier aus dem benachbartem Bataillon, der in der Nähe den Brand auch gelöscht hatte und sich verlaufen hatte. Wir halfen ihm.
Wir fuhren wieder über Prypjat. Wir maßen mit dem Gerät – die Strahlendosis war sehr hoch. Ich rief dem Fahrer zu: „Witjok, gib Gas!“ In Prypjat wurde unser Auto angehalten und gewaschen. Der Wasserdruck war so stark, dass Wasserspritzen in den Wagen durchdrangen. Dann gab es noch eine Deaktivierungsstelle. Dort wurde die Strahlungsdosis gemessen, und man wusch den Wagen noch einmal. Es war 5 Uhr. Wir mussten uns waschen und umziehen, doch es gab kein warmes Wasser. Dort gab es drei Zelte: Im ersten musste man sich ausziehen, im zweiten duschte man sich, und im dritten bekam man Kleidung. Das Wasser wurde zuerst in einem besonderen Wagen aufgewärmt und danach in die Zelte weitergegeben. Das Wasser war knapp. Was sollte man machen? Wir fuhren nach Salissja. Ich wollte meine Eltern anrufen. Ein Telefonist verband mich mit ihnen. Ich hörte die Stimme meiner Mutter: „Mein Sohn, bist du es?“ – „Ja“. Wir hatten eine Kuh, deshalb mussten meine Eltern früh aufstehen. „Was ist mit deiner Stimme? – Nichts, alles ist in Ordnung“. Und ich hörte sie weinen. Meine Stimme war heiser. Das hatte die radioaktive Strahlung verursacht. Wir hatten uns aber daran gewöhnt. Ich sagte: „Mutti, ich will mit Vater sprechen.“ – „Er hütet die Kuh.“ Ich sprach mit ihm. „Es reicht denn die Mutter weint und ich bin neulich aus dem Dienst zurückgekehrt. Deswegen bin ich etwas erkältet. Es ist kalt und nass. In der Nähe liegt ein Fluss.“ – „Sage ihr, dass alles in Ordnung ist.“ – „Ich habe verstanden.“
Ich lag darnieder, aber ich fühlte mich immer schlechter. Ich stand auf, ging ins Zimmer des Direktors, nahm das Strahlenmessgerät und maß die Strahlendosis. Sie war hoch. Ich weckte einen Feuerwehrmann. Er bespritzte mich mit dem Wasser aus dem Schlauch vor der Schule. Ich seifte mich mehrere Male ein und wusch mich. Ich maß die Strahlungsdosis – ich musste mich nochmal waschen. Ich wusch mich noch einmal. Die Strahlungsdosis sank – ich fühlte mich besser. Ich ging ins Bett und schlief ein. Ich wachte erst um 12 Uhr auf. Man musste den Soldaten das Mittagessen bringen, doch niemand wollte es machen. Ich sagte: „Na, dann fahre ich. Die sind sicher hungrig“. Das war am 2. Juni. Und Wasyl Mychajlowytsch sagte mir wie mein Vater: „Koljetschka, es wäre besser für dich, dich etwas zu erholen. Fahr nicht dorthin. Denk an deine Gesundheit. Fahr nicht.“ Ich antwortete: „Wasyl Mychajlowytsch, niemand will fahren. Und man muss den Jungs was zu essen bringen“. Da fühlte ich mich schon viel besser.
Man entnahm mir Blut. Die Ergebnisse der Blutprobe waren nicht besonders gut. Man sagte: „In der Nähe gibt es ein Krankenhaus.“ „Oh nein, dachte ich, ich will nicht ins Krankenhaus.“ Und dann empfahl mir ein Arzt, mehr Schokolade zu essen und Saft zu trinken. Ich folgte seinem Rat. Und einige Tage später war meine Blutprobe viel besser. Es schien, dass Hämoglobin bzw. die Anzahl der Leukozyten stiegen. Als wir am 7. Juni in Charkiw angekommen waren, zogen wir uns ganz aus. Unsere Kleidung wurde gesammelt und abtransportiert. Man nahm Blut ab und schrieb danach: „Eine Strahlungsmesskontrolle wurde durchgeführt. Kontakt zu anderen Menschen ist erlaubt.“ (lacht).
An diesem Tag, dem 7. Juni, fuhr ich nach Hause, und meine Mutter wartete schon vor dem Haus auf mich. Doch sie wusste gar nicht, dass ich zurückkehren würde. Sie muss das intuitiv gespürt haben. Sie fing an zu weinen und kam auf mich zu. Ich sagte: „Mutti, wartest du auf mich? – Aha. – Und woher hast du es gewusst? – Na…“ Ich blieb mehr als einen Monat lang.
Kaluga und ich fuhren nach Salissja, Scherstjuk und Kaluga blieben in Iwankow. Er war Leiter des Verpflegungsdienstes, deswegen fuhr er sehr oft nach Kiew. Das Essen wurde in der Feldküche gekocht. Und wer kochte? Soldaten wie wir. In den naheliegenden Bataillonen sagte man, dass sie sehr gut verpflegt wurden. Sie bekamen saure Sahne, Radieschen, Zwiebeln, Fleisch.
Stefan Fedotowytsch Kaluga war Stabschef. Er soff. Er fuhr ständig hin und her. Aus Weißrussland hatte er selbstgebrautes Bier mitgebracht. Ich rollte Feuerwehrschläuche auf. Er rief: „Koletschka, ich habe Alkohol mitgebracht. Nur eine Flasche ist übrig geblieben. Ich steckte sie hinter dein Kissen.“ Damals trank ich sehr wenig. Und jetzt ist es mir auch egal. „Ich brauche es nicht“. – „Gut! Dann trinke ich sie selbst aus.“ Er soff viel. Das machte er vor der Katastrophe, in Tschernobyl und danach. Aber im Großen und Ganzen war er ein guter Mensch. Und er hat sich um mich gekümmert, mich beschützt. „Sei vorsichtig!“, sagte er mir immer. Er war ein guter Mensch. Oft erzählte er von seiner Tochter. Stefanowytsch starb 1999, und seine Tochter heiratete in Pidwysokyj.
Rein zufällig hat man uns zusammen fotografiert. Er sagte: „Gehen wir, Koletschka, lassen wir uns mal zum Andenken fotografieren“. Wir gingen an einem Fotoatelier vorbei, und plötzlich schlug er es vor. Damals war es mir egal. Hier auf dem Foto sind wir in Iwankiw. Dort waren alle Einwohner geblieben, und das normale Leben ging weiter. Unsere Zelte waren auf der Wiese aufgestellt, und daneben hüteten die Einheimischen ihre Kühe. Jetzt fragt man mich: „Haben Sie Milch getrunken? Haben sie die bei den Menschen dort gekauft?“ Nee, ich trank keine Milch, damals hatten wir kein Geld. Wir verdienten nichts. Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr daran, wie wir Zigaretten auftreiben konnten.
M. Je.: Soldaten verdienten drei Rubel, und Offiziere – fünf Rubel.
M.F.: Wir verdienten kein Geld.
M.Je.: Also bekam es jemand anderes an ihrer statt!
M.J.: Da waren alle Menschen ungefähr im Alter meiner Eltern. Dat erhielt ich den Spitznamen „Malysch“ (Kleiner). Etwas älter als ich war Witja Sastawa aus Isjum, der war nämlich 37.
L.I.: Durften die Lehrer nach Tschernobyl?
M.F.: Niemand fragte uns damals. Wir waren schon daran gewöhnt, auf alle Befehle „Jawohl!“ zu antworten. Ich wusste nicht einmal, wohin ich fahren sollte.
Ich heiratete im folgenden Jahr, 1987. Mein Sohn Wolodymyr kam 1988 zur Welt und meine Tochter Tanja 1991. Tanja hat bis heute Probleme mit ihrer Schilddrüse. Wowa (Kurzname von Wolodymyr) war dreimal im Kinderkrankenhaus für medizinische Radiologie in Tschernobyl, das war in der Nähe vom Lichtspielhaus „Rossija“. Bis zum 18. Lebensjahr bekamen unsere Kinder 3,50 Hrywna als Tschernobyl-Betroffene. Wofür hat man das bezahlt? Das war praktisch nichts. Für dieses Geld konnte man damals nur ein Brot kaufen.
L.I.: Wie haben Sie die Ereignisse in Tschernobyl empfunden?
M.F.: Ich wollte ein Held sein. Ich sage jetzt die Wahrheit. Alle sagten mir (Scherstjuk und mein Bataillonskommandeur): „Junge, was machst du?“ Und was sonst? Ich dachte: „Ich kehre nach Hause zurück, und ich habe den Reaktor nicht gesehen“. Das war nicht möglich. Wir wurden damals so erzogen. So waren wir alle. Wir wollten große Taten vollbringen. Als ich Militärdienst leistete, wäre ich beinahe nach Afghanistan geschickt worden. Neulich hat man mich in die ATO-Zone einberufen. Ich wurde wegen meiner Gesundheit nicht eingesetzt. Am 4. August wurde ich einberufen. Ich ging zur medizinischen Untersuchung, und dort sagte man: „Er hat doch eine zu hohe Strahlendosis empfangen!“ Außerdem hatte ich voriges Jahr fast einen Herzinfarkt. Ich wurde also ausgemustert. Ich kam in die Musterungsbehörde, und dort sagte man mir: „Schade, wir haben schon eine Zuteilung für dich. Du musst nach Baschkirowka, in die Brigade Nr. 92. Dort gibt es schon eine Dienststelle extra für dich“. – „Leute, ich bin nicht schuld, das waren die Ärzte. Sie haben einen Plan und wir müssen ihm folgen“.
Wie wurde ich nach Tschernobyl ohne meine Personalakte geschickt? Vielleicht wurden sie von jemandem bestochen, der nicht nach Tschernobyl fahren wollte, und ich musste anstatt dieses Menschen fahren. Warum war ich im Bataillon, wo fast alle etwa 50 Jahre alt waren, und ich erst 25?
Ich habe noch nicht erzählt, wie das Vieh erschossen wurde, wie ich einen jungen Stier… Da gab es Häuser und auf dem Zaun stand geschrieben „Haus – 20 Röntgen“. Dort wurde geschrieben, wie stark die Verstrahlung war. Man fuhr mit einem Wagen und erschoss Hunde und Katzen. Wir sahen auf dem Hof ein Ferkel. Ein Kalb kam zu uns. Es war sehr erschrocken und sah schwach aus. Ich löste im Eimer etwas Kondensmilch auf und tränkte es, wie ich es gewöhnlich zu Hause gemacht hatte, aus den Händen. Es war sehr schwach. Drei Tage später fuhren wir nach Tschernobyl und ich sagte meinen Freunden: „Guckt mal! Da liegt mein Kalb.“ Wahrscheinlich starb es und lag am Wegrand. Dasselbe geschah mit einem Kätzchen, auf das ich zufällig in der Nähe vom Zelt trat. Zu Hause, wenn ich auf eine Katze zufällig getreten bin, hat diese sehr laut miaut. Und dieses Kätzchen miaute nicht, es war wie betrunken. So waren die Tiere in Salissja. Die Jäger erschossen sie.
Als wir in der Schule wohnten, besprengten wir alle zwei Stunden mit unseren Feuerwehrautos das Dach und den Hof. Das war die sogenannte „Besprengung“. Und alle zwei Stunden machten wir in der Schule eine Feuchtreinigung. Wie konnte man nur die Strahlendosis messen? Wir haben gemessen, aber am Fenster war sie so, und anderswo war sie ganz anders. Draußen war sie auch anders. Wie konnte man nur richtig messen? Sollten wir alles addieren oder Durchschnittswerte berechnen?
Ende Mai bekamen wir DP-24W-Strahlenmessgeräte, die sogenannten „Stifte“. Tatsächlich zeigten sie nichts an. Und manche Leute hatten kleine Strahlenmessgeräte, ich hatte auch eines. Ich bat meine Freunde es zu überprüften, aus Neugier. Sie sagten, dass er 11 000 Röntgen innerhalb von vier Tagen zeigte.
M. Je.: In unserem Bataillon für strahlenchemische Erkundung hatte jede Gruppe Strahlenmessgeräte. Von zehn Menschen hatten mindestens fünf Leute einen Speicher. Man nannte sie „blinde Geräte“, denn sie mussten in ein anderes Gerät gesteckt werden, das die tatsächliche Strahlendosis zeigte. Es scheint mir, dass sie gut funktioniert haben. Eine andere Sache ist, dass diese Ergebnisse nicht immer aufgeschrieben wurden. Ich sage, wie es gewesen ist. Einen solchen Speicher trug ich immer an meinem Stiefel. Die Jungen trugen ihn anderswo. Die Nummer stand auch da. Z. B. wenn ich fünf oder zehn Menschen zum AKW begleitete, gab ich ihnen einen Speicher und schrieb die Nummer neben den Namen auf. Wenn man zurückkehrte, hatten sie schon diese Geräte benutzt. Dann musste man Durchschnittswerte berechnen, und ein Fachmann schrieb die Ergebnisse direkt im Kraftwerk auf, dann unterschrieb er diese Anordnung, und ich übergab sie den Gruppenführern. Sie haben das alles notiert. Neben jeden Namen schrieben sie die Strahlendosis. Dann hielt der General um vier Uhr am Kraftwerk eine Sitzung ab. Dabei waren auch der Bataillonskommandeur, der Divisionskommandeur und andere. Und um 8 Uhr hielt unser Bataillonskommandeur eine Beratung ab. Wir fassten die Ergebnisse zusammen. Zu dieser Zeit wussten wir schon, wer zum AKW fahren durfte. Der Bataillonskommandeur sagte: „Wir brauchen 15 Menschen“. Aber nur acht von den Anwesenden durften hinfahren. Dann sagte er: „Dann fahren acht Menschen aus der ersten Kompanie und sieben – aus den anderen.“ Es gab eine Regel – die Soldaten durften nicht mehr als 20 Röntgen empfangen. Etwas später wurden 22 Röntgen erlaubt, noch später – 24, und dann – schon 25 Röntgen. Am Abend hatte dieser Mensch schon seine Unterlagen bekommen und wir mussten ihn nach Iwankow bringen. Er musste so schnell wie möglich nach Hause geschickt werden. Das war alles, er wurde entlassen!
L.I.: Und was dieses Tagebuch betrifft…?
M.F.: Ich hab՚ schon alles erzählt.
M.Je.: Und ich führte kein Tagebuch. Bei uns in „Silhoptehnika“ war die Verbindung gut und mir wurde erlaubt, zu Hause anzurufen. Der Wächter am Eingang hatte ein Telefon. Die Verbindung dort war besser als in Borowa. So rief ich meine Mutter an. Die Verbindung war gut. Ich telefonierte mit Laschow. Ich war erstaunt, dass die Verbindung so gut war. Dort arbeiteten gute Menschen und sie erlaubten mir immer das Telefon zu benutzen. Und für die Soldaten bekam ich besondere Kärtchen, mit denen Soldaten auch ihre Verwandten anrufen konnten. Aber dafür musste bezahlt werden.
[…]
L.I.: Hatten die Menschen Angst vor den Leuten, die aus Tschernobyl zurückgekehrt waren?
M.F.: Ja. Kaljuga und ich fuhren aus Iwankow nach Kiew. Er musste Lebensmittel kaufen. So gingen wir in ein Kaufhaus. Wir hatten eine Militäruniform an. Und ich hatte einen Dosimeter-Speicher mit. Die lange Schlange wurde immer kürzer. Ich hörte nur: „Sie sind kontaminiert!“ Ich versuchte die Menschen zu beruhigen: „Macht euch keine Sorgen.“ Wir wurden vorbeigelassen, damit wir schneller weggehen konnten.
Eine alte Frau ging aus der Kirche, sah uns und fing an zu weinen: „Meine Armen!“ Sie hatte eine Hostie, sie teilte sie in kleine Stücke und gab sie uns. Sie hat etwas gesagt, ich weiß nicht mehr, was genau, etwas über Gesundheit.
Nach Tschernobyl war ich als Lehrer für Militärerziehung tätig. Im Juli bin ich zurückgekehrt, und seit dem 1. September war ich Lehrer für Militärerziehung bis 2006, und dann war ich Dorfvorsitzender, einige Jahre. Ich hatte es satt. Man muss gesund sein. Man hat viel zu tun. Und ich fühle, dass meine Gesundheit viel schlechter wird. Ich will noch meine Enkel sehen. Ich habe schon eine Enkelin. Sie heißt Warwara. Ich bin schon Opa.