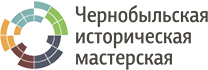Nikolaj

Nikolaj
- Liquidator
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Wohnort:
Berufstätigkeit:
Die Zeit, in der Tschernobyl-Zone :
Aktivitäten in der Tschernobyl-Zone durchgeführt :
Natalja Koslowa (nachfolgend kurz N.K. genannt): Also, heute haben wir den 10. November 2014. Wir sind im Raum des „Verbandes Tschernobyl“ und ich, Natalja Koslowa, interviewe gerade Herrn – stellen Sie sich bitte vor...
Nikolaj Wassiljew (nachfolgend kurz N.W. genannt): Nikolaj Wladimirowitsch Wassiljew, Teilnehmer der Beseitigung der Folgen der Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl. Zugkommandant der ersten Kompanie für chemische Aufklärung bei Bataillon 25.
N.K.: Sehr angenehm. Also, meine erste Frage an Sie, die ist ziemlich umfassend, und die ist eigentlich eine Frage und eine Bitte zugleich. Ich bitte Sie, die Geschichte Ihres Lebens zu erzählen, mindestens das, was Sie selbst für relevant halten. Sie können gerne von Anfang an beginnen: Was wollten Sie als Kind werden, in welche Schule gingen Sie und wo studierten Sie weiter, wie war Ihr Leben danach?
N.W.: Also, ich könnte die Geschichte meines Lebens ziemlich lange schildern, kann sie aber ziemlich kurz erzählen. Ich werde mir jetzt Mühe geben, meine Lebensgeschichte in Hauptumrissen zu beschreiben.
N.K.: Erzählen Sie dann das, was Sie für sich selbst für wesentlich halten.
N.W.: Schulabschluss nach der achten Klasse[1]. Danach wechselte ich in die Charkiwer Berufsschule für Baugewebe. Nach dem Abschluss ging ich dem erworbenen Beruf nach, indem ich bei einem Bauprojektinstitut eine Arbeit aufnahm. Ein Jahr nach Arbeitseinstellung wurde ich zum Pflichtwehrdienst einberufen. Meinen Wehrdienst leistete ich in einer Raketentruppe, wobei ich in Kapustin Jar[2] diente, wo der erste künstliche Satellit abgeschossen worden war. Obwohl es eine Raketentruppe war, gab es bei uns eine kleine Einheit, die über ein eigenes Chemielabor verfügte. Ich wurde dort aufgenommen und betätigte mich dort zuerst als Bedienung und dann als Laborant. Am Ende des Wehrdienstes erwarb ich den doppelten Militärberuf „Aufklärer mit chemischer Spezialisierung“ und „Strahlungsmesstechniker mit chemischer Spezialisierung“. Als ich 1974 von der Armee entlassen wurde und nach Hause zurückkehrte, versuchte ich mich in vielen Bereichen zu verwirklichen. Zum Beispiel arbeitete ich bei der Redaktion von Vetschernij Charkow[3] zuerst als Bote und dann als Journalist. Aber da das Gehalt, das ich dort bekam, zu niedrig war und ich damals schon Familie hatte und einen Sohn bekam, musste ich eine Arbeit suchen, die mir mehr Kohle bringen würde. Lange Zeit arbeitete ich bei Zwetmet, der Niederlassung von Tschermet. Über zehn Jahren war ich dort als Schmelzer bei der Aluminiumabteilung tätig. Davon aus wurde ich nach Tschernobyl, angeblich zur Wehrübung, einberufen. Vorher hatte es natürlich auch Wehrübungen gegeben. Als ich vom Pflichtwehrdienst entlassen wurde, war ich ein einfacher Soldat. Danach machte ich ein paarmal bei verschiedenen Bataillons und Regimentern mit chemischer Spezialisierung Wehrübungen. Und als ich also zur Beseitigung der Folgen der Tschernobyler Katastrophe einberufen wurde, stand ich schon im Rang eines Leutnants.
N.K.: Aha.
N.W.: Und da kommen wir zur wichtigsten Erinnerung, die das Ziel dieses Interviews ist. Also, ich würde gerne noch eine Nuance erwähnen. Als sich die Havarie ereignete, wurden zur Beseitigung ihrer Folgen in erster Linie Profis wie Feuerwehrleute und Chemiker gesucht. Bei der ersten Einberufungswelle holten Vertreter des Militärkommissariats zusammen mit Mitarbeitern von Bezirksverwaltungen für innere Angelegenheiten – kurz gesagt der Miliz – Menschen aus ihren Wohnungen heraus. Ich weiß nicht, wie es bei den Feuerwehrleuten war, doch bei Chemikern war es genau so, denn die gab es in der Sowjetunion nicht so viele. Keine Ahnung, wie es in anderen Städten war, doch in Charkiw kannten wir alle einander gut. Chemiker galt damals nämlich als durchaus seltener Beruf, geschweige denn Militärchemiker. Deshalb wurden die Vertreter dieses Berufes unmittelbar aus ihren Wohnungen rausgeholt, für die Vorbereitungen wurden ihnen nur 15 Minuten gewährt. Entzog sich der Einberufene seiner Wehrpflicht, musste er sowieso in die Verwaltung für innere Angelegenheiten, denn es drohten dafür nach dem Strafgesetzbuch, wenn ich mich nicht irre, 3 bis 5 Jahre Haft. Aber ich hatte Glück: Zusammen mit meinen Freunden nahm ich mir vor, eine Kajaktour zu machen. Wir reisten also gerade am 30. April ab. Von meiner Frau weiß ich, dass diese Leute anderthalb Stunden nach meiner Abreise an unsere Wohnungstür klopften: „Wo ist Ihr Ehemann?“ „Weiß ich nicht“, sagte sie. „Er macht gerade eine Paddeltour den Siwerskyj Donez[4] entlang“. – „Wo genau?“ – „Woher soll ich das wissen? Geht und sucht nach ihm den ganzen Fluss entlang!“. So ein Glück. Ich kehrte erst nach allen Maifeiertagen zurück. Damals war die erste Einberufungswelle schon vorbei.
N.K.: Aha.
N.W.: Deshalb war ich von der zweiten Einberufungswelle betroffen. Am neunten… achten Juni wurde ich einberufen. Aus Charkiw wurden wir nach Kyjiw gebracht, aus Kyjiw – nach Bila Zerkwa. Ich schloss mich Brigade 25 an, die in Orane stationiert war. Das Dorf Orane liegt von der 30-km-Zone ein wenig entfernt, Brigade 25 war an der Grenze zur Zone stationiert, gehörte der Zone aber nicht an.
N.K.: Aha.
N.W.: Bei denjenigen, die sich innerhalb der Zone aufhielten, sollten die Strahlungswerte, eingetragen werden, denen sie ausgesetzt waren. Auch am Rand der Zone gab es unumstritten radioaktive Strahlung, und es mussten die Strahlungswerte in den Militärausweis – genauer gesagt, in ein spezielles Beiblatt eingetragen werden. Auch wenn die Strahlungswerte minimal waren, mussten sie sowieso eingetragen werden. Also, ein wenig von der 30-km-Zone entfernt, wurde Brigade 25 stationiert, in der ich erst am 11. Juni landete. Acht von uns kamen aus Charkiw. Wir verbrachten eine ziemlich lange Zeit in Bila Zerkwa. Ich weiß nicht, worauf das hinzuzuführen wäre, doch in Bila Zerkwa blieben wir gute zwei Tage, obwohl die Offiziere, die wir in unserer ersten Kompanie für chemische Aufklärung ablösten, schon auf gepackten Koffern saßen und auf uns mit solch einer Ungeduld warteten, als ob wir ihnen Gottes Segen bringen sollten. Ich weiß nicht, warum es so war. Wahrscheinlich lag es daran, dass unsere Leitung ihre Tätigkeit nicht koordiniert hatte. Als wir am 11. Juni ankamen, umarmten uns die Jungs, küssten uns ab und erteilten uns wichtige Hinweise.
So ist unsere Militärbruderschaft, Natascha. Sie wiesen uns also hin, wie wir uns benehmen sollten und wie wir in verschiedenen Situationen handeln sollten, weil sie dort schon eine gewisse Zeitspanne gewohnt hatten und bestimmte Beziehungen aufgebaut hatten, insbesondere was Samogon[5] angeht.
N.K.: Ach du meine Güte (N.K. lacht). Das ist doch nicht Ihr ernst oder?
N.W.: Doch. Sie wiesen uns auf die Bauern hin, die uns mit Samogon versorgen konnten. Es herrschte da drüben ein strenges Alkoholverbot (man durfte also kein Alkohol trinken), aber Wodka und Samogon sowie andere starke Alkoholgetränke können im Prinzip vor radioaktiver Strahlung retten. Da ich Fachexperte bin, wusste ich das. So erteilten uns die Jungs…
N.K.: Was Sie nicht sagen! Ich habe immer gedacht, das sei eher ein Mythos.
N.W.: Wie bitte?
N.K.: Ich habe immer gedacht, das sei ein Mythos. Meinen Sie es ernst?
N.W.: Das ist mein blutiger Ernst, denn Radionuklide lassen sich mit Hilfe alkoholhaltiger Getränke aus dem Körper gut ausscheiden. Der Alkohol macht den Körper davon frei. Deshalb gaben uns die Jungs die nötigen Adressen. Wir gingen über den Fluss (es gab in der Gegend einen engen und reinen Fluss, der aber sehr kalt war) nach Orane, wo Bauern wohnten, die uns mit Samogon versorgten. So unterhielten wir uns etwa 15-20 Minuten mit den Jungs, und die machten sich aus dem Staub, um den letzten Wagen nicht zu verpassen, der sie weg von der Gegend bringen würde.
N.K.: Welche Hinweise gab es noch?
N.W.: Wie bitte?
N.K.: Welche Hinweise gab es noch? Was wurde noch erzählt?
N.W.: Na, die Jungs schafften es, uns ziemlich viel zu erzählen. Erstens erzählten die uns über den Kompaniekomandanten, denn der Batja[6] ist doch die wichtigste Person. Auch über den Bataillonskommandanten ließen sie ein paar Worte fallen. Da wir Zugkommandanten waren, mussten wir nämlich als Direktunterstellte mit dem Kompaniechef viel kommunizieren.
N.K.: Aha.
N.W.: Von dieser Verbindung, das heißt von der Zusammenarbeit zwischen dem Kompaniechef und den Zugkommandanten, hing sehr vieles ab. Außer dem Kompaniekommandanten gab es selbstverständlich einen Politruk[7]. Natürlich unterrichteten uns die Jungs, wie man sich bei ihm benehmen sollte. In der Sowjetunion war das politische Grundwissen für Soldaten wie Offiziere sehr wichtig… So was wurde uns erzählt. Da jeder seinen Zug übergeben musste, charakterisierten sie die ihnen unterstellten Soldaten. Ich übernahm beispielsweise Zug Nr. 3. So erzählte mir mein Vorgänger kurz über jeden Soldaten, über den Charakter jedes Soldaten. Ich finde es ganz wichtig, so etwas zu wissen. Denn ein Team ist eben ein Team. Und es ist nicht so einfach, ein Team zu leiten, auch wenn es um eine ganz kleine Gruppe geht. Auch wenn es aus zwei oder drei Personen besteht, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass sie alle natürlich verschieden sind. Trotzdem muss man gemeinsame Aufgaben lösen und es muss dabei…
N.K.: Na ja.
N.W.: …integrativ gearbeitet werden, ohne dass jemand unbeteiligt bleibt. So merkten wir uns alle Informationen, die uns erteilt wurden, nahmen von den Jungs Abschied, und am nächsten Morgen… Also, uns befahl der Kompaniechef dann gleich zu sich, machte sich mit uns bekannt und erteilte uns die Aufgabe für den nächsten Tag. Da uns keine Erholungspause gewährt wurde, blieb der Nachtschlaf die einzige Möglichkeit auszuruhen. Am nächsten Morgen nahm ich drei Soldaten aus meinem Zug, und wir stiegen in den Aufklärungschützenpanzer.
N.K.: Aha.
N.W.: Der Aufklärungsschützenpanzer kommt dem Schützenpanzer gleich, dabei ist der Aufklärungsschützenpanzer von innen durch Bleiplatten verstärkt, die vor radioaktiver Strahlung schützen. Dazu stellte der Aufklärungsschützenpanzer einen modernisierten Panzerwagen dar. Da drinnen gab es ein Strahlungsmessgerät. Und so verlief normalerweise die Strahlungsmessung. Wir hatten eine vorgegebene Route. Als Zugkommandant erhielt ich eine Landkarte, worauf die Stellen markiert waren, die wir zu besuchen hatten. Die Stellen waren mit Fähnchen versehen, damit wir darüber nicht hinweggehen. Die Stellen waren durch den Strahlungsschutzüberwachungsdienst über die ganze Gegend hin verstreut, befanden sich aber abstandsgleich um das Kraftwerk und die verlassene Stadt Prypjat herum sowie innerhalb der Stadt Prypjat.
N.K.: Aha.
N.W.: Wir besuchten also diese Stellen. Dabei hatten wir zwei Schichten. Ich besuchte die Stellen zusammen mit der ersten Schicht von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens befuhr schon die zweite Schicht die Gegend. Jede Schicht war je 12 Stunden im Einsatz.
N.K.: Schön lange!
N.W.: Stimmt. Denn man musste alle Stellen besucht haben. Normalerweise nahm ich zwei oder drei Soldaten mit. Der Fahrer blieb im Aufklärungsschützenpanzer. Zuerst wurde die Strahlung innerhalb des Aufklärungsschützenpanzers mit einem tragbaren Strahlungsmessgerät gemessen. Wenn ich sah, dass man bei den Strahlungswerten, die das Messgerät zeigte, aussteigen konnte, nahm ich einen Soldaten mit, und wir stiegen aus. Der Soldat schnallte sich das Strahlungsmessgerät DP 7 an (innerhalb des Aufklärungsschützenpanzers gab es, glaube ich, DP 5 oder umgekehrt: Der Soldat hatte DP 5 mit, während es im Aufklärungsschützenpanzer DP 5 gab). Wir traten ans Fähnlein und nun galt es, vorschriftsmäßig die Strahlung einen Meter vor dem Fähnlein, einen Meter hinter dem Fähnlein, einen Meter links und einen Meter rechts vom Fähnlein – also viermal – zu messen. Der Soldat führte die Messungen durch und diktierte mir die Werte und ich notierte sie. Dann stiegen wir wieder in den Aufklärungsschützenpanzer ein und gingen auf die nächste Stelle. So wurde jeden Tag gearbeitet. Die Einteilung in Schichten war das Einzige, was sich änderte. So arbeitete ich mal in der Tages-, mal in der Nachtschicht. Nachdem alle markierten Stellen um Prypjat herum sowie innerhalb von Prypjat besucht wurden, gingen wir in den Stab, der unmittelbar in Tschernobyl lag und hinterließen dort die Messdaten. Von dort aus gingen sie nach Moskau, an den Generalstab. Sie waren von großer Bedeutung, diese Messdaten, denn im Grunde genommen schufen wir mit unserer schichtweisen Arbeit eine Karte der Strahlungslage.
N.K.: Sie waren also für die Karte zuständig?
N.W.: Ja, genauer gesagt, für die Änderungen dieser Karte. Denn die gab es jeden Tag. Jeden Tag. Es kam auf Wind und Wetter, Nebel und Luftdruck an sowie darauf, ob es klar war oder es regnete. So änderte sich diese Karte stets, und es war den Typen in Moskau sehr wichtig, über den Strahlungshintergrund im Klaren zu sein. Also, am 11. Juni, dem allerersten Tag, nahm ich drei Soldaten, wir stiegen in den Aufklärungsschützenpanzer ein und fuhren los. Auf der ersten Stelle war der Strahlungshintergrund im Großen und Ganzen in Ordnung. Die dritte oder die vierte Stelle lag – das habe ich noch frisch im Gedächtnis – im „roten“ Kieferwald, der schon damals „rot“ war. So wurde der dortige Wald genannt, weil er vor Radioaktivität völlig ausgebrannt war und die Nadeln der Kieferbäume nicht mehr grün, sondern leuchthellorange waren.
N.K.: Uff.
N.W.: Rostbraunrot, als sei er von Rost überzogen.
N.K.: Kapiert.
N.W.: Für diese merkwürdige Farbe tauften wir den Wald „roter Wald“. Die dritte oder, vielleicht, die vierte Stelle befand sich also in diesem „roten“ Wald, dort, wo einst eine kleine Baustofffabrik lag. Soviel ich weiß, wurden dort Stahlbetonringe für Brunnen hergestellt. Und so lagen die im Hof aufeinander angehäuft. Und als… Also, auf dem Fabrikgelände, die ziemlich klein war (die ganze Fabrik war eigentlich ziemlich klein) gab es ein Fähnlein, das darauf hinwies, das eine der Stellen dort war. Wie Sie wohl wissen, streuten sich kleine Graphitsplitter über die ganze Gegend, die das Kraftwerk umgab, wobei manche Splitter ziemlich weit davonflogen. Natürlich waren sie alle radioaktiv belastet. Allem Ansehen nach waren einige Splitter…
N.K.: …dorthin gefallen?
N.W.: Tja, zwischen diese Stahlbetonbauelemente gefallen. Kurz gesagt, als wir schon die Stelle anfuhren und uns zwanzig oder dreißig Meter blieben, sah ich mir das Strahlungsmessgerät an, das es im Aufklärungsschützenpanzer gab (N.W. lacht), und erschrak. Es zeigte etwa 200 Röntgen, um nicht zu lügen!
N.K.: Uff! Hoffentlich stieg niemand aus?
N.W.: Etwa bis 200 Röntgen. Eine fast tödliche Dosis.
N.K.: Na ja.
N.W.: Es war also überhaupt nicht erwünscht, sogar einige Minuten dort abzuhängen, denn so konnte man im Nu die Strahlenkrankheit abbekommen. Deshalb übernahm ich die Verantwortung und verbot dem Soldaten auszusteigen. Natürlich stieg ich auch selbst nicht aus. Wir hielten etwa 5-7 Meter vor der Stelle an, maßen die Strahlung, ohne aus dem Aufklärungsschützenpanzer auszusteigen (Gott sei Dank, waren wir von innen durch Blei einigermaßen geschützt), und fuhren schnell davon. Es gab also zwei Stellen, die sehr stark radioaktiv verseucht waren. Noch eine war die berühmte FACKEL. Warum Sie so hieß? Neben dem „roten“ Wald gab es eine Straßengabelung. Vielleicht war es darauf hinzuzuführen, dass es dort eine Pension in der Nähe gab, und eine dieser Straßen als Anfahrt diente. An einer der Straßen stand also eine große Fackel aus Furnierholz oder so was Ähnlichem, und daneben stand, in großen Buchstaben verfasst, das Wort ФАКЕЛ (Fackel). Hier gab es also auch ein Fähnlein, doch die Strahlungswerte waren sehr hoch. Das waren also die zwei Stellen, wo wir das Messgerät ablasen, ohne aus dem Fahrzeug auszusteigen. Und so schaffte ich es, den Jungs ihre Leben zu retten. In meinem Zug gab es sehr junge Menschen. Der Älteste war damals, soviel ich weiß, 27 oder 28. Die Übrigen waren ganz jung: etwa 19-21 Jahre alt. Das ganze Leben lag noch vor ihnen. Es brannte mir außerdem ins Gedächtnis ein, wie ich mit meinem Zug zur sogenannten Dekontamination in die Turbinenhalle… oder genauer gesagt ins Turbinenzentrum geschickt wurde.
N.K.: War es schon im Kraftwerk?
N.W.: Stimmt. An dem Tag gab es um 8 – oder vielleicht um 9? – einen Apell. Am zentralen Eingang stand in großen Buchstaben geschrieben „Das Atomkraftwerk Tschernobyl arbeitet für den Kommunismus“ (N.W. lacht). Sie war in riesigen Buchstaben verfasst, diese Schrift. Dazu gab es einen ziemlich großen Aufmarschplatz. Das alles galt also als zentraler Eingang. Auf diesem Aufmarschplatz gab es also einen Apell. Es versammelten sich alle, die der Brigade 25 angehörten, Feuerwehrleute wie einfache Soldaten. Also, alle, deren Fachgebiet mit dem Feuerlöschen zu tun hatten. Es wurden Aufgaben verteilt. Ein Leutnant oder ein Oberstleutnant trat vor und erteilte jeder Gruppe eine Aufgabe. An jenen Einsatz erinnere ich mich sehr gut. Zum ersten Mal holte ich meinen ganzen Zug auf diesen Aufmarschplatz zum Apell. Uns wurde zuteil, ins Turbinenzentrum zu gehen. Aber es fing alles nicht damit an. Es begann alles damit, dass ich meinen Zug dorthin holte und meinen Platz einnahm. Der Aufmarschplatz war voll von Menschen, denn Brigade 25 war mehrköpfig. Ich hielt natürlich das Messgerät in der Hand.
N.K.: Aha.
N.W.: Genauer gesagt, hielt einer der Soldaten das Messgerät. Ich hatte nämlich immer ein Messgerät mit, weil ich als Chemiker immer wissen musste, wie der Strahlungshintergrund ist. So standen wir 5, und dann 10 Minuten, doch niemand kam heraus. Es waren schon 20 Minuten vergangen, als ich auf das Strahlungsmessgerät guckte und einen so ziemlich hohen Strahlungshintergrund feststellte. So sprach ich Walentin Domanetzkij an, den Politruk unserer Kompanie, der als Obmann unserer Kompanie dort war. „Passiert in 10 bis 20 Minuten nichts, so hole ich meinen Zug zurück“, sagte ich. – „Wie bitte? Du wirst doch das auslöffeln müssen! Verstehst du etwa nicht, dass du politisch ausgebildet sein musst und dass wir alle hier nicht durch Zufall sind?“ „Ich will die Jungs nicht unter die Erde bringen, Walentin“, erwiderte ich. „Sie sind alle noch sehr jung. Komm mal her, ich zeige dir die Strahlungswerte. Und erklären, was sie bedeuten, kann ich dir auch, falls du nicht Bescheid weißt“.
N.K.: Aha.
N.W.: Ja. Ein Wort gab das andere, es vergingen inzwischen noch zehn Minuten, doch niemand kam nach wie vor heraus. Ich ließ meinen Zug kehrtmachen und zu unserem Wagen abmarschieren. Da erschien der Aufführende und rief mir zu: „Genosse[8] Leutnant, zu mir bitte!“ Er sah, dass ich meine Soldaten weghole. Ich trat ihn im Exerzierschritt heran und stellte mich vor. „Aus welchem Grund schicken Sie Ihre Soldaten weg?“ – „Aus dem Grund, dass ich Chemiker bin und meine Soldaten nicht töten will. Sehen Sie mal selber diese jungen Männer an!“ – „Drei Tage Haft!“ – „Zu Befehl!“ – „Und die Soldaten müssen bitte in die Truppe zurückkehren“. Ich holte also meine Soldaten in die Truppe zurück. Und da wir also im Turbinenzentrum eingesetzt wurden, hatte ich eine Gelegenheit, mich im Kraftwerk umzusehen. Und ich muss gestehen, ich bekam eine Menge negativer Eindrücke.
N.K.: Und was beeindruckte Sie?
N.W.: Es waren also lauter negative Eindrücke, Nataschenka. Erstens sollte man das ganze sowjetische System verstehen. Es gab da drüben nur wenige Profis wie ich. Doch andererseits wurden dorthin unzählige Menschen getrieben, und man hatte keine blasse Ahnung, was man mit denen allen anfangen sollte. Nie im Leben hatte ich so ein Wirrwarr gesehen. Na ja, ich hatte gewusst, dass die sowjetische Armee ein totales Chaos ist. Ganz unausgebildete junge Männer wurden zum Pflichtwehrdienst einberufen[9], es blühte in der sowjetischen Armee die Kameradenschinderei[10]. Es verging ein Jahr, bis der Einberufene mindestens Ansätze der Wehrkunde erlernte und sich als Soldat wahrnahm. Nach Tschernobyl wurden sehr viele frisch einberufene junge Männer getrieben, die dort total unnötig waren. Dazu gab es noch sogenannte „Partisanen“[11], die den Wehrdienst schon längst hinter sich hatten. Angenommen, es bestand ein großer Bedarf an Fahrern, hier stimme ich noch zu. Doch es gab viele „Partisanen“ mit Berufen, die da drüben total unnütz waren. Es war also eine Menge Leute, und niemand wusste, wie man sie managen soll, was man mit ihr anfangen soll, wohin man sie schicken soll. Das verblüffte mich und machte mich wütend. Es mache mich halt wütend. Und dann wurde ich für noch zwei Tage verhaftet. Jetzt erzähle ich Ihnen, weswegen. Wir kamen also zum zweiten Mal zur Dekontamination ins Kraftwerk. Als wir unsere Aufgabe erfüllten und herauskamen, kam es zum Streit. Am Eingang, da drinnen, wurden spezielle Kleidung, Schuhüberzieher und spezielle Mützen ausgegeben. Natürlich beachteten nicht alle Soldaten die Ordnung. Ein sowjetischer Soldat ist eben ein sowjetischer Soldat. Am Eingang standen große Kästen. Da die Schuhüberzieher sowie die übrige Kleidung nicht zu dekontaminieren waren, gehörte das alles in die Kästen; später wurden die Sachen verbrannt. Es gab im Kraftwerk nämlich viel Staub. So. Aber da es dauerte, bis einer zu diesen Kästen gelangte – die Schlagen waren nämlich sehr lang – hielten es sehr viele Soldaten für überflüssig zu warten, bis man an der Reihe ist, und fingen noch in der Schlange an, die Kleidung auszuziehen. Niemand mochte es, in der Schlange zu stehen, alle wollten möglichst schnell raus, um sich eine Raucherpause zu gönnen (obwohl es verboten war, auf dem Aufmarschplatz zu rauchen). So wurde die kontaminierte Kleidung in die Hände genommen, auf den Boden geworfen, es wurde darauf mit Füßen getreten. Dann wurde die Kleidung nicht in die Kästen, sondern auf den Boden geworfen und häufte sich auf. Dieser Haufen wurde mit Stiefeln getreten. Am Haupteingang gab es zwei Gruben, die angeblich mit einer Entseuchungslösung gefüllt waren.
N.K.: Aha.
N.W.: Ob eine Entseuchungslösung wirklich da drinnen war, war für mich fraglich. Daneben gab es sogenannte Kwatschi, Stäbe, auf die Lappen gespult waren. Mit Hilfe der Kwatschi sollte man die Stiefel waschen, um den radioaktiven Staub nicht mitzunehmen. Natürlich war die Zahl der Kwatschi begrenzt. Andererseits mussten sehr viele heraus. Und da nicht alle Kwatschi bekamen, wurden die Stiefel oft einfach mit Händen gewaschen – typisch sowjetische Dummheit.
N.K.: Оoh!
N.W.: Als ich sah, wie die jungen Männer das radioaktive Wasser schöpften und dann mit den Händen, die vor ein paar Minuten in dieses Wasser tauchten, Zigaretten nahmen und sich selbst damit vergifteten, wurde ich wütend. Ich tobte, und es wäre beinahe zur Prügelei gekommen. Ich war wegen dieser Profanation empört! Plötzlich erschien ein Major wie aus dem Nichts: „Wie benehmen Sie sich? Sie sind doch sowjetischer Offizier!“ Und so kriegte ich zwei Tage Haft. Unvergessliche Eindrücke. Aber ich bin sehr froh, dass ich mindestens einer Hälfte meines Zuges die Gesundheit rettete und den Jungs die Möglichkeit schenkte, eigene Familien zu bilden und Väter zu werden… Kostja Terentjew war Kommandant von Zug 2. Wir gingen nach drüben zusammen. In Bila Zerkwa blieben wir zwei Tage. Zusammen dienten wir. Eigentlich war ich da drüben nicht besonders lange. Die höchst zulässige Strahlungsdosis bekam ich ziemlich schnell, und obwohl es in meinen Unterlagen steht, ich habe insgesamt 25 Röntgen bekommen, weiß ich ganz genau wie viel es in der Tat waren. In der Wirklichkeit war meine Strahlungsdosis viel höher. Also, ich war da drüben vom 11. Juni bis zum 3. Juli, im Prinzip etwas mehr als einen halben Monat. So.
N.K.: Aber gewohnt haben Sie außerhalb der Zone?
N.W.: Stimmt. Hier wurde die Brigade 25 stationiert. Es standen riesige Militärzelte. Unsere 1. Kompanie für chemische Aufklärung wurde in der Nähe der Straße stationiert. Wenn man aus der Zone kam, lag Brigade 25 links. Auf einem ziemlich großen Gelände waren Zelte aufgeschlagen. Unsere 1. Kompanie für chemische Aufklärung lag der Straße am nächsten. Unweit eines Waldstreifens lag das Stabszelt. Im Waldstreifen stand ein kleiner Wagen geparkt, wo das Mineralwasser und sonstige Kleinigkeiten verkauft wurden. In der Nähe wurde eine Freitanzfläche angelegt, worauf Konzerte stattfanden. Damals war es für viele Promis eine Ehrensache, nach drüben zu kommen und für die Tschernobyler Helden (wie sie uns damals nannten) ein Konzert zu geben.
N.K.: Haben Sie es geschafft, ein paar Konzerte zu besuchen?
N.W.: Ne… Ja, man konnte ganz ruhig in Konzerte gehen. Ich besuchte ein Konzert von Alla Pugatschowa[12], die kam nach Tschernobyl. Es kam noch jemand, ich war aber nicht dabei, weil in im Einsatz war.
N.K.: Aha.
N.W.: Aber wissen Sie, Natascha, wir wurden damals wirklich wie Helden behandelt. Ich erinnere mich gut daran, wie Kostja Terentjew und ich von drüben nach Hause gingen und nach Kyjiw kamen. In der Sowjetunion konnte man immer nur mit Mühe und Not Eisenbahnfahrkarten kriegen. Wir hatten unsere Kampfanzüge an – khakifarbene Uniformjacken und Hosen, Militärschuhe mit dicken Sohlen und ledernen Verschlussbändern, Khaki-Mützen, die wir aus den mir unbekannten Gründen schön unanständig Pidorki[13] tauften (N.W. lacht). Wir kamen also auf den Bahnhof. Die Menschen, die in die Kassen Schlange standen und uns sahen, begriffen gleich, woher wir kamen, denn unsere Uniformen sprachen für uns. Und wir wurden so behandelt, wie etwa die ukrainischen Soldaten in jenem Sozialwerbespot, da sie aus dem ATO-Gebiet[14] kamen und alle auf einem Bahnhof aufstanden und Beifall klatschten. Es gab damals zwar keinen Applaus, aber in jeder Schlage, der sich unsere Jungs anschlossen, riefen die Leute zu: „Kommt mal her! Wir lassen euch durch!“ Es war sehr angenehm.
N.K.: Also wahrgenommen wurde es in der Gesellschaft eher…
N.W.: Die Wahrnehmung war sehr positiv. Wir wurden wirklich wie Helden behandelt. Und als Kostja und ich nach Charkiw zurückkamen, fiel uns ein, dass diese Bruderschaft auch weiter leben muss. Und obwohl Kostja zum Unterschied zu mir im Institut für medizinische Radiologie nicht behandelt wurde, wurde dort der erste… Also, wir waren damals zu bestimmten Ideen gekommen, die sich im „Verband Tschernobyl“ resultierten, dem in Charkiw gegründeten eingetragenen Verein. Es sammelten sich Ideen und die Vorstellungen an, dass alles nicht umsonst sein dürfe. Sehr viele Leute hatten doch die Tschernobyler Bewährungsprobe hinter sich. Sie alle brauchten Unterstützung, sehr viele von ihnen waren rechtlich inkompetent und wussten nicht, wie sie handeln sollten.
N.K.: Wie haben Sie denn einander gefunden?
N.W.: Wir… Gleich erzähle ich Ihnen, wie wir es schafften. 1988 bekam ich Gesundheitsprobleme. Obwohl ich gebildeter Chemiker bin, konnte ich es nicht vermeiden, eine Strahlungsdosis zu bekommen. Es gab nämlich fast keine Schutzmittel. Chemieschutzanzüge, die wir tragen mussten, waren schon veraltet, etwa L-1-Modell. Einmal wurden uns japanische Messgeräte, sogenannte Kulis, geliefert. Ihrer Form nach sahen sie dem Kugelschreiber ähnlich, passten prima in die Hosentasche, waren bequem und kompakt und funktionierten auch ganz gut. Doch in ein paar Tagen gingen sie alle kaputt. Bei den wenigen Schutzmitteln war es fast unmöglich, sich vor Radioaktivität zu retten, und obwohl ich mir viel Mühe gab, mich vor der Strahlung zu schützen, bekam ich sowieso eine ziemlich hohe Strahlungsdosis, was 1987 die Gesundheitsproblemen ergab. Vorher war ich ein ganz gesunder Mensch gewesen, ein kränklicher Mann würde die Arbeit als Schmelzer bei Zwetmet nie ertragen.
N.K.: Ach ja, Sie waren dort…
N.W.: Nur gesunde Leute können dort arbeiten. Die Produktion galt als körperlich anstrengend und gesundheitsschädlich. Unser Tätigkeitsbereich stand in Verzeichnis Nr. 1[15]. Es war wegen der Dämpfe selbstverständlich schädlich, das Aluminium zu schmelzen. Ich war also ganz gesund, als ich einberufen wurde. Die Gesundheitsprobleme fingen mit dem Hals an. Es gab ständiges Halskratzen, dem sich später ein leichter Husten anschloss. Dann traten Probleme mit Seh- und Hörvermögen auf. Seit 1987 lasse ich mich regelmäßig in speziellen medizinischen Einrichtungen behandeln. Bei einem x-beliebigen Krankenhaus kann ich mich nicht vorstellen. Durch die Anordnung des Ministeriums für Gesundheitswesen wurden bei manchen Krankenhäusern, Stadt- und Oblastabteilungen für das Gesundheitswesen eine sogenannte „Tschernobyler“ Abteilungen eröffnet. Bei den stationären Behandlungen kamen wir also alle zusammen.
N.K.: Ach so!
N.W.: Wir kommunizierten und tauschten gegenseitig unsere Erinnerungen aus. Das ist also die Antwort auf Ihre Frage, wie das alles begann. Im Institut für medizinische Radiologie an Puschkinskaja Straße wurde auch eine Abteilung gegründet, wo die sogenannten Tschernobyler[16] untersucht und behandelt wurden. 1989 musste ich mich bei dieser Abteilung wieder vorstellen. Hier begegnete ich einigen aktiven Jungs, die schon viele Ideen hatten, die unbedingt eine Gestalt annehmen mussten. Wir vereinigten unsere Geister und beschlossen, einen Verein zu gründen, der sich mit der Unterstützung der Tschernobyler befassen würde. Es hatten sich zu der Zeit schon eine Menge Probleme zusammengeballt. Es waren schon seit der Katastrophe einige Jahre vergangen und die Beamten fingen langsam an…
N.K.: Na ja.
N.W.: …die Sache auf die lange Bank zu schieben. Typisch unsere Bürokratie. Zuerst macht man dir Avancen und empfängt dich mit offenen Armen, dann aber wird alles auf die lange Bank geschoben. 1989 wurde also der erste eingetragene Verein gegründet. Kostja Terentjew und ich schlossen uns dem Verein ein wenig später an, als er sich Kräfte aufgetankt hatte. Zu Zeiten, da Wolodja Popow Anfang der 90er Jahre den „Verband Tschrnobyl“ leitete, war die Organisation sehr stark. Kostja und ich kamen in den Verband. Kostja übernahm die öffentliche Tätigkeit. Ich vertrat Wolodja Popow im Bereich Medizin und setzte mich mit allen Angelegenheiten auseinander, die mit der Medizin zu tun hatten.
N.K.: Aha.
N.W.: Ich bewahre sehr viele Papiere auf, sogar das ersten Statut, das wir annahmen (N.W. lacht). Eine Menge Dokumente also. Sie gehen keineswegs in den Mülleimer, weil ich sie für wertvolle Exponate halte. Eines Tages werden sie alle im Museum landen, das wir hoffentlich eröffnen werden. Noch eine wichtige Leistung unseres Verbandes besteht darin, dass eine Abteilung für die Tschernobyler bei der Obkomschen[17] Klinik an der Nowgorodskaja Straße auf unser Verlangen gegründet wurde. Dort wurden unsere Elite, unsere obkomsche und gorkomsche[18] Parteispitze[19] sowie die Angehörigen ihrer Familien, alte Mitglieder der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Helden der Sowjetunion und viele andere behandelt.
N.K.: Aha.
N.W.: So. Als ich begann, den Bereich Medizin zu leiten, stellte es sich heraus, dass ich enge Kontakte zu den Vorsitzenden der Stadtabteilung für Gesundheitswesen sowie der Oblast-Abteilung für Gesundheitswesen hatte. So fingen wir alle zusammen an, die Abteilung für die Tschernobyler in dieser Klinik „herauszuschlagen“, weil diese Klinik als eine der besten galt. Ich musste vieles erleben und viel mit Beamten kämpfen. Ich sprach sie sogar durch Zeitungen, genauer gesagt, durch Zeitungsartikel an. Die Kommunisten erwiderten, dass wir das lieber nicht tun sollten, dass sie auch eine Stelle bräuchten, wo wir ruhig medizinisch versorgt wurden. Ich habe im Prinzip nichts dagegen. Wir hatten doch schließlich nicht das Ziel, jemand zu vertreiben. Wir baten bloß, eine Abteilung für die Tschernobyler zu gründen. Und der Kampf wurde vom Erfolg gekrönt. Die Abteilung wurde gegründet. Das kostete mich zwar viele Nerven, doch die Abteilung wurde gegründet. Später erlebte die Obkomsche Klinik eine Umwandlung, in dem sie zum Behandlungs- und Prophylaxenzentrum für uns Tschernobyler wurde.
N.K.: Aha.
N.W.: Zuerst fiel es mir schwer, mit dem damaligen Chefarzt Herrn Wolk Kontakt aufzunehmen. Aber allmählich fingen wir an, zu kommunizieren und befreundeten uns sogar an. Im Institut für medizinische Radiologie wurde ein Expertenrat gegründet. Ich vertrat darin den „Verband Tschrnobyl“, da ich für medizinische Fragen zuständig war. Auch der Expertenrat wurde mit viel Mühe geschaffen. Was war eigentlich der Expertenrat? Dazu gehörten hochqualifizierte Fachärzte, hauptsächlich, Kandidaten und Doktoren der Wissenschaften[20]. Jeder vertrat eine bestimmte Fachrichtung. Unter ihnen war zum Beispiel ein Professor, Doktor der Wissenschaften in Therapie. Oder es gab einen Facharzt in Neurologie.
N.K.: Aha.
N.W.: Sie waren also alle hochqualifiziert. Und hauptsächlich waren es Professoren. Dazu gab es einen Vertreter eines eingetragenen Vereins, zwei Sekretäre, die normalerweise Sitzungen leiteten. Außerdem war bei jeder Sitzung des Expertenrates der Abgeordnete des Obersten Sowjetes der Ukraine[21], Herr Walenja, anwesend. Er war der Abgeordnete der Ersten Legislaturperiode. Zu Sitzungen kam er eigentlich nur selten, weil er meistenteils unterwegs oder in Kyjiw war (N.W. hustet).
N.K.: Möchten Sie vielleicht Mineralwasser?
N.W.: Nein, nein, danke. Bei diesen Expertenräten wurde besprochen, ob die Verbindung zwischen den Erkrankungen, an denen die Menschen litten, und Tschernobyl, der Radioaktivität, der Strahlung bestätigt werden kann. Zur Feststellung und Bestätigung dieser Verbindung sollte man vor dem Expertenrat erscheinen. Die Ärzte studierten alle Unterlagen zur konkreten Person, und davon gab es normalerweise viele, denn damals hatten schon viele von uns stationäre Behandlungen in den Abteilungen und den Kliniken für die Tschernobyler hinter sich. So wurden diese medizinischen Dokumente erörtert. Danach wurde entschieden, ob die Erkrankung, an denen dieser Mensch litt, dadurch bedingt ist, dass er in der Sperrzone bestimmte Zeit lang gewesen war, oder sich auf seine aktuellen Lebensverhältnisse zurückzuführen lässt. Ob der Mensch bloß vor Ort erkältet war oder er chronische Bronchitis hatte. Na ja, es wäre meinerseits irgendwie falsch zu sagen, dass es prestigeträchtig war, diesen Zusammenhang vom Expertenrat bestätigt zu bekommen, doch allerdings war es wichtig, weil der Zusammenhang zu sehr vielen Privilegien berechtigte.
N.K.: Aha.
N.W.: Deshalb neigten die Experten dazu, die Anzahl der Kandidaten zu reduzieren – wahrscheinlich wurden das ihnen „von oben“ angewiesen. So. Und ich vertrat beim Expertenrat dagegen die Interessen der Tschernobyler, und natürlich setzte ich mich für ihre Interessen ein. Ich war daran interessiert, dass möglichst viele den Zusammenhang bestätigt bekommen. Umso mehr, dass ich mich immer vorher mit den medizinischen Dokumenten dieser Menschen vertraut machte und sie in Krankenhäusern oder zu Hause besuchte…
N.K.: Uff, was Sie nicht sagen!
N.W.: …Ich rief sie an und sprach mit ihnen, fragte, wo in der Zone sie waren, welche Arbeiten sie ausführten. Denn es gab schon damals sehr viele Pseudoliquidatoren. Als die ersten Ausweise ausgestellt wurden, tauchten viele Menschen auf, die offen gestanden…
N.K.: Mannomann...
N.W.: …mit Tschernobyl fast nichts zu tun hatten. Wie etwa der Fima, eine prägende Persönlichkeit aus jeder Zeit. Der arbeitete außerhalb der Zone in einer Wäscherei, wo schon mehr oder weniger saubere Kleidung gewaschen wurde. Also, ja, die Kleidung war kontaminiert, allzu sehr radioaktiv verseucht war sie nicht. Und man reinigte und wusch es. Er hielt sich außerhalb der Zone auf, doch irgendwie schaffte er es, den Tschernobyler-Ausweis zu kriegen. Dann aber gab es so viele Probleme mit diesem Fima! Er kam und stritt mit mir, weil er den Zusammenhang auch wollte. Ich sagte ihm: „Du spinnst wohl, Fima. Du bist nicht einmal Umsiedler, geschweige denn Liquidator!“ Aber es handelt sich nicht darum. Ich machte mich also mit dem Menschen bekannt und erkundigte mich, wo in der Zone er war, als was er dort arbeitete, wie lange er dort blieb und welche Strahlungsdosis er bekam. Ich sprach mit ihm lange, um…
N.K.: Um ihn besser kennen zu lernen?.
N.W.: …um mich gut vorzubereiten. Beim Expertenrat zogen die Ärzte nur das Medizinische in Betracht, ließen aber das Menschliche aus. Lauter medizinische Angaben. Ich stritt aber ständig mit diesen Professoren. Ich erinnere mich gut, wie ich mich mit einer Professorin in die Wolle geriet. Sie war eine prima Ärztin, aber kein angenehmer Mensch.
N.K.: Das kommt vor.
N.W.: Larissa Iwanowna Simonowa. Sie arbeitete damals beim Institut für medizinische Radiologie. Ob sie dort auch heute arbeitet, weiß ich nicht. Eine gute Fachärztin, sie war aber leider überzeugt, dass alle Tschernobyler Schmarotzer sind, die sozusagen ihre Teile des Kuchens herausschneiden wollen…
N.K.: Tja, das kommt vor.
N.W.: …und so weiter und so fort. Ich stritt mit ihr oft. Doch ich bin darauf sehr stolz, viele Tschernobyler verteidigt zu haben. Dass positive Entscheidungen zur Hälfte der paar hundert Menschen getroffen wurden, die vor dem Expertenrat erschienen, ist eigentlich mir zu verdanken. Das war ich, der ich diese Menschen in dem Expertenrat verteidigte und mich für sie einsetzte. Einige Zeit lang war Professor Minak – Gott hab ihn selig! – Vorsitzender des Expertenrates. Dieser Mann ist schon längst gestorben, mir blieb er als hervorragender und gutmütiger Mensch im Gedächtnis. Ich kommunizierte mich viel mit ihm, wir sprachen oft nach dem Expertenrat miteinander. Manchmal stritten wir zu den Fällen, die für die nächsten Sitzungen des Rates verschoben wurden, aber immer konnten wir eine einvernehmliche Lösung finden. Manchmal schaffte ich es, die Kandidaten durchzusetzen, manchmal scheiterten meine Bemühungen. Zuerst fand der Expertenrat zweimal wöchentlich, später nur einmal wöchentlich statt. Und so blieben Minak und ich nach den Sitzungen zusammen, besprachen die verschobenen Fälle, behandelten sie aufs Neue. Zu jedem Fall erläuterte ich nicht nur medizinische Angaben, sondern äußerte mich auch zu jedem Kandidaten als solchen…
N.K.: Sie erzählten also über die Menschen?
N.W.: …Ja, ich beschrieb ihre Charakterzüge; ich erzählte, wo in der Zone sie waren, als was sie dort arbeiteten, wie ihre Familien sind, wie ihre Lebenseinstellung ist, wie viele Kinder sie haben, wie wichtig es für diejenigen ist, die mehrere Kinder haben, oft aber krank sind und längere Zeit in stationären Klinikabteilungen verbringen müssen, die Zusammenhänge bestätigt zu bekommen. Es war nämlich sehr wichtig, Familien zu unterstützen. Sehr viele Familien zerfielen wegen ernster Gesundheitsprobleme der Familienväter. Die Radioaktivität übt doch eine kaum zu unterschätzende Wirkung auf den menschlichen Körper aus und verursacht eine Menge Krankheiten.
N.K.: Und deswegen zerfielen ganze Familien? Weil die Menschen…
N.W.: Ja, so was kam vor. Manche Frauen konnten es nicht mehr aushalten. Viele Männer waren gezwungen, aus ihrem Arbeitsleben auszuscheiden.
N.K.: Ach so.
N.W.: Wer wird einen Arbeitnehmer akzeptieren, der sich stets in Krankenhäusern aufhält. Es ist für den Betrieb halt ungünstig. Man muss doch seine Arbeitsunfähigkeit entgelten. Wer wird aber für ihn arbeiten? Deshalb zogen viele Arbeitgeber vor …
N.K.: Also, aus diesem Grund…
N.W.: …die Tschernobyler loszuwerden, die ihnen total ungünstig waren. Nicht jede Frau mag es, wenn ihr Ehemann zu Hause hockt und keine Kohle verdient. Deswegen mussten viele Familien zerfallen. Nicht jede Frau mag es, wenn ihr Ehemann krank ist. Denn die Radioaktivität wirkte…
N.K.: Also dann…
N.W.: …auf die Potenz ein, wie Sie wohl wissen… Wie schon gesagt, wurden nach drüben sehr viele Leute getrieben, es gab aber unter ihnen nur wenige ausgebildete Menschen. Der Zivilschutz war bei uns damals tatsächlich gleich Null, obwohl es der Zivilschutz war, der dafür zuständig sein sollte. Es galt damals, dass die Menschen zu friedlichen Zeiten auf den Atombombenabwurf vorbereitet werden sollen…
N.K.: Also, auf die Umstände...
N.W.: … Und der Zivilschutz musste Bewohner von Hochhäusern, von ganzen Mikrobezirken versammeln und sie unterrichten. Es sollten jeden Monat Aufklärungsmaßnahmen stattfinden, wo die Menschen darauf hingewiesen werden sollten, wie man sich vor der radioaktiven Strahlung schützt. Doch das alles gab es nur auf dem Papier!
N.K.: Und nun so eine Frage. Zu der Zeit, da Sie da drüben waren, überwogen natürlich die Männer. Gab es aber trotzdem Tätigkeiten, die den Frauen anvertraut wurden?
N.W.: Aber sicher.
N.K.: Und wer machte was? Bin halt bloß neugierig.
N.W.: Frauen arbeiteten hauptsächlich bei Kantinen und Großküchen. Dann gab es Wäscherinnen… Aber es wäre vielleicht keine genaue Bezeichnung ihres Tätigkeitsbereichs. Es gab eine Dekontaminationszentrale, wo die Kleidung nicht gewaschen, sondern dekontaminiert wurde.
N.K.: Innerhalb der Sperrzone also?
N.W.: Na ja. Es gab da drüben Checkpoints… Es gab dort folgendes System. Genauso wie im heutigen ATO-Gebiet gab es dort auf fast allen Straßen Checkpoints. Man konnte das Kraftwerk und die Stadt Prypjat nicht erreichen, ohne über die Checkpoints gefahren zu sein. Dazu noch übten die Checkpoints auch die dekontaminierende Funktion aus. Dort gab es mit Sprengwagen mit der Entseuchungslösung. Natürlich sammelten die in der Zone eingesetzten Fahrzeuge (wie etwa unser Aufklärungsschützenpanzer) radioaktiven Staub ein, deshalb wurden sie schon außerhalb der 30-km-Zone im Checkpoint unbedingt gewaschen. Danach wurde das Fahrzeug gemessen. Waren die Strahlungswerte zu hoch, wurde es erneut gewaschen, bis die Strahlungswerte sanken.
N.K.: Führten Frauen diese Arbeit aus?
N.W.: Nein, Männer machten das.
N.K.: Entschuldigung.
N.W.: Ich bin auf ein anderes Thema übersprungen. Was die Frauen angeht, waren sie meistens in Großküchen und Dekontaminierungszentralen beschäftigt…
N.K.: Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden.
N.W.: …wo die Kleidung entseucht wurde. Und was die Checkpoints angeht, arbeiteten nur Männer dort, und es waren ausschließlich Militärangehörige. So wurde unser Aufklärungsschützenpanzer einmal gewaschen. Sanken die Strahlungswerte nicht, wurde das Fahrzeug nochmals gewaschen und wieder gemessen. Waren die Strahlungswerte wieder zu hoch, wurde der Aufklärungsschützenpanzer zum dritten Mal gewaschen. Waren die Strahlungswerte auch danach zu hoch, stiegen wir aus, und das Fahrzeug ging zur „Grabstätte“. Diese Grabstätten waren riesig, Natascha. Was hieß eigentlich die Grabstätte? Das war eine ungeheuer riesige Grube, wo alle Fahrzeuge hingeworfen wurden. Also, ja, hingeworfen wurden sie nicht, sondern man brachte sie hin und ließ dort stehen. Es wurden in dieser Grube sehr viele Fahrzeuge verlassen, die damals insgesamt Millionen Rubel kosteten. Auch die Bagger waren dort…
N.K.: Na ja, die waren doch schon…
N.W.: Auch die Schützenpanzer waren dort. Wahnsinnig viel Technik! Am Anfang gab es ein paar Tage, an denen der Strahlungshintergrund ein wenig sank. Das war darauf zurückzuzuführen, dass diese Stelle vom Wind verweht wurde.
N.K.: Na ja.
N.W.: Dabei gingen die radioaktiven Emissionen in Richtung Weißrussland und Europa. Sehr vieles hing von der Atmosphäre, von Niederschlägen, vom Wetter ab. Ich erinnere mich an einen nebligen Tag; der wässerige Nebel hinterließ auf unserem Fahrzeug kleine Tropfen. Wegen des Nebels wurde unser Wagen so kontaminiert, dass der Strahlungshintergrund sogar nach drei Wäschen zu hoch blieb. So mussten wir in einen anderen Wagen umsteigen, und dieser Aufklärungsschützenpanzer...
N.K.: Musste also weg.
N.W.: …ging in die Grabstätte. Das brannte mir ins Gedächtnis. Genauso wie die ersten Tage drüben, an denen geflogen wurde. Als wir ins Kraftwerk zum ersten Mal gingen, um den Strahlungshintergrund an den Stellen zu messen, sahen wir Hubschrauber fliegen, die die Straßen von oben mit einer Speziallösung begossen. Darauf entstand ein Film, der dem Glas glich.
N.K.: War er rutschig, dieser Film?
N.W.: Tja, die ganze Straße schimmerte und wurde rutschig. Also, schwere Hubschrauber wie etwa MI-6 oder MI-8 begossen die Straßen mit dieser Lösung. An ihre Marken erinnere ich mich nicht mehr genau, aber es waren allerdings schwere Maschinen. Die Lösung, mit der diese schweren Maschinen die Straßen begossen, verband sich mit dem Staub, damit der Staub nicht aufsprühte.
N.K.: Ich kann mir vorstellen, wie viele Verkehrsunfälle es damals gab, wenn die Straßen so rutschig waren. Passierten also oft Verkehrsunfälle oder war die Sache glimpflich abgegangen?
N.W.: Ne, man fuhr bloß langsamer…
N.K.: Ach so. Kapiert.
N.W.: … und vorsichtiger. Ich weiß nicht, vielleicht gab es Verkehrsunfälle. Wir hatten Spezialpassierscheine. Es wurde nämlich für jedes Fahrzeug ein Spezialpassierschein erstellt. Die 30-km-Zone wurde in noch drei Zonen geteilt. Die Zone, worauf das Kraftwerk und Prypjat lagen, galt für die wichtigste. Das war also Zone 1. Sie war durch Zone 2 umgeben.
N.K.: Wo war das?
N.W.: Für diese Zone gab es andere Passierscheine, genauso wie für Zone 3, die schon Ränder der 30-km-Zone umfasste. Wurde einem zum Beispiel ein Passierschein für Zone 3 erstellt, hieß es, dass dieser Passierschein ausschließlich für Zone 3 gültig war. In Zonen 1 und 2 wurde man mit diesem Passierschein nicht reingelassen. Unser Passierschein war aber für die drei Zonen gültig.
N.K.: Ach so.
N.W.: Auch für Tschernobyl und den Stab brauchte man Passierscheine, es war nicht so einfach, nach Tschernobyl zu gelangen. Mir prägte sich unsere erste Reise nach Tschernobyl ins Gedächtnis. Wir mussten die Angaben in den Stab holen. ??Ausgereist waren wir um 6 Uhr morgens des 11. Juni. Um 6 abends hatten wir schon frei. Als wir die Sache erledigten, fiel uns (den drei Soldaten, die ich mitnahm, und mir) ein, in Tschernobyl ein wenig spazieren zu gehen. Ich war gespannt, dieses Städtchen mit eigenen Augen zu sehen. Und da der Strahlungshintergrund dort nicht besonders hoch war, zogen wir nicht professionelle Staubschutzmasken, sondern die sogenannten Blütenblätter[22] an. Wissen Sie übrigens Bescheid, was die Blütenblätter sind?
N.K.: Ja, ich weiß.
N.W.: Also, wir hatten die sogenannten Blütenblätter an. Da es Sommer war, wurde es erst gegen 10 abends dunkel. Wir bummelten die Straßen entlang und sahen in den Gärten viele reife Erdbeeren und Kirschen. Natürlich gab es niemand, der die ganze Ernte einbringen würde. Die Bewohner aller Einfamilienhäuser waren weg. Sie wurden alle evakuiert, niemand durfte bleiben. Nie wieder in meinem Leben sah ich Kirschen wie in den verlassenen Gärten!
N.K.: Was Sie nicht sagen.
N.W.: Und was die Erdbeeren angeht…
N.K.: Die waren riesig, ne?
N.W.: …tja, groß wie Pflaumen waren sie!
N.K.: Ach du meine Güte!
N.W.: Wahrscheinlich trug die Radioaktivität dazu bei, dass die Pflanzen und ihre Früchte mutierten. Die Erdbeeren und die Kirschen waren halt riesig. Das machte auf mich einen starken Eindruck. Aber natürlich wagten wir es nicht, die zu essen, denn…
N.K.: Da hatten Sie wohl Recht.
N.W.: …die Früchte speicherten die Radioaktivität. Die Jungs wollten sich zwar ein paar Kirschen pflücken, doch ich verbot ihnen das aufs Strengste. Aber jedenfalls waren wir durch die Form und die Größe dieser Früchte beeindruckt. In Tschernobyl gab es viele Ärzte, die später hier bei den Abteilungen für die Tschernobyler arbeiteten.
N.K.: Aha!
N.W.: Ja. Sie behandelten uns, noch in Tschernobyl freundeten wir uns an. Hier sind unsere…
N.K.: Vielleicht…
N.W.: …unsere Legenden. Insbesondere die aus Klinik Nr. 20, der Studentenklinik[23]. Die Oberärztin Maja Grigorjewna, Gott habe sie selig, sie ist vor einigen Jahren schon leider gestorben. Maria Issakowna Sacharowa arbeitet noch, sie ist die Chefärztin der Klinik. Sie sind hervorragend, diese Ärztinnen, pure Legenden.
N.K.: Viele Leute sagen, dass Tschernobyl ihre Weltanschauung änderte. Die Reise nach drüben änderte ihre Werteordnung, manche Sachen in ihren Leben gewannen an Wert, manche traten dagegen in den Hintergrund. Haben Sie was Ähnliches erlebt?
N.W.: Lässt sich etwa aus meinem Interview nicht schlussfolgern, dass sich meine Lebenseinstellung änderte?
N.K.: Das schon… aber was genau änderte sich daran?…
N.W.: Aber sicher änderte sich meine Lebenseinstellung, und zwar sehr stark. Als wir von drüben zurückkamen, waren wir schon keine sowjetischen Bürger mehr. Ich hielt mich selbst für keinen Sowok[24] mehr. Obwohl ich nie Mitglied der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war, war ich Mitglied des Gesamtsowjetischen Leninschen Kommunistischen Jugendverbandes[25], das heißt, ich war Komsomolze. Doch nach Tschernobyl änderten sich meine Weltanschauung und mein Wertesystem. Ich wollte nicht mehr für den Staat und für meine sowjetische Heimat leben, sondern fand es wichtig, für die Familie, für die Kinder zu leben. Ich fand die Familie sehr wichtig. Deshalb änderte sich meine Lebenseinstellung. Ich wurde viel aktiver. Ich begriff, dass man um alles kämpfen muss, statt mit dem Strom des Lebens zu schwimmen. Früher war mir alles recht. Meine Arbeit, mein Gehalt, meine Familie… Es ging also alles seinen Gang. Als ich aber zurückkehrte, beschloss ich, ein neues Leben zu beginnen, denn es war nicht mehr möglich, so zu leben, wie ich früher gelebt hatte, und dass ich ein neues Leben beginnen muss. Und im Grunde genommen, wird es oft gesagt, dass auch die Perestrojka[26] von Tschernobyl anfing. Es war Tschernobyl, das der Bildung einer neuen Gesellschaft einen heftigen Ruck gab. Noch in der späten Sowjetunion fingen die Menschen an, sich zu ändern.
N.K.: Nun sagen Sie bitte, was Sie zur komplizierten Frage denken, die eigentlich sehr viele schon längst zu beantworten versuchen. Wie meinen Sie, kam ihrer Meinung nach es zur Havarie im Atomkraftwerkt Tschernobyl? Viele sagen, sie sei auf die Fahrlässigkeit zurückzuführen, viele geben der damaligen Parteileitung schuld, weil die immer versuchte, 5-Jahres-Pläne in zwei Jahren erfüllt zu haben oder so was in der Art. Wie meinen Sie also, wie hätte es zu solch einer Havarie kommen können?
N.W.: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Und meine Antwort darauf kann ziemlich subjektiv klingen…
N.K.: In Ordnung. Sagen Sie bloß, was Sie als Zeitzeuge dazu meinen?
N.W.: Ich meine, die Katastrophe war in der Tat durch die Fahrlässigkeit verursacht. Durch die Fahrlässigkeit und den menschlichen Faktor. Mindestens zu 60%. Die übrigen 40% entfielen, glaube ich, auf allerlei kleine wie große Mängel. Wenn große Bauobjekte und Industrieriesen zu Zeiten der Sowjetunion errichtet wurden, wurden für die Bauarbeiten kaum überschreitbare Fristen festgelegt. Deshalb drückte man bei vielen Mängeln, die während Bauarbeiten hervortraten, die Augen zu, es gab viel Hektik und Spiegelfechterei. Obwohl das Kernkraftwerk in Betrieb gesetzt worden war, war es… Also, ich weiß davon Bescheid, wie es funktionierte. Ich sprach darüber mit vielen interessanten Menschen. Im Grunde genommen waren die Bauarbeiten immer noch im Gange, als das Kernkraftwerk in Betrieb gesetzt wurde.
N.K.: Was Sie nicht sagen.
N.W.: Und es gab halt sehr viele Mängel. Das ist aber eine lange Geschichte.
N.K.: Na klar.
N.W.: Ja, genau.
N.K.: Im Großen und Ganzen sah es so aus.
N.W.: Na ja. Die Mängel, die Fahrlässigkeit, der menschliche Faktor waren meinetwegen dafür verantwortlich, was im Kernkraftwerk Tschernobyl passierte.
N.K.: Danke. Entschuldigen Sie mir eine unanständige Frage… Hatten Sie damals Kinder oder bekamen Sie die später?
N.W.: Ja.
N.K.: Ja?
N.W.: Kinder hatte ich vorher bekommen, einen Sohn und eine Tochter. Zum Zeitpunkt, da ich während der zweiten Einberufungswelle einberufen wurde, war meine Tochter, glaube ich, vier Monate alt. Sie war im Januar geboren… Also, Januar, März, April… Ja, genau, sie war damals vier Monate alt.
N.K.: Ach so!
N.W.: Nichtsdestotrotz musste ich nach drüben. Denn erstens war ich damals als sowjetischer Bürger höchst pflichtbewusst (das änderte sich aber, als ich von drüben zurückkehrte) und wollte mich als sowjetischen Offizier nicht bloßstellen. Zweitens wusste ich, dass es zu wenige kompetente Chemiker da drüben gibt.
N.K.: Dass man Sie dort also braucht.
N.W.: Tja, dass mein Kopf und meine Hände da drüben jedenfalls nicht stören würden und dass ich vielleicht mindestens ein paar Leben retten könnte. Wie gesagt war ich ein pflichtbewusster Bürger, obwohl meine Frau natürlich versuchte, mich davon abzubringen… Aber im Grunde genommen konnte ich es nicht verweigern. Es wurden damals alle einberufen, auch diejenigen, die Kleinkinder hatten, waren keine Ausnahme. Niemand berücksichtigte es.
N.K.: Es wurde also nicht in Erwägung gezogen, ob man ein Kleinkind hat oder nicht.
N.W.: Genau. Nach den damaligen Gesetzen konnte ein Familienvater nicht einberufen werden, wenn sein Kind noch sehr klein ist. Aber damals wurde dies nicht berücksichtigt. Es wurde Taxipark 1 gemietet und sie kamen mit einem Taxi, diese zwei – ein Vertreter des Militärkommissariats…
N.K.: Und trieben alle nach drüben.
N.W.: …und ein Vertreter der Verwaltung für innere Angelegenheiten und trieben alle nach drüben, ohne auf persönliche Umstände zu achten. Bei der zweiten Einberufungswelle kam schon niemand zu mir nach Hause, es wurde mir bloß ein Einberufungsbefehl gesendet. Ich ging ins Militärkommissariat und sprach kurz mit unserem Bezirksmilitärkommissar, mit dem ich auf gutem Fuße stand. Ich sagte ihm, meine Tochter sei erst 4 Monate alt und ich möchte natürlich zu Hause bleiben. Meine Abreise würde meiner Frau eine Menge Sorgen bereiten, umso mehr, dass ich nicht wüsste, wie die Konsequenzen sein könnten… Niemand wusste das. Niemand wusste, worin sich das, was sich ereignete, resultieren wird.
N.K.: Aber sicher.
N.W.: Alle waren im Unklaren. Nicht einmal die Kernphysiker konnten sich damals Klarheit verschaffen, worin sich das alles ergeben wird, der radioaktive Zerfall läuft doch immer noch.
N.K.: Na ja, niemand weiß genau, was dort passiert.
N.W.: Es wurden darauf Erde und Sand aufgeschüttet, doch niemand weiß, was im Inneren passiert, die Kernreaktion läuft immer noch.
N.K.: Ihre Frau war also dagegen?
N.W.: Und wie. Aber wir sprachen viel darüber und irgendwie schaffte ich es, sie zu überzeugen. Ich sagte, ich käme schnell wieder zurück, ich müsse dort unbedingt sein und so weiter und so fort. Nach drüben fuhr ich also freiwillig.
N.K.: Verstanden. Nun sagen Sie bitte… Vor mindestens ein paar Jahren gab es unter Studenten, überhaupt unter Jugendlichen Ideen, in die Zone als Touristen zu gehen. Was halten Sie davon? Ist es gefährlich?
N.W.: Wozu denn eigentlich?
N.K.: Na ja, wahrscheinlich hatte jeder seine Ziele und seine Motivation. Jedenfalls gibt es solche Ideen.
N.W.: Ich bin gegen solche Reisen. Nur Fachleute können jetzt da drüben sein. Es ist durchaus sinnlos, nach drüben als Tourist zu fahren, es gibt dort kaum was zum Besichtigen. Man wird dort ja höchstens den Sarkophag sehen. Viele glauben, sie werden dort den ruinösen 4. Reaktorblock sehen. Das werden sie nicht. Es gibt dort bloß die Reste des Kraftwerks, sein Gerippe. Was noch… Vielleicht den „roten“ Wald, doch der ist, glaube ich, schon längst weg, an seiner Stelle ist ein Laßreis wohl aufgewachsen. Den „roten“ Wald gibt es wahrscheinlich auch nicht, fast 30 Jahre sind schon vergangen. Was kann man dort noch besichtigen? Verlassene Dörfer? Die verlassene Stadt Prypjat? Wenn ich mich daran erinnere, läuft es mir eiskalt über den Rücken. Als wir zum ersten Mal nach Prypjat kamen, wurde es uns unbehaglich zumute. Es war wie in amerikanischen Horrorfilmen, da die Menschheit ausstirbt und ganze Städte unbewohnt bleiben. Du kommst in eine normale Stadt, siehst aber keine Menschenseele, nur das Heulen des Windes ist auf leeren Straßen zu hören. Manche Fensterscheiben waren schon zerschlagen, die leeren Augenhöhlen der Häuser starrten auf uns, und der Wind heulte.
N.K.: Klingt entsetzlich.
N.W.: Neben einem Blumenbeet stand ein kaputter Kinderwagen, daneben lag eine Puppe, der ein Bein abgerissen war… Und niemand war ringsum zu sehen. Es erklang kein Kindergelächter, keine menschlichen Stimmen waren zu hören. Es war entsetzlich. Es stand alles in voller Blüte, die Blumen, mit denen das Blumenbeet liebevoll angelegt war, rochen herrlich. Aber vor Leere und dem Heulen des Windes sträubten sich einem die Haare.
N.K.: Wenn es also eine Gelegenheit gäbe, die Zone nochmals zu besuchen und die Stellen zu sehen, wo Sie einst gearbeitet haben, würden Sie vom emotionalen Aspekt her sich eher davon zurückhalten?
N.W.: Ne, es zieht mich nicht in die Zone. Ganz im Gegenteil. Manche gehen durch Erinnerungen getrieben nach drüben, um die Stellen zu besuchen…
N.K.: Na ja.
N.W.: …wo sie waren. Ich aber nicht. Ich träume selten von der Zone. Doch die Jungs, mit denen ich dort arbeitete, - von denen träume ich oft. Aber nicht von der Zone und vom Kraftwerk. Manchmal träume ich von unseren Einsätzen, das kommt aber auch selten vor.
N.K.: Oh du meine Güte, man träumt sogar von der Zone…
N.W.: Es zieht mich aber nicht nach drüben, und ich bin überzeugt, man hat dort als Tourist nichts zu suchen. Ein Mensch, der das alles nicht hautnah erlebt hat, hat dort gar nichts zu suchen.
N.K.: Na ja.
N.W.: Er hat keine damit verbundenen Erinnerungen. Es gibt dort nichts zum Besichtigen.
N.K.: Und was meinen Sie zu den Gedenkveranstaltungen? Genügen sie oder könnte man darin etwas ändern?
N.W.: Offen gesagt genügen sie gar nicht. Denn mit jedem Jahr wird immer weniger Aufmerksamkeit dem Thema Tschernobyl geschenkt – die Tendenz lässt sich eindeutig erkennen. Hätte es unsere Aktivisten nicht gegeben, die dieses Joch auf sich genommen haben und es immer noch buckeln, wäre dieses Thema schon längst in Vergessenheit geraten. Tolik Gubarew und ich fingen zur gleichen Zeit an. Später schloss sich uns Gena Berletow an. Also, mit Tolik Gubarew fingen wir tatsächlich zur gleichen Zeit an. Er vertrat Popow in organisatorischen Angelegenheiten, ich – in medizinischen. Ich respektiere Menschen wie er, denn solche Menschen tragen ein schweres Kreuz. Täten sie nichts, wären wir schon längst im Stich gelassen. Man muss doch Staatsbeamten ständig aufrütteln; man muss sie ständig daran erinnern, dass es uns gibt, dass wir Probleme haben. Und es gibt in der Tat sehr viele Probleme. Viele Jungs sind schon tot. Von den sieben Menschen, mit denen ich mich in Tschernobyl sehr eng befreundete und auch nach Tschernobyl Freundschaft pflegte, sind nur noch drei am Leben. Die übrigen vier sind schon tot.
N.K.: Aha.
N.W.: Wolodja Swjatowjetz, das Mitglied des ersten Rates, den es zu Zeiten von Popow gab. Die Geschichte seines Todes ist sehr lang und verwickelt. Ich setzte mich damit sehr lange auseinander, und wir wollten sogar wegen seines Todes eine Klage vor Gericht einreichen. Dass wir es nicht machten, ist seiner Frau zu verdanken, die uns davon ausredete. „Tu es nicht, Nikolai. Bitte keine Klagen einreichen“, sagte sie mir damals. Zweimal jährlich – zu Wolodjas Geburtstag und zu seinem Todestag – besuchen Serjoscha Tschubenko, Tolik Gubarew und ich sein Grab. Das ist unsere über 20 Jahre alte Tradition, die wir seit 1991 haben. Am siebten Dezember besuchen wir sein Grab wieder. Also, wie schon gesagt, sind von meinen nächsten Freunden nur noch drei geblieben, die übrigen vier sind schon tot. Das ist ein großes Problem.
N.K.: Na ja.
N.W.: Und dieses Problem muss gelöst werden. Die vier starben sozusagen ohne klaren Grund, sie waren alle relativ jung. Ich, der ich 62 bin, halte mich selbst nicht für einen älteren Mann. Die waren aber noch ziemlich jung, als sie starben, sie hätten doch noch lange leben können. Und das ist eben das Problem. Wenn wir die Staatsbeamten einfach leben lassen, wenn wir sie nicht regelmäßig aufrütteln, werden wir bald alle wie Mammute aussterben.
N.K.: Ja, die Staatsbeamten muss man aufrütteln.
N.W.: Habe ich Recht?
N.K.: Na klar. Nun eine Frage, die ich eigentlich allen stelle. Diese Frage bezieht sich auf die jüngeren Generationen. Zum Beispiel kann man heute über den Zweiten Weltkrieg nur aus Lehrbüchern erfahren. Denn nur wenige ältere Menschen sind noch am Leben, die erzählen können, wie es damals wirklich war. Wie meinen Sie, was sollte man den Kindern, die in der fernen Zukunft zur Welt kommen, hinterlassen? Sollte man vielleicht eine Zusammenfassung schaffen davon, woran wir uns immer erinnern müssen?
N.W.: Ich vertrete die Ansicht von Tolik Gubarew. Es sollten in jeder Stadt Zentren bzw. Verbände für die durch die Katastrophe von Tschernobyl betroffenen Menschen eröffnet werden. Das Beste aus diesen Zentren soll in einem Lehrbuch in der Geschichte der Ukraine zusammengefasst werden.
N.K.: Eine Art Erfahrung?
N.W.: Genau. Damit jede neue Generation von dieser Tragödie nicht bloß Bescheid weiß, sondern damit sie diese Tragödie im Geschichteunterricht behandelt. In jedem Lehrbuch in Geschichte muss es unbedingt ein Kapitel, dass Tschernobyl gewidmet wäre. Vielleicht sollte dieses Kapitel nicht besonders groß sein, doch es soll ein solches Kapitel geben!
N.K.: Ich finde die Idee großartig!
N.W.: Na ja, vielleicht wird es uns in 20 oder 30 Jahren nicht mehr geben, vielleicht werden diese Zentren und Verbände langsam von der Bildfläche verschwinden, aber momentan sind sie sehr wichtig. Die Menschen, die da drüben waren, verlassen diese Welt, die Erinnerungen verblassen. Das, was die Zeugen jener Ereignisse erzählen, muss unbedingt erhalten bleiben. Als meine Kinder klein waren, luden mich ihre Lehrer oft in die Schule ein, in die sie beide gingen, damit ich mit den Kindern meine Erinnerungen teile. Und ich tat es gerne, ich bemühte mich, den Kindern meine Erlebnisse zu übermitteln und darüber, was ich erlebt hatte, spannend zu erzählen. Ich vermisse diese Treffen, es ist sehr schade, dass sie schon längst vorbei sind. Jetzt lädt uns niemand in die Schulen ein, niemand interessiert sich für die Tragödie von Tschernobyl. Das Interesse nimmt ab. Eben deshalb braucht man diese Verbände – sie erhalten das Interesse an diesem Thema. Wird es dieses Thema in Lehrprogrammen und Lehrbüchern geben, werden dann die Kinder schon gezwungen sein, davon was zu wissen. Und dann können die Lehrer uns wieder einladen, hoffentlich werden wir Mammute (N.W. lacht) dann noch nicht alle ausgestorben sein. Dann werden die Kinder eine Gelegenheit bekommen, mit Zeugen jener Ereignisse zu sprechen.
N.K.: Herzlichen Dank. Möchten Sie vielleicht noch etwas hinzufügen?
N.W.: Das wäre es. Ich kann nur hinzufügen, dass ich sehr froh bin, dass Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass so ein Buch verfasst wird, es wird wohl auch von großem Nutzen sein. Und es ist überhaupt sehr angenehm, wenn sich die Menschen an dich erinnern, wenn deine Meinung und deine Erinnerungen wichtig sind.
N.K.: Danke
N.W.: Ihnen großen Dank!
[1] Es bestand für sowjetische Schüler zwei Optionen: Sie konnten entweder den ganzen 10 Jahre studieren, nach dem 10. Schuljahr (anders gesagt, der 10. Klasse) Abschlussprüfungen ablegen und dann sich um Studienplätze an Universitäten und Hochschulen bewerben, oder nach dem 8. Schuljahr (der 8. Klasse) in eine Berufsschule wechseln. Nach der Ausbildung in der Berufsschule ging es entweder gleich arbeiten, oder an eine Hochschule.
[2] Das heutige Snamensk, eine Stadt in der Oblast Astrachan (gehört heute der Russischen Föderation an), wo ein Raketentestgelände liegt.
[3] Bekannte Charkiwer Zeitung
[4] Ein Fluss im Osten der Ukraine
[5] Hausgebrannter Schnaps
[6] (ukr., rus.) Vati. So nennen ukrainische und russische Kinder scherzhaft ihre Väter und die Soldaten in der ukrainischer und der russischen Armeen ihre Kompaniechefs.
[7] Ein für die politische Erziehung innerhalb einer Militäreinheit zuständiger Offizier.
[8] Eine in der Sowjetunion verbreitete Anredeformel nicht nur in der Armee, sondern auch im Berufsleben.
[9] In der Sowjetunion bestand für die meisten männlichen Staatsbürger die Wehrpflicht. Die Dienstzeit betrug für Soldaten und Unteroffiziere normalerweise zwei Jahre.
[10] Psychische und manchmal auch physische Erniedrigung Einberufener von Seiten schon gedienter Soldaten.
[11] Reservisten
[12] Berühmte sowjetische und russische Pop-Sängerin
[13] Die Bezeichnung geht auf das Wort „Pidor“ zurück, den pejorativen Begriff für männlichen Homosexuellen.
[14] Die Abkürzung „ATO“ steht für die Anti-Terror-Operation, die die ukrainischen Streitkräfte seit 2014 in der Ostukraine führen und die Teile der Oblast Donezt und der Oblast Luhansk umfasst, die sich 2014 für unabhängige Volksrepubliken erklärten.
[15] Verzeichnis Nr. 1 steht für ein durch die Anordnung des Ministerkabinettes der Sowjetunion festgelegte Liste von Berufen, Tätigkeitsbereichen und Ämtern, die zur vergünstigten Rentenversorgung berechtigten.
[16] Sammelbegriff für alle, die sich an der Beseitigung von den Folgen der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl beteiligten (Liquidatoren, Fahrer, Ärzte, Köche u. a. m.)
[17] Der Begriff „Obkom“ stand für den Oblast-Ausschuss der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Die Obkome waren im Grunde genommen für die ideologischen Aspekte der Wirtschaft und der Politik innerhalb der Oblasten verantwortlich.
[18] Der Gorkome (Stadtausschuss der Kommunistischen Partei der Sowjetunion) kontrollierten ideologische Aspekte des Alltaglebens, des Bildungssystems, der Wirtschaft und des politischen Lebens innerhalb einer Stadt.
[19] Die Beamten von Obkomen und Gorkomen galten in der Sowjetunion als Crème de la Crème. Sie und die Angehörigen ihrer Familien genossen Privilegien, die den durchschnittlichen sowjetischen Bürgern unzugänglich waren (bessere medizinische Versorgung, Spezialverpflegung, Auslandsreisen usw.)
[20] Akademische Grade in der Sowjetunion und in manchen Ländern des postsowjetischen Raums.
[21] Der höchste gesetzgebende Organ der Sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine.
[22] Mulllverbände
[23] Die Charkiwer Studentenklinik, die in Charkiw auch als Klinik Nummer 20 bekannt ist, betreut Studenten, Forschungs- und Lehrkräfte aller Universitäten und Hochschulen der Stadt.
[24] Abgeleitet vom Adjektiv „sowjetisch“ diente das Wort „Sowok“ zu einer leicht abwertenden Bezeichnung eines sowjetischen Staatsbürger.
[25] Kommunistischer Jugendverband der Sowjetunion.
[26] (rus.) Umbau. Der von Michail Gorbatschow, dem damaligen Staatschef der Sowjetunion, initiierte und eingeleitete Prozess zum Umbau gesellschaftlicher Werte und politischen Systems der UdSSR.