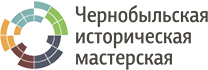Ljudmila
Ljudmila
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Wohnort:
Die Zeit, in der Tschernobyl-Zone :
Audio Nr.1.
Natalija Koslowa (im Folgenden N.K.): Also, heute ist der 20. Januar 2014, ich, Natalija Koslowa, mache ein Interview mit, stellen Sie sich bitte vor...
Ljudmila Gorschenina (im Folgenden L.G.): Ljudmila Michajlowna Gorschenina.
N.K.: Und jetzt stelle ich Ihnen meine erste Frage, die ziemlich umfangreich ist, eine Frage und gleichzeitig eine Bitte: erzählen Sie die Geschichte Ihres Lebens. Alles, was Sie für nötig halten.
L.G.: Meines Lebens?
N.K.: Ja.
L.G.: Mein Leben war gleich wie bei allen Anderen, alle wurden damals mit der gleichen Elle gemessen. Also, nichts Besonders. Die Schule...
N.K.: Und wo sind Sie geboren?
L.G.: Ich bin in Weißrussland, in der Stadt Baranowitschy geboren. Mein Vater war beim Militär und nach dem Krieg stand sein Truppenteil natürlich an der Grenze. Und die Eltern haben dort eine Zeitlang gewohnt. Dann sind sie nach dem Krieg nach Charkiw umgezogen. Aber ich habe in Wowtschansk studiert, dort stand der Truppenteil meines Vaters. Und dort habe ich eine Fachschule für Medizin absolviert, 3 Jahre habe ich im Dorf Michajlowka (Perwomajskij Rayon, Charkiwer Oblast) als Feldscherin gearbeitet, ich wurde dorthin zur Arbeit geschickt. Später kam ich nach Charkiw, wo meine Eltern wohnten, und arbeitete im Institut für Technik und Wirtschaft, in der Studentenpoliklinik. Und da ich Feldscherin war, arbeitete ich an der Sanitätsstelle im Institut für Technik und Wirtschaft. Dort habe ich bis zur Tschernobyl-Katastrophe gearbeitet, und nach Tschernobyl erkrankte ich sehr und habe ich die ganze Zeit in Krankenhäusern verbracht. Ich konnte nicht arbeiten und ich dachte sogar darüber nach, überhaupt meine Arbeit aufzugeben, weil ich nicht in der Lage war zu arbeiten. Einmal habe ich mich aber mit meiner Freundin getroffen, sie war Leiterin der Sanitätsstelle in der Rechtsakademie. Und ich habe ihr gesagt, dass ich aufgeben würde, dass ich keine Kräfte hatte, dass ich die ganze Zeit im Krankenhaus war. Sie sagte: „Ich kenne dich, komm zu mir arbeiten. Komm und wir werden zusammen arbeiten“. Und es wäre alles. Ich habe angefangen, bei ihnen in Teilzeit zu arbeiten, und hier arbeite ich bis jetzt.
N.K.: Und erzählen Sie, wie sind Sie nach Tschernobyl gekommen? Wie ist das überhaupt passiert?
L.G.: Das werde ich Ihnen gleich erzählen. Kaum ist diese Katastrophe in Tschernobyl passiert...
H.K.: Wie haben Sie überhaupt davon erfahren?
L.G.: Wir haben es wie alle erfahren, aber, na ja, nicht sofort. Gewiss verbreiteten sich darüber Gerüchte. Aber es gab keine einzigen Erklärungen. Und erst später hat es eine offizielle Erklärung gegeben ...
N.K.: Wann war das?
L.G.: ...aber wir haben von der Radiostation „Swoboda“ (in Deutschland ist unter dem Namen Radio Freies Europa bekannt) erfahren, und auch von anderen Radiostationen, ich denke, aus Finnland, oder aus anderen Ländern, welche diese radioaktive Strahlung erreicht hat. Sie haben Alarm geschlagen, und jetzt blieb unseren Behörden nichts anderes übrig. Eigentlich waren sie gezwungen, zu berichten. Und dann begannen sie sogar zu zeigen und zu erzählen, wie schwer das war, wie schnell diese Leute... Zuerst haben sie aber gesagt, dass es nur für einige Tage war, vielleicht für drei Tage, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Leute zuerst nur für ein paar Tage evakuiert wurden. Und ich habe sofort Geld nach Tschernobyl überwiesen, sobald alles bekanntgegeben wurde. Obwohl niemand aus meiner Umgebung mich dabei unterstützt hat und sogar...
N.K.: Die Anderen haben das nicht verstanden.
L.G.: Irgendwie haben sie das nicht verstanden. Und aus Kyjiw kamen meine Verwandten und brachten ihre Kinder zu uns nach Charkiw mit. Sie haben mir gesagt: „Dieses Geld hättest du lieber uns geben sollen“. Aber ich habe doch auch für meine Verwandten gesorgt, ihre Verpflegung übernommen. Sie waren aber nicht so betroffen! Manche konnten es nicht wirklich verstehen. Diese Leute aus Tschernobyl haben alles – ihr Haus und alles Andere, und das ganze Hab und Gut plötzlich verloren. Das war nicht zu vergleichen.
N.K.: Natürlich nicht.
L.G.: Und danach suchte ich lange nach Informationen darüber, wie man nach Tschernobyl fahren konnte, um die Liquidatoren zu unterstützen. Denn jemand sollte ja für die Verpflegung, Behandlung usw. der Leute, die die Folgen der Katastrophe beseitigt haben, sorgen. Die ganze Zeit hörte ich das Radio, aber konnte nichts verstehen. Eigentlich gab es keine Antwort auf meine Frage, weil man behauptete, dort habe eine Poliklinik funktioniert, und nicht nur die Poliklinik, alles Andere auch. Und plötzlich hat mich meine Freundin angerufen, sie ist da auf dem Foto neben mir, und zu meinem Erstaunen hat sie mir mit einer, sozusagen, tränenvollen Stimme gesagt: „Ich werde nach Tschernobyl geschickt“. Und ich habe gesagt: „Tanja, aber das ist es, wonach ich schon so viel Zeit gesucht habe. Lass mich an Stelle von dir fahren. Keine Frage“. Sie sagte:„Aber es fahren viele Leute, der Chefarzt lädt jemanden ein und sagt, er solle fahren“. Ich sagte: „Ich fahre an Stelle von dir. So mach dir keine Sorgen“. Sie ging zum Chefarzt und erzählte von mir. Dann hat der Chefarzt mich angerufen und gefragt: „Wieso hast du so eine Entscheidung getroffen?“ Und ich antwortete: „Ich halte es für meine Pflicht, ich bin schon 40 Jahre alt und ich habe schon genug... nicht im Sinne lang genug gelebt, aber ich habe schon ein moralisches Recht dorthin zu fahren. Ich habe das Leben kennengelernt und halte es für meine Plicht einfach dorthin zu fahren...“ Wie konnte ich es anders sagen? Na, es klingt wahrscheinlich zu pathetisch, aber ich dachte, mit solchen Gefühlen sollte man auch dorthin fahren.
Wie konnte ich es anders sagen? Na, es klingt wahrscheinlich zu pathetisch, aber ich dachte, mit solchen Gefühlen sollte man auch dorthin fahren. Sie haben mir gesagt: „Gut, wir tragen dich ein. Als was wirst du dort arbeiten?“ Ich habe geantwortet: „Ich werde im Behandlungszimmer arbeiten“. Ich wurdegeschickt, aber Tanja war jedoch von dieser Pflicht nicht befreit. Und dann, als ich in die Poliklinik gefahren bin, als der Tag der Abfahrt bestimmt wurde, war ich enttäuscht und erschrocken, als ich junge Ärzte und Krankenschwestern, junge Menschen, sah. Das konnte ich nicht verstehen.
N.K.: Es war schon in Tschernobyl, oder?
L.G.: Nein, es war vor der Poliklinik.
N.K.: Aha.
L.G.: Dort stand ein Bus, wir wurden versammelt und sogleich fuhren wir fort. Ich dachte, dass junge Menschen dorthin nicht fahren sollten. Wenn man agitiert oder zwingt, dann sollten es schon ältere Leute sein, die schon gelebt haben. Wir setzten uns der Gefahr aus! Es war offenbar lebens- und gesundheitsgefährlich. Warum schickte man die Jugend dorthin? Ich war einfach empört und erstaunt. Und trotzdem kamen wir an. Wissen Sie, von etwa 30 unseren Kollegen fuhren nur 4 Menschen freiwillig. Die anderen waren einfach von der Leitung gezwungen. Aber ich unterhielt mich mit diesen Leuten nicht, ich arbeitete in der Sanitätsstelle weit von der Poliklinik. Vorher hatte ich gedacht, dass alle dorthin fahren wollten. Unterwegs empörten sich alle, flüsterten miteinander. Dann sind wir in Tschernobyl angekommen, und die Stimmung hat sich geändert. Es gibt einen Spruch, dass an allen Situationen man etwas Positives finden soll. Eigentlich haben alle sich mit ihrem Los abgefunden, die Stimmung war schon gut und schlagfertig. In Tschernobyl sind meine Mitfahrer andere Leute geworden.
N.K.: Ja.
L.G.: Wir arbeiteten dort von 8 bis 10, ohne die Poliklinik zu verlassen, weil es verboten war. Wir wohnten auch dort. Wir wohnten in der Lenin-Straße, dort war die Station der Poliklinik. Das war wie ein Krankenhausviertel: Dort war ein Tagesspital, wo die Kranken lagen und wo wir wohnten.
N.K.: War das direkt in Tschernobyl?
L.G.: Direkt (hustet). Die Stadt Tschernobyl, die Lenin-Straße. Und dort wohnten wir hinter der Poliklinik, gerade im Hof. Morgens stand ich auf, öffnete die Poliklinik um 6 Uhr morgens, weil ich im Behandlungszimmer arbeitete. Ich musste Spritzen sieden lassen, nach der Benutzung mussten sie in vielen Lösungen bearbeitet werden. So wusch man sie immer aus. Und dann sott man sie noch einmal... Gegen 8 Uhr musste mein Zimmer schon fertig sein. Und ja, ich habe vergessen Sie (wer ist gemeint?) zu erzählen: Als ich eingetragen war, habe ich meine Freundin gefragt, die im Exekutivkomitee des Bezirks arbeitete: „Raja, frag jemanden, wie man sich vorbereiten kann, um sich vor Strahlung zu schützen, das ist ja so ein gefährliches Gebiet“.
N.K.: Das stimmt.
L.G.: Der Chefarzt hat uns erzählt, dass irgendwo in Kasachstan man Versuche gemacht hat, und alle Leute sind so schön geworden. Wissen sie, so mandelförmige große Augen? Nun also, sind sie nach der Strahlung so schön geworden. Diese Erzählung ist mir im Gedächtnis geblieben. Also habe ich meine Freundin angerufen und gefragt: „Raja, erkundige dich bei den Fachleuten, wie man sich hier schützen kann“. Sie hat gefragt und dann mir alles erzählt. Als ich mein Zimmer betrat, habe ich alles ausgestattet, wie mir gesagt wurde. Alles, was im Zimmer war, musste ich mit Folie überziehen. Und dann musste ich alles mit Wasser bespritzen. Also nahm ich eine Ohrspritze, das war die größte Spritze, einen Behälter mit Wasser und begann alles zu bespritzen. Aber ich musste den ganzen Tag das Zimmer bespritzen, und das Wasser floss immer ab. Dann nahm ich all dieses Wasser und goss weg. Und so den ganzen Tag habe ich den Kranken Spritzen gegeben, behandelt, und in der Zwischenzeit bespritzte ich alles, was im Zimmer war. Die Folie schützte gegen Strahlung, aber man wusste das nicht. Ich habe allen erzählt, aber wenige Leute haben mich verstanden, und einige haben sich sogar über mich lustig gemacht. Selbst die Chefärztin, Gott hab sie selig, stand draußen ohne Kappe und rauchte. Sie hat immer geraucht! Und einmal kam ein Spezialist und sagte: „Sagen Sie ihrer Mitarbeiterin, dass man sich so nicht benehmen darf. Erstens ist sie draußen ohne Kopfbedeckung, und zweitens, raucht sie“. Ich habe gesagt: „Wissen Sie, das ist unsere Chefärztin, sagen Sie ihr das bitte“. Und auch hatten wir nicht immer Zeit. Manchmal hatten wir genug Zeit, zu essen. Wir kamen in die Kantine, aßen schnell, und nahmen auch etwas mit, weil man nicht alles auf einmal essen konnte, und dann, damit wir keinen Hunger haben, gab man uns Verpflegungspakete. Aber alle lagen das Essen aufs Fensterbrett. Ich habe gesagt: „Mädel, legt sie nichts aufs Fensterbrett, die Strahlung kommt durchs Fenster“. Alle waren so unvorsichtig. Sogar in der Kantine hingen die Plakate: „Vor dem Essen muss man den Mund mit Wasser ausspülen und die Hände sorgfältig waschen“. Die Bergarbeiter kamen vom Scheitel bis zur Sohle im Grund (mit dem Boden in Berührung), und dieser Boden war radioaktiv, und sie kamen gleich in die Kantine. Ich sah das und ich habe ihnen gesagt: „Leute, spült den Mund zuerst aus, wascht eure Hände“. Aber nein, wurde mir nur gesagt: „Na, warum belästigst du sie? Lass sie in Ruhe“. Es kam mir so merkwürdig vor. Ich dachte, man durfte sich so nicht benehmen (im Flüsterton). Naja, was noch? Wir wurden mit Krankenwagen gebracht, wir versammelten uns dorthin, alle, die dort waren – 30 Leute, wir saßen wie Heringe gedrängt und wurden in die Kantine gebracht. Ja, niemand hat über das Essen geklagt, das Essen war ziemlich gut.
N.K.: Ich bitte Sie um Entschuldigung, im welchem Monat war das?
L.G.: Das war vom 12. August bis zum 12. September.
N.K.: Im Jahre 1986?
L.G.: Ja, 1986. Also, als wir dorthin kamen, begannen wir uns anzupassen. In der Poliklinik gab es so viele Karten. All diese medizinische Papiere. Und plötzlich hat die Leitung den Befehl erteilt – alle diese Karten wegzuräumen. Ja, sie waren kontaminiert, aber man konnte sie erhalten, mit Wasser begießen und dann würden sie...
N.K.: Würden sie dort liegen.
L.G.: ...würden sie dort liegen. Na gut, ich bin keine Expertin. Aber Sie könnten einen Spezialisten einladen und ihm das erzählen und danach fragen, ob man es tun sollte. Ich meine, diese Karten konnten wir mit etwas zudecken und mit Wasser angießen. Aber nein, wir haben sie ausgeweidet, hinausgetragen, weggeschaffen. Ja, wir haben Masken getragen, aber warum haben wir das gemacht – das konnten wir nicht verstehen.
N.K.: Und die Arbeit war unnötig?
L.G.: Ja, ja. Insgesamt mochte ich die Arbeit in der Sanitätsstelle nicht. Einmal kam ein Strahlungsmesser. Ich habe gesagt: „Ach, wie gut, dass Sie gekommen sind. Sehen Sie, bitte, wo wir Problemstellen haben“, weil die Poliklinik ziemlich groß war, „wo es am meistens Strahlung gibt. Vielleicht sollten wir weggehen oder in ein anderes Zimmer gehen. Nun, treffen Sie einige Maßnahmen, damit Leute sich hier nicht der Strahlung unterziehen“. Und er begann damit, ohne zu streiten. Aber plötzlich sah das die Chefärztin: „Wer hat das Ihnen erlaubt? Was machen Sie? Nun, hören Sie auf“. Es war für mich unerwartet, wäre ich an ihrer Stelle gewesen, hätte ich im Gegenteil gesagt: „Sehr gut, vielen Dank!“. Aber die Menschen sind verschieden.
N.K.: Natürlich war ihr Benehmen seltsam.
L.G.: Seltsam... Nein, das ist nicht seltsam: Das war eine der Personen, die von kommunistischer Partei erzogen wurde. Für diesen Menschentyp war es typisch, das war ihre Aufgabe. Obwohl ich auch in der kommunistischen Partei war, und ich war sogar Stellvertreterin für Organisationsarbeit in einer Parteiorganisation, aber wir hatten unterschiedene Meinungen zu diesem Problem. Obwohl ich mit ihr eine Zeitlang befreundet war. Nach der Arbeit in Tschernobyl nicht mehr. Aber wir haben uns miteinander gut vertragen.
N.K.: Wie wurde ihre Freizeit organisiert? Konnten Sie sich ausruhen, oder?
L.G.: Na, Freizeit... Zu uns kamen Alla Pugatschowa, Walerij Leontjew. Aber insgesamt war alles nicht organisiert, nein. Jeder war für sich allein. Zu jedem kamen Kranke, sie waren mit ihnen in Kontakt. Ich hatte Glück, dort waren ein Oberst aus der chemischen Truppe, und ein anderer, auch mit einer Führungsposition. Wenn sie zu mir kamen, habe ich geklagt: „Oh, ich will Leontjew (Sänger) hören“. Und viele wollten ins Konzert, so war es ziemlich schwer diese Möglichkeit zu bekommen. Uns ist es aber gelungen zu Pugatschowas Konzert zu gehen. Dieser Oberst der chemischen Truppen, der von mir behandelt wurde, kam mit dem Auto. So habe ich das Konzert besucht, aber nicht viele Leute konnten das machen.
N.K.: Ja. So, das heißt, es war schwer auch dorthin zu gehen?
L.G.: Schwer. Und es gab keine Ordnung, niemand hat ein Auto für uns bestellt. Und noch eins: Während ich dort war, habe ich mich mit einer Frage gequält: Warum sind wir hier? Dort war doch niemand außer uns... Ich weiß nicht genau, vielleicht hat jemand dort in Tschernobyl selbst gearbeitet. Aber warum waren wir dort, während alle Leute kamen, arbeiteten und dann nach Seljonyj Mys (eine Siedlung für Schichtarbeiter des Kernkraftwerks Tschernobyl) fuhren. In Seljonyj Mys war alles anders, es war außerhalb der Sperrzone von Tschernobyl (der 30-km-Zone um Tschernobyl). Aber wir waren Ärzte. Und die Ambulanz war immer in der Nähe, weil dort verschiedene Unfälle passiert sind, so musste die medizinische Schnellhilfe natürlich dabei sein. Aber wir haben dort unterschiedliche andere Erkrankungen auch behandelt, nicht die Ambulanz, warum waren wir denn in diesem gefährlichen Gebiet? Wir mussten doch irgendwo dort sein, wo die Leute wohnten, wo sie krank waren, wo wir sie ärztlich behandeln konnten. Aber niemand hat mich verstanden und man hat mir nur gesagt: „Bleib hier!“ Weil man uns dafür gezahlt habe.
N.K.: Nun, es scheint, dass es ziemlich schwer für Sie war.
L.G.: Für mich schon. Aber meine Freundin hat gesagt: „Ljudmila, wir werdenja bezahlt“. Und sie war Krankenschwester, sie hat vor Kurzem eine Baugenossenschaftswohnung bekommen und sie brauchte natürlich dieses Geld. Ich habe gesagt: „Tanja, in jedem Fall bekommen wir es nicht. Jemand bekommt. Gut, wenn wir überhaupt ärztlich behandeln würden“.
N.K.: Und wie? Hatten Sie Recht? Hatten sie nichts bekommen?
L.G.: Na, ich habe mir eine Rente gerichtlich erstritten, aber ich bekomme sie nicht. Und Tanja ist überhaupt gestorben, Gott hab sie selig. So ist das.
N.K.: Und mit welchen Problemen haben sich Kranke an Sie gewandt?
L.G.: Sie hatten wie alle Radikulitis, Tonsilitis. Und man kam, oh, ich will das erzählen.
N.K.: Erzählen Sie bitte.
L.G.: Leute kamen massenweise, nun, aus Georgien, aus der Westukraine. Ich kann diese Georgier nicht vergessen (lacht). Gesunde, schöne, kräftige Männer, und wie sie gekleidet waren! Wissen Sie, dann war alles im Defizit, man konnte nichts kaufen, und sie haben Pullover aus Samtleder getragen, sie waren so schön gekleidet und hatten einen Koffer voll mit Kleidung. Und ich habe gefragt: „Wozu? Und was für Koffer sind das?“ Und sie haben gesagt: „Wie? Wir werden uns doch umziehen“. Ich habe gesagt: „Aber in 5 Minuten darf man das nicht anziehen, man soll das wegwerfen“. – „Ach, was sagen Sie, warum so“. Und sie wollten arbeiten. Ich weiß nicht, ob sie freiwillig nach Tschernobyl gekommen sind oder gezwungen wurden. Ich arbeitete im Behandlungszimmer und gegenüber wardas Behandlungszimmer eines HNO-Arztes, und dort gab es keine Krankenschwester, obwohl einige Ärzte mit Krankenschwestern zusammen arbeiteten. Manchmal habe ich Ärzten geholfen, weil wenn eine neue Gruppe angekommen war, eine ärztliche Untersuchung begann. Alle wurden untersucht. Ein Mann kam aus den Bergen (hustet). Wir dachten, dass er ein alter Mann war, aber er war nicht einmal vierzig. Er war ohne Zähne.
H.K.: Oh.
L.G.: Ja. Vielleicht war er kräftig, aber wie kann man kräftig sein, wenn man keine Zähne hat? Er musste doch kauen, das Essen musste gekaut werden und erst danach kann es verdaut werden. So war es ein Rätsel für mich, wieso er dorthin geschickt wurde. Aber unsere Leiter haben gleich alle Unterlagen ausgestellt und ihn weggeschickt, obwohl sie Leute brauchten. Vielleicht musste man 30 Leute nach Tschernobyl bringen, so mussten diese 30 Leute gefunden werden. Aber er wurde sofort aussortiert. So wurden einige aussortiert: Kranke, die bei der ärztlichen Untersuchung aussortiert wurden. Leute waren durchaus nicht vorbereitet, sie kamen mit solcher Euphorie, wollten Bürgerpflicht erfüllen. Ich habe das gesehen.
N.K.: Nun, die Georgier waren heiß?
L.G.:Ja. Und nach uns kamen Frauen aus der Westukraine für unsere Ablösung. Sie waren noch Mädchen, so schlank, sie trugen Stöckelschuhe und Kleidung aus Lurex. Ich sah sie und dachte: Mein Gott, unsere Leute sind völlig unvorbereitet. Niemand hat ihnen etwas erzählt. Man muss sich immer umziehen, waschen und noch einmal umziehen.
N.K.: Ja, und die Georgier haben Sie beeindruckt?
L.G.: Ja, ja.
N.K.: Und sie, waren sie die ganze Zeit solcher Laune oder haben sie sich geändert?
L.G.: Ich weiß nicht, meistens herrschte da irgendeine euphorische Atmosphäre. Ich sah das... na, wie viele Leute waren dort? Ich weiß nicht, tausend Leute waren auf dem Pugatschowas Konzert, alle waren guter Laune. Und auf dem Konzert von Leontjiew auch. Ich habe niemanden gesehen, der schlechter Laune war oder meckerte. Nein, das sah ich nicht. Während dieses Monats, als wir dort arbeiteten, haben wir fast alle Leute gesehen, viele wurden von uns untersucht.
N.K.: Und wie hat Ihre Familie auf Ihre Dienstreise reagiert? Waren sie nicht dagegen?
L.G.: Meine Familie war zuerst dagegen. Na ja, nicht genau dagegen, sie haben einfach gefragt: „Oh, Ljudmila, wieso?“. Und ich habe gesagt: „Ja, man muss, jemand muss“.
N.K.: Das heißt, sie waren nicht so begeistert?
L.G.: Nein, natürlich nicht. Sie hatten Fragen, so viele Fragen. Und ich habe ihnen alles erzählt, dann hatten sie keine Fragen mehr.
N.K.: Klar.
L.G.: Ja.
N.K.: So, als Sie dort waren, oder vielleicht später... Wann hatten Sie das Gefühl, dass dort eine Katastrophe oder etwas Furchtbares passiert ist? In welchem Moment haben Sie das empfunden?
L.G.: Na, die Katastrophe habe ich sofort empfunden...
N.K.: Sofort, ja?
L.G.: Als uns gesagt wurde...
N.K.: Was wurde gesagt?
L.G.: Uns wurde gesagt, dass die Menschen von dort evakuiert wurden, es war natürlich eine Tragödie. Es ist schon eine Tragödie, dass die Leute alles verloren haben. Alles auf einmal. Und dann hat sie sich täglich nur verschärft, als wir durch diese leeren Straßen an diesen vernagelten Häusern vorbei fuhren. Davon habe ich mich schon mit meinen eigenen Augen überzeugt. Ich habe mir vorgestellt, wie es war – da hatten wir alles und plötzlich hatten wir nichts. Und als ich das mit meinen Augen sah, so...
N.K.: Also haben Sie dann schon mit Ihren eigenen Augen gesehen?
L.G.: Jaja.
N.K.: Es hat wahrscheinlich Sie sehr beeindruckt.
L.G.: Ja, klar. Aber ich möchte noch etwas erzählen, dort war eine Augenärztin, Gott hab sie selig. Um 6 Uhr morgens ging ich hinaus, es wurde schon hell und ich ging zur Poliklinik, während alle schliefen. Und einmal ging ich wie immer und sah plötzlich graues Licht. Und plötzlich hörte ich jemanden hinter mir klappern. Ich habe mich umgedreht, aber sah niemand. So ging ich weiter und jemand ging hinter mir weiter und dann blieb er stehen. Ich blieb auch stehen und das Klappern hörte auf. Ich ging ein bisschen weiter und es klapperte wieder. Ich habe mich noch einmal umgedreht, weil ich Angst hatte. Niemand war da. Ich habe gedacht, was ist los? Ich ging weiter – dasselbe. Und ich blieb dann nicht im Licht, sondern im Schatten und sah im Licht einen großen Hund. Ein großer Hund ging hinter mir. Wenn ich stehenblieb, hatte er natürlich Angst und blieb auch stehen. Und als ich in die Poliklinik kam, habe ich dieser Ärztin gesagt: „Oh, ich bin so erschrocken, ein so großer Hund hat mich verfolgt“. Und er sah mies aus und aus seinem Mund kam Schaum. Aber wir hatten keine Angst, dass es Tollwut war, wir haben schon Katzen gesehen, und allen floss etwas aus der Nase. Und so war dieser Hund. Gewöhnlich kam ich um 6 Uhr morgens allein in die Poliklinik, öffnete die Tür und hatte keine Angst. Aber diesmal begann ich mit allen metallischen Dingen zu klopfen, so war es mir ungemütlich. Die Stille herrschte, niemand war dabei. Also kam ich zurück, und es wohnten 4 oder 5 Leute in unserem Zimmer, und sagte: „Ich hatte so Angst“. Aber ich habe nur von meinem Eindruck erzählt. Am nächsten Morgen stand ich auf und diese Augenärztin stand auch um 6 Uhr auf. Ich habe sie gefragt: „Lara, warum bist du aufgestanden?“ Und sie hat gesagt: „Ich komme mit“. Ich habe gefragt: „Warum?“ – „Na, ich komme mit“. Aber ich habe sie nicht darum gebeten. Nun, nicht alle 30 Leute sind aufgestanden und mitgekommen, nur sie kam. Ich habe niemanden gebeten, nein, ich habe nur erzählt, und sie ist immer danach aufgestanden, obwohl sie zur Arbeit um 8 Uhr kommen musste. Aber sie ist aufgestanden und mitgekommen...
N.K.: Damit Sie keine Angst hätten?
L.G.: Ja, damit ich keine Angst hätte.
N.K.: Oh, es war so nett.
L.G.: Ja, das war mir natürlich angenehm. Obwohl wir nicht befreundet waren.
N.K.: Und was ist dann passiert? Als Sie sich in Tschernobyl für einige Zeit aufgehalten haben, waren Sie irgendwie nach Hause gebracht, oder?
L.G.: Na ja, wieder kam ein Bus, und uns wurde gesagt, dass es unser letzter Tag dort war. Neue Leute kamen aus der Westukraine und sie haben uns gebeten, über unsere Zimmer zu erzählen. Ich habe über mein Behandlungszimmer erzählt, was ich gemacht habe, wo und wie. Und da war noch etwas Interessantes. Ein Oberst kam mit Radikulitus. Er musste eine Spritze bekommen, aber er konnte sich weder erheben, noch sich bewegen. Ich habe gesagt: „Ich habe dort einen Stock gesehen“, na, damit er sich stützen konnte. Er kam und sah das Behandlungszimmer: „Ach, was ist das?“ Ich habe ihn angesehen und gedacht: „Aber hier ist alles richtig gemacht“.
N.K.: (lacht)
L.G.: Und unser Chefarzt hat gesagt, als ob er sich entschuldigen würde: „Na ja, unsere Ljudmila Michajlowna, nun sie ist so, man kann nichts machen“. Alles war gedeckt, die Nassreinigung. „Ah, was ist das?“ Aber er hat ein richtiges Verhalten gesehen und für ihn war es...
N.K.: ein Schock?
L.G.: Na, vielleicht kein Schock, aber er war so erstaunt und die ganze Zeit hat er gefragt, was das trotzdem war – für mich war das... Schade, wie schade, dass wir solche Spezialisten hatten.
N.K.: Leider.
L.G.: Und es war unangenehm. Also, wo sind wir stehen geblieben?
N.K.: Sie erzählten, wie Sie Ihr Zimmer...
L.G.: Ach, überreicht haben?
N.K.: Ja.
L.G.: So haben wir alles den Neuangekommen überreicht, deswegen habe ich mich daran erinnert.
N.K.: Ja.
L.G.: Also habe ich gesagt: „Sie müssen alles zudecken, mit Wasser bespritzen, dann all dieses Wasser zusammennehmen und hinaustragen. Nur auf diese Weise kann man sich sichern, es gibt keine andere Lösung“.
N.K.: So haben Sie alles erzählt?
L.G.: Ja, dann stieg ich in den Bus und fuhr weg.
N.K.: Ja. Und dann, als Sie nach Hause gekommen sind, wie war das Verhältnis der Menschen zu Ihnen? Gab es ein besonderes Verhältnis?
L.G.: Nein, es gab kein besonderes Verhältnis. Als wir krank wurden oder Rente zu bekommen begannen, dann waren die Leute unzufrieden.
N.K.: Ach so. Das heißt, Sie wurden nicht besonders respektiert?
L.G.: Respekt – nein, nein, im Gegenteil! Ich habe gesagt: „Sie haben noch Zeit, es gibt so viel zu tun in Tschernobyl. Sie können gerade jetzt dorthin fahren und bekommen, was wir bekommen haben“. Nein, ich sah keinen Respekt, nein. Wir mussten sogar um uns kämpfen.
N.K.: Sogar so?
L.G.: Ja. Als wir krank wurden.
N.K.: Und wie hat die Gesellschaft insgesamt diese Katastrophe empfunden? Welche Stimmung herrschte damals?
L.G.: Na, ich kann selbst nicht sagen, welche. Nun das Volk war unterdrückt, und hat alles für durchaus normal gehalten. Ja, wir lebten damals so. Uns wurde immer gesagt, wie gut alles sei. Nichts Besonderes, nein. Und die Leute, die in Tschernobyl blieben, haben sich zusammengeschlossen und irgendwie zu leben begonnen. weggefahren sind, versuchten sich einzuleben. Wer schneller und schlauer war, hat es geschafft, eine Wohnung zu bekommen.
N.K.: Es kam wahrscheinlich alles vor.
L.G.: Keine Unterstützung, nichts.
N.K.: Und wie hat diese Katastrophe insgesamt die Ukraine beeinflusst? Vielleicht hat die Gesellschaft einige Schlussfolgerungen gezogen?
L.G.: Ich fürchte, dass sie immer noch keine Schlussfolgerungen gezogen haben geschweige denn zur damaligen Zeit. Nein, man hat keine Schlussfolgerungen gezogen. Nur in der Küchewurde es besprochen, und... na ja, die alten Mütterchen haben sich noch empört. Aber insgesamt, nein. Keine Schlussfolgerungen. Wenigstens, keine Schlussfolgerungen, die zur Verbesserung des Lebens führen konnten.
N.K.: Klar.
L.G.: Und Schlussfolgerungen in der Küche oder auf dem Sofa spielen keine Rolle.
N.K.: Sagen Sie bitte, haben Sie jetzt Kontakte zu Leuten, mit denen Sie in Tschernobyl zusammen gearbeitet haben?
L.G.: Na ja, ich habe doch in der Poliklinik gearbeitet. Und wir sehen uns am 24. April... am 26. April, aber sonst nein.
N.K.: Also treffen sie sich nicht, oder?
L.G.: Nein, nein.
N.K.: Also...
L.G.: Wir treffen uns am 26. April, falls jemand kommt, aber sonst nein.
N.K.: Und wenn sie sich treffen, woran erinnern sie sich am meisten? Gibt es vielleicht einige Momente, die sie besprechen?
L.G.: Welche Momente besprochen werden? Vielleicht, keine.
N.K.: Gibt es jedes Mal etwas Anderes, oder?
L.G.: Na ja. Und wissen Sie, wir hatten zuerst Laienkunst.
N.K.: Nachdem sie aus Tschernobyl gekommen sind.
L.G.: Genau. Eine Ärztin hat Gedichte geschrieben, für berühmte Lieder, und wir haben sie gesungen. Man hat uns vor dem Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl versammelt und wir hatten eine Probe. Uns wurde gesagt, lernt dieses Lied, am nächsten Tag gibt es eine Probe. Aber am nächsten Tag hat jemand angerufen – sie sei auf der Straße gefallen, sie komme nicht.
N.K.: Au.
L.G.: Am nächsten Mal bin ich neben dem Schewtschenko-Denkmal gefallen, ich ging auch zu dieser Probe. Ich wurde bewusstlos, fiel und verletzte mich. Ich habe gesagt, ich konnte nicht kommen, und jedes Mal war es so.
N.K.: Schrecklich! (lachen)
L.G.: Und einmal ist folgendes passiert. Es war eine Frau, sie war Ärztin, eine schöne Frau, Therapeutin, sie hatte so ein schönes weißes Kleid mit Spitze. Obwohl sie nicht mehr so jung war, sah sie in diesem Kleid wie eine Prinzessin aus, so schön war sie. Es war im April, und im Dezember, kurz vor dem Neujahr ist sie gestorben. Wenn ich sie sah, bewunderte ich sie so. Und ich dachte, großer Gott, wie... und sie ist plötzlich zu Hause gestorben. Die Ambulanz kam, sie hat sich bekleidet und plötzlich gestorben und… Einmal hat man ein Telegramm oder eine Anfrage in die Poliklinik geschickt, mit der Frage, wen man für diese Arbeit auszeichnen soll. Und eine Frau wollte, dass sie ausgezeichnet wurde. Und sie hat dafür gekämpft, das hat mir die Sekretärin der Parteiorganisation erzählt. Und die Sekretärin der Parteiorganisation hat darauf bestanden, dass ich ausgezeichnet werden sollte, sie sagte: „Nein, ich weiß, wie sie gearbeitet hat, mir wurde alles erzählt“. So wurde ich ausgezeichnet, weil ich wirklich Medizinerin war. Und diese Frau arbeitete zwar im Krankenhaus, aber sie war keine Medizinarbeiterin, und dort war geschrieben: diese Auszeichnung sollte einem Medizinarbeiter verleihen werden. Das war ein Beispiel…
N.K.: Na ja.
L.G.: …wenn sogar für das…
N.K.: Gab es einige…
L.G.: Konflikte.
N.K.: Konflikte, ja.
L.G.: Warum so?
N.K.: Schade, so schade.
L.G.: Ja, ja.
N.K.: Und, was meinen Sie, warum ist diese Katastrophe passiert? Was war der Fehler?
L.G.: Aber wir hatten überall Unfälle.
N.K.: Ja?
L.G.: Die ganze Zeit. Ich kann mich erinnern, ich bin nach dem Krieg geboren, aber ich kann mich nur an die Unfälle erinnern. Da gab es solche Schlamperei überall.
N.K.: Aha.
L.G.: Überall war alles von schlechter Qualität. Das Volk sagte nur „Ringsum sind alle Feinde. Man will uns vernichten. Alle sind Feinde“. Und man baute neben meinem Haus, im Bezirk Saltowka in Cahrkow ein Einkaufszentrum, man hat es „Mausoleum“ genannt. Und ich sagte: Man hat es noch nicht in Betrieb genommen, aber es stürzt schon ein, Fliesen fallen auf den Kopf. Ich fragte: Und welches Land zerstört es? Amerika oder Späher? Wessen Späher zerstören dieses „Mausoleum“? Das sind wir, wir sind die Zerstörer, wir haben alles gestohlen, und ich weiß, dass jetzt nur Zement immer noch das alles zusammenheftet. Und es war überall so. Qualität wurde nicht begrüßt. Das Wichtigste war zum Fest alles schön einzurichten das war es. Alles, was wir untergenommen haben, war schlecht gemacht. Na ja, man hat die Leute für den Raumflug rekrutiert. Aber, in solcher großen Union konnte man einige Leute finden, ein paar Hundert, vielleicht ein Tausend...
N.K.: Verantwortungsbewusste.
L.G.: Verantwortungsbewusste. Man hat sie geschickt und sie haben das gemacht. Alles war schlecht und recht. Und die Leute, die etwas zu tun versucht haben, sie waren nicht begrüßt, das Volk hat sie nicht... Ich habe das selber erlebt. Und die Löhne, darüber ist gar keine Rede, alle haben den gleichen Lohn bekommen – diejenigen, die gut arbeiteten, und diejenigen, die schlecht arbeiteten – alle haben den gleichen Lohn bekommen.
N.K.: Das heißt, es gab keine Förderung?
L.G.: Na ja, die Förderung war eine Urkunde. Ja, manchmal bekam man das13. Gehalt. Aber, wieder hat der Chefarzt gesagt: „Ja, wieder die Gleichen“. Sogar dieses 13. Gehalt sollten auch diejenigen bekommen, die schlecht gearbeitet haben... Im Gegenteil hat man gesagt: „Oh! Warum die Gleichen?“ Aber es waren die Gleichen, weil gute Arbeiter immer gut gearbeitet haben. So war es logisch.
N.K.: Klar. Sagen Sie, wie verhalten Sie sich dazu, dass es jetzt ein Trend ist, Führungen in die Sperrzone zu machen, man schreibt darüber im Internet. Was meinen Sie dazu?
L.G.: Ja, ich habe davon gehört und einige Kinder, die ich respektiert habe, sind damit nicht einverstanden. Aber ich habe die Meinung der Experten gehört und ich... ich würde fahren. Also unterstütze ich diese Exkursionen. Die Menschen müssen sehen, wozu alles geführt hat. Ja, die Sicherheitsmaßnahmen. Und warum soll man nur zeigen und erzählen, sie können selber sehen, was passiert ist. Die Leute müssen das mit ihren eigenen Augen sehen. Meiner Meinung nach muss man solche Führungen machen, damit unser armes... na ja, es ist nicht arm, unordentliches Land ein bisschen verdienen könnte. Selbst wenn es so wäre. Ich weiß nicht, ich bin einverstanden.
N.K.: Und wenn es die Möglichkeit gäbe, wenn, ich weiß nicht ob es jetzt erlaubt oder verboten ist, - würden Sie dorthin fahren, wo Sie einst waren?
L.G.: Wissen Sie – nein.
H.K.: Nein.
L.G.: Das will ich nicht. Aber ich hatte Lust in die medizinische Fachschule zu fahren. Es war ein so großer Wunsch, dass ich gefahren bin. Aber dorthin – nein.
N.K.: Nein?
L.G.: Nein, sogar falls mir gesagt würde, dass es harmlos ist. Aber, was ist Sicherheit jetzt für mich? So viele Jahre sind vergangen.
N.K.: Also haben Sie keine Lust dorthin fahren und zu sehen.
L.G.: Sehen – nein, nein. Ich habe keine Lust. Und ich gehe nur, wohin ich will.
N.K.: Klar.
L.G.: Und jetzt habe ich keine Lust.
N.K.: Ich verstehe. Und sagen Sie, was halten Sie von der Aufrechterhaltung der Erinnerung von den Veranstaltungen, die dafür organisiert werden?
L.G.: Das ist alles Augenwäscherei.
N.K.: Wirklich?
L.G.: Ja, diejenigen, die stehlen – sie stehen in den ersten Reihen und erzählen uns von den Ereignissen. Nein, das ist Augenwäscherei.
N.K.: Und Veranstaltungen in Schulen mit Kindern?
L.G.: Ach in der Schule – ja. Das begrüße ich. Ja, die Kinder brauchen das, unbedingt. Es kommt ein Mensch, der dort war und erzählen kann. Das halte ich für nötig. Aber diese Gedenkveranstaltungen...
N.K.: Und was meinen Sie, was kann man machen, was brauchen wir? <…>
L.G.: In diesem Sinne ist das Wichtigste, dass die Leute, die mit Tschernobyls Geschichte verbunden sind, auftreten und sprechen. Und die Umsiedler auch – sie haben auch viel erlebt. Ich, zum Beispiel, habe Mitleid mit Umsiedlern. Wir sind gefahren, weil wir es wollten, aber sie mussten. Und wir müssen nicht nur am 26. April von ihnen hören. Und überhaupt müssen Journalisten zeigen, wie die Leute, die in Tschernobyl waren, jetzt leben. Und nicht diese Leute, die nur...
N.K.: Ja, ich verstehe, verstehe.
L.G.: ... sogar erzählen, ich weiß nicht, alle diese Organisationen, meiner Meinung nach, haben sich gut eingerichtet. Was machen sie? Erzählen sie uns erzählen, weil ich das nicht weiß.
N.K.: Vielleicht einfach...
L.G.: Ich weiß, zum Beispiel, dass wenn ich zum Jahrestag von der Katastrophe in Tschernobyl in die Poliklinik eingeladen bin, verleiht man zuerst dem Arzt, der ihn ärztlich behandelt hat, diesen Menschen, der Auszeichnungen verleiht. Nach dem Arzt zeichnet er noch diese Leute, von denen er abhängig ist, aus. Und zuletzt bekomme ich eine Auszeichnung. Primitiv und nicht gerecht.
N.K.: Sagen Sie, wollen wir über die Zukunft sprechen. Falls man irgendwann etwas über diese Ereignisse in Lehrbücher schreiben wird, was würden Sie vielleicht empfehlen oder betonen? Es kann etwas sein, woran man sich immer erinnern muss, oder etwas, was man nicht vergessen soll.
L.G.: Oh, natürlich. Ja.
N.K.: Was, was konkret muss jedes Kind, das nichts davon weiß, in einigen Jahren lesen?
L.G.: Kinder müssen lesen, dass sie ehrlich, anständig sein sollen und einen ehrlichen und anständigen Menschen von einem listigen Lügner unterscheiden können. Kinder müssen noch in der Schule verstehen, wem man folgen auf wen man hören soll, und dass man auf die Spezialisten hören sollte. Die Spezialisten sind verschieden. Und nicht dem glauben, was in einer kostenlosen Zeitung steht.
N.K.: Genau.
L.G.: Einmal hat eine Frau in der U-Bahn etwas geschrien. Ich habe sie gefragt: „Wo haben Sie diese Information gefunden?“ Sie hat mich angeschaut: „Was meinen Sie, wo? Im Fernsehen, auf dem Kanal „Inter““. Es tut mir leid, dass sie dieses Programm sieht. Man muss zu den Kindern kommen und erzählen. Falls wir ehrliche, anständige Leute hören, können wir unterscheiden. Oh, da schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, aber ist mir schon leider entfallen, es war sehr... na gut. Ich habe vergessen, aber ich wollte etwas Wichtiges sagen. Ja, man muss nicht nur „Inter“ zuhören, es gibt andere Kanäle, die der Regierung nicht gehören. Möchten Sie es oder nicht, aber man muss die beiden Meinungen hören und dann sie vergleichen. Eigentlich muss man immer nachdenken. Aber alle in der Schule sind krank, und die Lehrer auch – alle sind krank. Ja, Wirbelsäulenerkrankungen: die Ablenkung der Wirbelsäule vor der Obrigkeit. Fast alle leiden daran. Man muss sich behandeln lassen. Jetzt müssen wir uns nicht nur an Tschernobyl erinnern. Ja, wir hatten die Tschernobyl-Katastrophe. Diese Katastrophe ist passiert, aber jetzt leben wir in einer anderen Zeit. Die Situation ist anders. Und man muss jetzt, schon jetzt muss man nachdenken und hochqualifizierten Spezialisten, hochanständigen Leuten zuhören. Ja, es gibt so viele Leute, Straßendiebe, die dann ihr Leben im Gefängnis verbringen, die da erzogen wurden. Man muss nur ehrlichen, anständigen und hochgebildeten Leuten glauben. Dann wird alles gut. Und jetzt haben wir das zweite Tschernobyl, es hat gestern oder heute begonnen, meiner Meinung nach.
N.K.: Die Katastrophe im Land.
L.G.: Die Katastrophe, ja. Und wir gehen den gleichen Weg. Wieder sitzen wir auf dem Sofa, sehen fern, hören Radio und rufen an und machen Vorwürfe.
N.K.: Danke.
L.G.: Bitte.
N.K.: Wollen Sie vielleicht noch etwas hinzufügen, oder?
L.G.: Oh, mir ist ein Gedanke eingefallen. Na ja, schon vergessen (lacht).
N.K.: Vielen Dank!
Audio Nr.2.
L.G.: Man muss unbedingt ergänzen, dass es jedes Jahr in der Studentenpoliklinik eine Konferenz oder eine Veranstaltung gibt... zur Erinnerung an die Leute, die mit der Tschernobyl-Katastrophe zu tun hatten, man hat sogar einen Film gedreht. Man zeigt diesen Film, alle Leute stehen auf, weil einige nicht mehr am Leben sind. Und einige, die geblieben sind, bekommen irgendwelche finanzielle Hilfe. Man muss der Poliklinik, dem Chefarzt Respekt zollen. Na ja, ich kenne einige Leute, die mit der Tschernobyl-Katastrophe verbunden sind, an die niemand in den anderen Institutionen denkt.
N.K.: Vielen Dank.